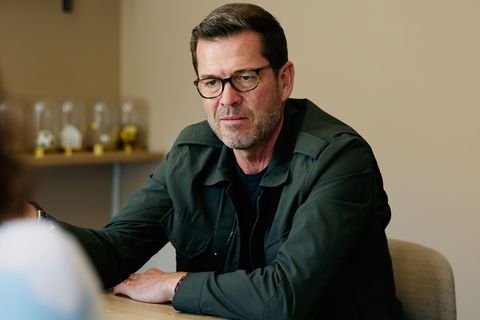Nach der Wahl ist vor dem Tauziehen. Bereits an diesem Dienstag kommen die 28 Staats- und Regierungschefs der EU zusammen, um das Ergebnis der Europawahl zu bewerten. Ihr Abendessen in Brüssel ist der Auftakt zu einem Postengerangel, an dessen Ende, voraussichtlich im Herbst eine neue EU-Kommission stehen wird. Die spannendste Frage lautet: Wer wird mächtiger Präsident der EU-Kommission? In dieser Frage gibt es nach dem knappen Wahlergebnis Diskussionsbedarf.
Laut Unionsfraktionschef Volker Kauder wird sich Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) für den konservativen Spitzenkandidaten Jean-Claude Juncker als neuen EU-Kommissionspräsidenten stark machen. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sieht hingegen weiterhin Chancen für Spitzenkandidat Martin Schulz.
Deutschland stellt als größtes EU-Land mit 96 Mitgliedern der künftig 751 EU-Parlamentarier zwar die größte Gruppe im EU-Parlament, muss aber bei der Besetzung des wichtigen Präsidentenamts Rücksicht auf die anderen Länder nehmen. Konservative wie Sozialisten sind auf Partner angewiesen - möglich ist auch eine Art große Koalition im EU-Parlament wie in Deutschland.
Schließen sich die Rechten zusammen?
Im alten Parlament gab es sieben Fraktionen. Die stärkste bleibt die konservative Europäische Volkspartei (EVP) mit Juncker. Zur EVP zählen auch CDU und CSU. Auf dem zweiten Platz folgen die Sozialdemokraten und Sozialisten mit ihrem Bewerber Martin Schulz. Eine klare Mehrheit gibt es nicht. Im Juni finden sich die neuen Fraktionen erstmals zusammen. Damit eine Fraktion entsteht, müssen sich 25 Volksvertreter aus sieben EU-Staaten zusammentun. Ohne Fraktion sind die Gewählten praktisch machtlos.
Spannend wird sein, ob es anti-europäischen Parteien wie dem französischen Front National gelingt, mit anderen rechten Parteien eine neue Fraktion zu bilden und ihre politische Schlagkraft zu erhöhen.
Für den 1. bis 3. Juli sind die konstituierenden Sitzungen des Parlaments angesetzt. Dann werden der Parlamentspräsident und seine 14 Stellvertreter gewählt. Die ersten Fraktionssitzungen finden vom 7. bis 10. Juli statt. Dort werden auch die Sessel in den Ausschüssen verteilt, wo die praktische Arbeit stattfindet.
Wahl zwischen dem 14. und 17. Juli
Zusätzlich kompliziert wird die Situation, weil es auch innerhalb der jeweils eigenen Parteienfamilien Vorbehalte gegen die Spitzenkandidaten Juncker (Konservative) und den Deutschen Schulz (Sozialisten) gibt. Merkel und Gabriel hatten schon vor der Wahl klar gemacht, dass sie den Eindruck von Mauscheleien bei der Besetzung des Präsidentenpostens vermeiden und sich am Wählerwillen orientieren wollen.
Zwischen dem 14. und dem 17. Juli soll der neue Kommissionspräsident dann gewählt werden. Er wird vom EU-Rat der Mitgliedsländer vorgeschlagen und muss die Mehrheit der EU-Abgeordneten hinter sich bringen - also mindestens 376 Stimmen.
Juncker hatte noch am Sonntag gesagt: "Es führt im Übrigen auch kein Weg daran vorbei, dass Christdemokraten und Sozialisten im nächsten Europaparlament intensiv sachbezogen, aber auch gefühlsmäßig zusammenarbeiten müssen." Er warnte: "Niemand sollte versuchen, eine andere Mehrheit zustande zubringen."
Schulz äußerte sich bei einem Auftritt in der SPD-Zentrale in Berlin nicht zur Personaldebatte. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) blieb in diesem Punkt beim Sender n-tv verhalten: "Das Wahlergebnis ist nicht so, dass es ein Durchmarsch für Martin Schulz auf den Kommissionspräsidenten wird."