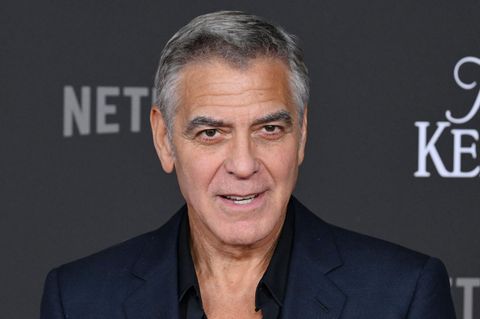In Frankreich haben die Bilder des IWF-Chefs Dominique Strauss-Kahn in Handschellen Bestürzung im ganzen Land ausgelöst. "Ich hatte Tränen in den Augen", sagte der sozialistische Abgeordnete Manuel Valls dem Sender RTL. Die Parteichefin der Sozialisten, Martine Aubry, verglich die Wirkung der Affäre mit einem "Donnerschlag", wie sie es nannte. "Das wirft die Verhältnisse völlig durcheinander", sagte Jacques Attali, ehemals Berater des sozialistischen Präsidenten François Mitterrand und heute Berater von Präsident Nicolas Sarkozy.
Der Franzose wurde in New York City festgenommen, ihm werden versuchte Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und Freiheitsberaubung eines Zimmermädchens in einem Hotel vorgeworfen. Über Details der Anschuldigungen schweigt sich die Ermittlerbehörde aus. Strauss-Kahn wird am Montag einem Richter vorgeführt worden, der über eine Freilassung auf Kaution entscheiden könnte. Die "New York Times" spekulierte über eine Kaution in Höhe von mehreren Millionen Dollar.
Sozialisten halten am Wahlprozedere fest
Dem Vorzeigelinken der französischen Politik wird nach gesagt, dass er bei den nächsten Präsidentschaftswahlen gegen Amtinhaber Nicolas Sarkozy antreten wird, ihm werden sehr gute Chancen nachgesagt. In der Woche nach Ostern war Strauss-Kahn bereits für mehrere Tage in Paris gewesen, um mit politischen Freunden die Strategie für den Kampf um das höchste Staatsamt auszuloten. Mit der Festnahme haben sich die Hoffnungen fürs Erste erledigt.
Die französischen Sozialisten wollen dennoch an den geplanten parteiinternen Vorwahlen festhalten. Es gebe zahlreiche Politiker, die bei der Präsidentschaftswahl 2012 antreten könnten, sagte Parteisprecher Harlem Désir. Der Noch-IWF-Chef hatte sich bislang nicht offiziell zu seinen Plänen geäußert. Vermutlich fehlt Frankreichs Opposition dennoch ein ernst zu nehmender Kandidat, um den weiterhin beispiellos unpopulären Präsidenten zu schlagen.
Alte Vorwürfe holen Strauss-Kahn ein
In Frankreich kocht zudem eine alte Affäre um IWF-Chef hoch: Eine Journalistin will den 62-Jährigen wegen eines sexuellen Übergriffs vor neun Jahren verklagen. Das teilte der Anwalt der 31-Jährigen der Nachrichtenagentur AFP mit. Die junge Frau ist Medienberichten zu Folge Patenkind von Strauss-Kahns zweiter Ehefrau und eine gute Freundin von Strauss-Kahns Tochter Camille.
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Sarkozy schweigt. Die Affäre könnte auch ihn wie die ganze politische Klasse beschädigen
Grassierendes Misstrauen gegenüber der politischen Elite
Präsident Sarkozy selbst hielt sich bislang öffentlich zurück und ließ lediglich den Regierungssprecher dazu aufrufen, die Unschuldsvermutung zu achten. Einige Parteifreunde aber ließen ihrer Genugtuung freien Lauf. "Es beleidigt Frankreich, einen Mann zu haben, der sich derart dem Sex hingibt - und jeder wusste davon", sagte der einflussreiche Pariser Abgeordnete Bernard Debré. Doch manche warnten auch, dass die Affäre nicht nur der Opposition schaden könnte, sondern auch dem Sarkozy-Lager. So sagte Sarkozys Ministerin Marie-Anne Montchamp, dass der Schock "die ganze politische Klasse in Frankreich betreffe".
Tatsächlich kann Sarkozy nicht sicher sein, dass er vom Ausfall seines gefährlichsten Rivalen profitiert. Denn die Vorwürfe gegen den IWF-Direktor, den Sarkozy persönlich ausgewählt hat, sind geeignet, dem grassierenden Misstrauen der Franzosen gegenüber ihrer politischen Elite neue Nahrung zu geben. Seit dem Nein der Franzosen beim Referendum zur EU-Verfassung sehen Soziologen dieses Misstrauen beständig wachsen.
Staatschef leistete sich zahlreiche Affären
Sarkozy selbst hat einst davon profitiert, indem er sich beim Aufstieg zur Präsidentschaft als Außenseiter darstellte. Doch seither hat sich der Staatschef zahlreiche Affären geleistet, etwa den Skandal um die steuerliche Protektion für die Milliardärin und Sarkozy-Parteispenderin Liliane Bettencourt. Nun muss er gegen das Bild ankämpfen, er sei der erste Vertreter einer moralisch bankrotten Elite. Hinzu kommt, dass Sarkozy - ähnlich wie Strauss-Kahn - der Ruf vorauseilt, er sei ein Frauenheld.
Die Festnahme Strauss-Kahns "ändert nichts an den Schwierigkeiten, denen sich Sarkozy dabei gegenübersieht, wieder als der Präsident zu erscheinen, der Frankreich zusammenbringt", sagte Politologe Lévy. Gleichzeitig frohlocken die Rechtsradikalen, die schon seit Jahren über die angeblich verdorbenen Politiker aller Parteien schwadronieren. "Es wird sich zeigen, dass Strauss-Kahns Verhalten seit vielen Jahren allen bekannt war und von allen verheimlicht wurde, weil das das System in Frankreich ist," sagte Marine Le Pen.
Rechtradikale Parteichefin liegt in Umfragen vorn
Die Parteichefin des rechtsradikalen Front National liegt in den Umfragen schon seit längerer Zeit gleichauf mit Sarkozy, in manchen Befragungen hat sie ihn gar überholt. Sie brauchte nicht einmal mehr darauf hinzuweisen, dass Sarkozy Strauss-Kahn beim IWF vorgeschlagen hat und bis vor Kurzem beste Beziehungen zu seinem Rivalen unterhielt. Die Rechtsradikalen müssen nicht viel tun, um gleichermaßen Kapital aus dem Fehlverhalten Sarkozys und der totalen Diskreditierung des Mannes, der bis Samstagmittag New Yorker Zeit als Lichtgestalt der Sozialisten galt, zu ziehen.
Die größte Oppositionspartei sieht sich sowohl von den erstarkenden Grünen als auch von den Linksradikalen bedrängt. Sie kann sich allenfalls damit trösten, dass die Affäre noch vor der Kandidatenaufstellung passiert ist. Mitte Juli sollen die Vorwahlen nach US-Vorbild beginnen, in denen Parteibasis und Sympathisanten Sarkozys Herausforderer wählen. Bislang sind fast alle Kandidaten ehemalige Mitglieder sozialistischer Regierungen der Vergangenheit: Ein Karussell von Politikern, unter denen sich seit Jahren Machtkämpfe und Absprachen abwechseln. In ihren Reihen fehlt nun einer: Dominique Strauss-Kahn.