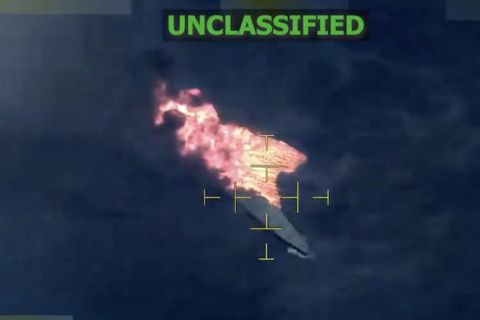Der Präsident wurde regelrecht massakriert. Seine Leiche wies zwölf Einschusslöcher auf, er wurde im Kopf, in der Brust, der Hüfte und den Bauch getroffen. "Wir fanden Jovenel Moïse auf dem Rücken liegend, blaue Hosen, ein weißes Hemd mit Blut verschmiert. Büro und Schlafzimmer wurden durchwühlt", sagte der Richter Carl Henry Destin über die Ermordung des haitianischen Staatsoberhaupts. Moïse starb mitten in der Nacht in seinem Haus in Port-au-Prince. Seine Frau Martine wurde verletzt zur Behandlung nach Miami ausgeflogen.
Streit um Amtszeit des Präsidenten
Das Attentat auf Moïse löste weltweit Bestürzung aus – und dürfte die Krise in dem instabilen Land noch verschärfen. Der 53-jährige Präsident hatte zuletzt per Dekret regiert, nachdem eine für 2018 geplante Parlamentswahl unter anderem wegen Protesten gegen ihn verschoben worden war. Moïse, der sein Amt im Februar 2017 angetreten hatte, hatte stets argumentiert, seine Amtszeit ende regulär im Februar 2022. Aus Sicht seiner politischen Gegner lief das Mandat dagegen bereits im Februar dieses Jahres ab.
Die Ermordung eines Staatschefs ist selbst für die von Dauerkonflikten, Not und Gewalt gepeinigte Region eine Seltenheit. "Haiti ist in den Händen von kriminellen Banden. Auch wenn noch offen ist, wer den Mord angeordnet hat, kommt das Ereignis in einem Land, das sich am Abgrund befindet, leider nicht überraschend", schreibt die französische Zeitung "L'Alsace" über die Geschehnisse in der ehemaligen Kolonie. So bitter wie das Urteil auch klingen mag, so bitter ist fast die gesamte Geschichte des Staats verlaufen.
"Einförmig ist das Leben der Eigentümer auf St. Domingue, dasjenige ihrer Sklaven ist unerträglich, denn kein Haustier wird so sehr mit Arbeit geplagt und so schlecht verpflegt. Manchmal vernachlässigen die Eigentümer entweder aus Geiz oder aus Armut den Unterhalt ihrer Sklaven, und man sieht daher nicht selten Neger und Negerinnen, so beinah nackend, oder mit so ekelhaften Lumpen bedeckt sind, dass ihr Anblick zugleich Abscheu und Mitleid erregt". Mit diesen drastischen Worten beschrieb der französische Forscher Justin Girod-Chantrans 1782 die fürchterlichen Zustände auf den Zuckerrohrplantagen der Karibikinsel, die heute Haiti heißt und sich mit der Dominikanischen Republik die Antilleninsel Hispaniola teilt.
Die koloniale Perle Frankreichs
St. Domingue war für Frankreich das ertragreichste Schmuckstück unter den Kolonien. Doch die gnadenlose Ausbeutung ließ sich nicht mehr lange aufrechterhalten: Neun Jahre nach Girod-Chantrans Besuch rissen sich die Sklaven die Ketten vom Leib und jagten ihre Besitzer fort. Ihr Aufstand hinterließ im fernen Paris so viel Eindruck, dass die dortige Regierung die Sklaverei 1794 untersagte. Wiederum zehn Jahre später löste sich die Insel von Frankreich und wurde der erste unabhängige Staat in der Karibik. Jetzt, im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts zählt Haiti zu den politisch fragilsten und wirtschaftlich ärmsten Ländern der Welt.
Schon der berühmte Sklavenaufstand verlief weniger romantisch, als es eine Rebellion von Unterdrückten gegen ihre Unterdrücker hoffen lässt. Wie bei vielen Revolten mündete der Aufstand augenblicklich in eine Art Bürgerkrieg, in dem nicht nur alle gegeneinander kämpften, sondern auch die Ex-Sklaven untereinander, monarchietreue auf revolutionäre Franzosen schossen, und sich zu allem Überfluss auch noch amerikanische und spanischen Truppen einmischten. Als der ehemalige Sklave Jean-Jacques Dessalines 1804 dann Kaiser von Haiti wurde, waren aus manchen früheren Leibeigenen mittlerweile selbst Sklavenhalter geworden.
Stiftung stern
Die "Ecole Notre Dame de la Médaille Miraculeuse" in Cap Haitien, Nord-Haiti, versorgt Kinder aus den benachbarten Elendsvierteln - und ist dringend auf Unterstützung angewiesen, um weiterhin bedürftige Kinder in Nord-Haiti versorgen und unterrichten zu können. Wir leiten Ihre Spende weiter.
Stiftung stern e.V. - IBAN DE90 2007 0000 0469 9500 01 – Stichwort: "Haiti"; www.stiftungstern.de
Kaiser Jacques I. wurde zwei Jahre später vom Brigadegeneral Henri Christophe ermordet, der danach neun Jahre lang als König Nord-Haiti regierte. Aus diesem Kreislauf von Unruhen, Aufständen, Staatsstreichen, Gewaltherrschaften und anderen Machtkämpfen konnte sich Haiti bis heute nicht befreien. Auch die koloniale Erblast trägt eine Mitschuld an der Instabilität des Landes. Wie später bei anderen in die Freiheit entlassenen Kolonien auch, hat Frankreich von Haiti einen finanziellen "Ausgleich" für die entgangenen, künftigen Gewinne gefordert. Jahrzehntelang musste der junge Staat de facto Lösegeld nach Paris überweisen – nach heutigem Wert rund 20 Milliarden Euro. Geld, das zum Aufbau und Etablierung einer eigenen Staatlichkeit fehlte.
Überhaupt wurde das Land im Laufe seiner Geschichte oft nur als das behandelt, was im Fachjargon "Einflussgebiet" genannt wird. Sprich als Region, über deren Schicksal benachbarte Staaten oder Großmächte bestimmen, aber nicht die Bevölkerung oder die Regierung selbst. So besetzten die USA ab 1915 das Land, unter anderem auch, weil eine kleine deutsche Minderheit sich damals anschickte, ihren Einfluss auf Haiti erheblich auszubauen. Jahrzehnte später kam mit François Duvalier, genannt "Papa Doc", ein ausgewiesener Antiamerikaner an die Macht. Zusammen mit seinem Sohn "Baby Doc" errichtete er eine Familiendiktatur, die in den 80ern durch einen Militärputsch beendet wurde.
Geplündert von Diktatoren und Kleptokraten
Haiti und die Haitianer sind mehrfach gebeutelt. Nicht nur ist das Land Spielball von Großmächten und wird seit fast zwei Jahrhunderten von Diktatoren und anderen Kleptokraten geplündert – es liegt zudem auch noch geologisch ungünstig. Denn unter der Insel Hispaniola reiben sich die karibische und die nordamerikanische Platte aneinander. Folge: regelmäßig schwere und schwerste Erdbeben. Im Januar 2010 etwa starben 300.000 Menschen durch die Erschütterungen der Stärke 7,0. Und als ab das nicht genug wäre, zerstören auch noch Tropenstürme im Jahrestakt die ohnehin bescheidene Infrastruktur des Landes.
"Die meisten meiner Landsleute leben ein ganz normales Leben, essen für ihre Breitengrade übliches Essen und sterben leider allzu gewöhnliche Tode, deren Tragik gerade in der Normalität der Unfälle, Krankheiten und Gewaltverbrechen liegt, die sie verursachen", schrieb der haitianische Historiker Michel-Rolph Trouillot vor einiger Zeit über den Alltag seines Landes. Doch seit Jahren nimmt die Gewalt in vielen Teilen zu, während die Versorgung mit so gut wie allen Gütern schlechter wird. Viele Haitianer sehnen sich deshalb nach einem anderen Leben.
Haitis Nachbar will eine Mauer durch die Insel ziehen
Schätzungsweise 80 Prozent der Menschen mit höherer Bildung zieht es ins Ausland. Ihr erstes, weil nahe liegendes Ziel, ist die Dominikanische Republik. Doch der Nachbar gibt sich überfordert mit den Flüchtlingen aus dem Westen. Um die Migrationsströme zu stoppen, will die Regierung entlang der Grenze einen Zaun errichten – um die Haitianer außen vor zu halten. Diejenigen, die es bis in die USA schaffen, können dort auch nicht auf Milde hoffen. So hat US-Präsident Joe Bidens in seinen ersten 100 Tagen im Amt mehr Menschen nach Haiti abgeschoben als Vorgänger Donald Trump im kompletten letzten Jahr, wie die Hilfsorganisation Invisible Wall berichtet.
Dabei ist es nicht so, als wäre das Haiti von der Welt vergessen worden. Es gibt unzählige Hilfsorganisationen vor Ort, doch ihre Arbeit versickert oft in einem Dickicht aus leeren Versprechen, Zuständigkeitsgewirr und Korruption. Ein häufiges Problem sei, dass der Boden meist "in Besitz von wenigen Familien ist, mit denen es sich die Politiker nicht verscherzen wollen", heißt es in einer GEO-Reportage. "Eine junge Mitarbeiterin von 'Save the Children' erzählte dass die 'schöne, erdbebensichere' Schule, die ihre Organisation für 90.000 Dollar gebaut habe, vom Schuldirektor wieder abgerissen worden sei: Er habe nämlich von einer anderen NGO ein Angebot für eine noch größere Schule bekommen", schreibt Autorin Linda Polmann.
Alle waren wieder weg außer Sean Penn
Als das letzte Großbeben vor elf Jahren die Insel erschütterte, wurde Haiti von Hilfswut geradezu überrannt. An keinem Fleck der Welt gab es plötzlich mehr Helfer pro Einwohner als hier. Unter ihnen war auch US-Schauspieler und Regisseur Sean Penn. Er packte damals ein Flugzeug mit Medikamenten voll, flog nach Port-au-Prince und blieb auch dann noch, als die Pressefotografen schon wieder weitergezogen waren. Bis heute betreut seine J/P Haitian Relief Organization zahlreiche Hilfsprojekte. Über sein Engagement sagte er jüngst: "Alle Interventionen müssen von Einheimischen initiiert oder gutgeheißen werden. Es gibt immer wieder Rückschläge, die innerhalb von Sekunden mehrere Jahre Arbeit zunichtemachen können. Politische Umstände sind häufig ausschlaggebend. Es ist oft ein frustrierendes Spiel. Du tust es trotzdem. Aus Hoffnung."
Quellen: DPA, Invisble Wall, "Vatican News", "FAZ", Earthquake Database, Tagesschau, GEO, Oxford Bibliographies.com, AFP, Justin Girod-Chantrans: Reisen eines Schweizers in verschiedene Kolonien von Amerika während dem letzten Krieg