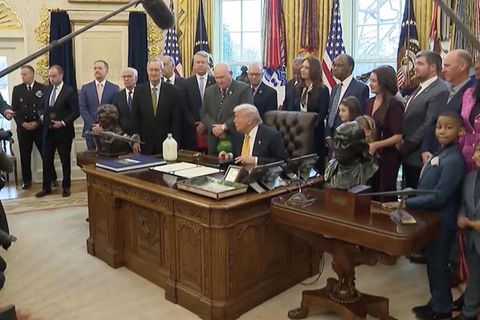Nur wer kämpft, darf mitreden
"Von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen". Ein Satz der, formuliert nach dem Zweiten Weltkrieg, nichts von seiner Gültigkeit verloren hat. Die albtraumhaften Ereignisse der Jahre 1939 bis 1945, ausgelöst durch ein extremistisch-größenwahnsinniges Regime und getragen durch eine ganze Nation, hat vor allem den Deutschen jede Form der Kriegslüsternheit ausgetrieben. Bis heute. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Der Pazifismus europäischen Zuschnitts ist keine weltweite Bewegung geworden. Bis heute nicht.
Und er wird es so schnell auch nicht werden. Dutzende von bewaffneten Konflikten gab es in den vergangenen Jahren. Neben Angriffskriegen und Unabhängigkeitskriegen auch so genannte Verteidigungskriege wie der Feldzug in Afghanistan. Es war ein "guter" Krieg, damals 2001, im Angesicht des Schreckens, den al Kaida mit den Anschlägen auf die USA vor genau acht Jahren verbreitet hatte. Das Land am Hindukusch war nicht nur Brut- und Ausbildungsstätte von radikal-islamistischen Terroristen, sondern auch beherrscht von einem Regime, das als unmenschlich, brutal und rückständig betrachtet wurde. Es fiel nicht wirklich schwer, diese Invasion zu rechtfertigen.
Deutschland war auch Teil dieses Krieges. Und es ist nicht so, dass sie es sich mit Kampfeinsätzen allzu einfach machen würden. Gerhard Schröders Nein zum Irak-Krieg, sicherte dem damaligen Bundeskanzler die Wiederwahl. Und jede Verlängerung oder Ausweitung eines Bundeswehr-Auslandseinsatzes, sei es auf dem Balkan oder Tornado-Aufklärungsflüge über Afghanistan, muss dem Parlament mühsam abgerungen werden. Das ist gut auch so. Ein Land wie Deutschland mit seiner Vergangenheit darf es sich nicht leicht machen mit dem Kriegführen. Aber es sollte auch nicht davor zurückschrecken.
Natürlich ist es wünschenswert für jeden Konflikt eine politische Lösung zu finden. Wünschenswert, aber unrealistisch. Und wenn sich die internationale Gemeinschaft gezwungen sieht, militärisch zu intervenieren, dann sollte Deutschland nicht außen vor bleiben. Dieses Land ist einer der größten Wirtschaftsnationen, es steht auf Platz 13 der bevölkerungsreichsten Länder der Welt, es ist ein Globalplayer, dem zum Glück Großmannssucht und Geltungsdrang in 60 Jahren Frieden und Wohlstand fremd geworden sind. Es ist zudem Nato- und EU-Mitglied und gern und angesehener Makler in der internationalen Politik.
Ein so wichtiger Teil der internationalen Gemeinschaft kann und sollte sich nicht drücken, wenn es Ernst wird. Und die hämischen Kommentare der Alliierten nach dem von einem deutschen Offizier angeordneten Luftangriff in Afghanistan zeigen: Nur wer mitkämpft, bekommt Respekt. Und wer Respekt genießt, darf mitreden. Und wer mitredet, darf mitbestimmen. Das es nicht verkehrt sein muss, wenn Deutschland mitbestimmt, zeigt sich bei der neuen US-Strategie für den Einsatz am Hindukusch: Sie orientiert sich in Teilen an dem, wie die Bundeswehr ursprünglich in Afghanistan gekämpft hat: mit Pflugscharen statt mit Schwertern.
Nur ein propagandistisches Kartenhaus
Seit 1990 wird die Bundeswehr zu "friedenserhaltenden und-sichernden Maßnahmen" im Ausland eingesetzt. Ob Minenräumung im Persischen Golf oder Waffenpräsenz in Somalia, Anti- Piraten-Kampf im Golf von Aden, Einsatz in Ex-Jugoslawien oder Terroristenjagd in Afghanistan: Wo immer militärisches Engagement nachgefragt wird, die Bundesrepublik ist dabei. Als ob es kein nationalsozialistisches Gestern gebe und kein Nachdenken darüber, wie man aktuelle internationale Probleme mit politischen Mitteln lösen kann.
Dass die ebenso sympathische wie naive Forderung, "Frieden schaffen ohne Waffen" (leider) nicht 1:1 umsetzbar ist, wird von den Militärstrategen jeder Couleur gern ins Feld geführt, wenn es darum geht, mal wieder Truppen für die Intervention in irgendeinem Krisenherd zu gewinnen.
Allerdings scheint es auch niemanden in den politischen Bilanzabteilungen der kriegführenden Staaten zu stören, dass die praktischen Ergebnisse der meisten internationalen militärischen Aktionen in den vergangenen Jahren mehr als fragwürdig sind.
Beispiel Kosovo: Nach dem völkerrechtlich umstrittenen Kosovo-Krieg im Jahr 1999 kann von einer Demokratisierung in der Region oder von sozialem Frieden zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen keine Rede sein. Im Gegenteil. Die "humanitäre Intervention", wie der Krieg und die anschließende Beteiligung am KFOR-Einsatz von der - damals rot-grünen - deutschen Bundesregierung genannt wurde, war ein militärisches, demokratisches und menschenrechtliches Desaster. Dessen Folgen teils mafiöse Willkür-Regierungen in wirtschaftlich ohne ausländische Hilfe kaum lebensfähigen Mini-Staaten sind.
Beispiel Afghanistan: Von dem Anspruch, einer "friedenserhaltenden und- sichernden Maßnahme", mit dem der Einsatz begründet wurde, ist nach acht Jahren nicht mehr als ein propagandistisches Kartenhaus geblieben.
Weder ist das multilaterale Verteidigungsbündnis dem Ziel nähergekommen, die Brutstätten des internationalen radikalislamistischen Terrors zu vernichten, noch schafften es die Soldaten, das Land im Inneren zu befrieden. Im Gegenteil: Experten schätzen die Zahl der Terror-Camps allein im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet auf bis zu 1500. In 30 Prozent der Provinzen haben die Taliban inzwischen wieder die absolute Macht übernommen.
Statt dessen ist unübersehbar, dass der Einsatz für die deutschen Soldaten vor Ort mehr und mehr ein Selbst-Verteidigungseinsatz geworden ist, bei dem es nur noch darum geht, die Zahl der eigenen Verluste möglichst gering zu halten. Warum also sollten deutsche Soldaten in Afghanistan bleiben, oder in irgendeinem anderen Winkel der Welt in einem Schützengraben liegen?
Was die Krisenherde dieser Welt brauchen, sind keine Soldaten sondern politische Lösungen, die die traditionellen, kulturellen und religiösen Interessen der Menschen in den betroffenen Ländern ernst nehmen und den vielen in- und ausländischen karitativen, sozialen und wirtschaftlichen Netzwerken eine Chance geben, ihre Aufbauarbeit zu leisten, ohne vom Vorwurf sabotiert zu werden, dass sie nur der "verlängerte Arm" des "westlichen Vormachtstrebens" seien.
Ob die ex-jugoslawischen Mafiabanden, die Islamisten in Afghanistan oder die somalischen Piraten am Ende wirklich mit neuen Brunnen, Schulen, Krankenhäusern und wirtschaftlichem Aufbau zu besiegen sind, wird sich zeigen. Dass sie mit immer mehr Bundeswehrsoldaten nicht besiegt werden können, ist schon bewiesen.