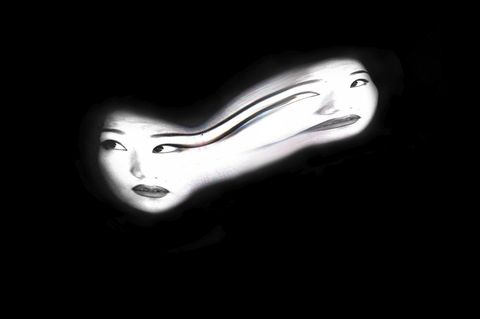Seit Jahren versenkt Südkorea Milliarden, um einen Trend umzukehren, der das Land teuer zu stehen kommen wird. Die Bevölkerung schrumpft, zu wenige Menschen bekommen Kinder. Das wirkt sich auch auf die Wirtschaft und das Rentensystem aus. Die Regierung von Präsident Yoon Suk-Yeol schlägt nun einige kontroverse Maßnahmen vor. Darunter: Männer unter 30 Jahren mit drei oder mehr Kindern von der Wehrpflicht befreien, das Kindergeld im ersten Geburtsjahr erhöhen oder den Mindestlohn für Haushaltshilfen aus dem Ausland abschaffen. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung "Guardian". Kritiker werfen der Regierung "moderne Sklaverei" vor, Aktivistinnen sprechen von Diskriminierung von Frauen.
Südkorea hat mit 0,84 Geburten pro Frau die niedrigste Geburtenrate der Welt. In Deutschland sind es laut statistischem Bundesamt 1,53, im OECD-Durchschnitt (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) waren es 2020 1,59 Geburten pro Frau.
Die Bevölkerung altert und Südkorea geht der Nachwuchs aus
Das Problem besteht seit Jahrzehnten, doch bisher war keine Maßnahme einer Regierung effektiv genug, um das zu ändern. 200 Milliarden US-Dollar wären in den letzten 16 Jahren dafür ausgegeben worden, sagte der Präsident Yoon Suk-Yeol nun bei einem Treffen, doch all diese Maßnahmen hätten "versagt". In den kommenden Monaten wird erwartet, dass die konservative Regierung eine Strategie vorstellen wird. Doch die Maßnahmen treffen vor allem auf Kritik.
Bisher wird die steigende Kinderlosigkeit vor allem mit wirtschaftlichen Faktoren begründet. In Südkorea steigen die Mieten und Immobilienpreise, Bildung kostet zum Teil Geld. Doch das Problem geht tiefer. Aktivistinnen prangern vor allem die gesellschaftliche Stellung von Frauen an und sprechen in einer Stellungnahme von Diskriminierung: "Ohne die grundlegende Ursache der 'geringen Fruchtbarkeit' zu lösen, wird keine Frau plötzlich ein Kind gebären, selbst wenn die Befreiung vom Militärdienst als Vorteil dargestellt wird."
Die Kritik: Männer vom Militärdienst zu befreien würde vor allem Männer bevorzugen. Frauen hingegen übernehmen in Südkorea nach wie vor den Hauptteil der Care-Arbeit, etwa Kindererziehung und Haushalt, sie werden nicht entlasten. Auch die Idee, Haushaltshilfen aus dem Ausland vom Mindestlohn auszuschließen, stößt auf Kritik. Wee Seon-Hee, Sprecherin der oppositionellen Gerechtigkeits-Partei, bezeichnete die Idee in einer Stellungnahme als Rassendiskriminierung und "moderne Sklaverei".
Im OECD-Vergleich ist der Gender Pay Gap in Südkorea am höchsten
Gleichzeitig erschweren die Arbeitsbedingungen es Familien nachhaltig, Zeit für die Familienplanung einzuräumen. Südkorea hat im Vergleich der Industrienationen weltweit mit die längsten Arbeitsstunden. Erst vor zwei Wochen wollte die Regierung die maximale Arbeitszeit von 52 auf 69 Wochenstunden erhöhen, was wegen lautstarker Proteste der jüngeren Generation wieder gekippt wurde.
Doch das Land hat auch besonders schlechte Arbeitsbedingungen für Frauen. Im OECD-Vergleich der Industrienationen ist Südkorea auf dem letzten Platz, was die Lohngleichheit der Geschlechter betrifft. Dort liegt der sogenannte Gender Pay Gap bei 31,1 Prozent. Zum Vergleich: Der OECD-Mittelwert liegt bei zwölf Prozent, Deutschland liegt bei 14,2 Prozent. Das kritisieren auch Aktivistinnen der Goyang Women's Association: "Was wir brauchen, ist nicht die Befreiung vom Militärdienst, sondern eine Gesellschaft, in der die Karriere der Frauen auch nach der Geburt nicht unterbrochen wird."
Aktivistinnen kritisieren eine zu patriarchale Gesellschaft
Dazu kommt, dass die südkoreanische Gesellschaft es alleinerziehenden Elternteilen oder homosexuellen Paaren nahezu unmöglich macht, Kinder zu bekommen oder alleine großzuziehen. Südkorea erkennt bisher auch keine gleichgeschlechtlichen Partnerschaften an. Der Sprecher der Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, hatte 2022 sogar vorgeschlagen, die Geburtenrate zu steigern, indem Homosexualität durch schädigende Maßnahmen wie sogenannte Konversionstherapien "geheilt" werden würde. In Deutschland sind diese Therapien sind 2020 verboten, weil sie nachweislich schädlich sind und zu mehr Diskriminierung führen.
Generell gilt, dass bei einer Geburtenrate von durchschnittlich 2,1 Kindern die Bevölkerung eines Landes nicht schrumpft. Die gesamte Europäischen Union liegt bereits seit den 1970er Jahren unter diesem Wert. Auch andere Industrienationen versuchen, dem Trend entgegenzuwirken. Japan beispielsweise bezahlt frisch gebackenen Eltern Einmalzahlungen in Höhe von rund 2900 Euro, Deutschland versucht es mit einem Ausbau der Kinderbetreuung.
Quellen: Statistisches Bundesamt, "Chosun", Goyang Women's Association, Justice21, OECD, "Guardian", CNN, Bundeszentrale für politische Bildung