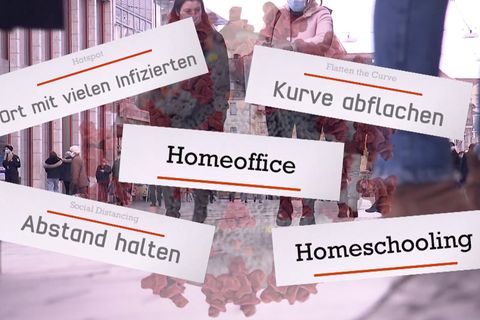Für jeden Unsinn gibt es neuerdings diese kleinen gelben Wörterbücher. Sie heißen "Frau-Deutsch", "Katze-Deutsch" oder "Politik-Deutsch" und stehen im Buchladen in der Ecke für notdürftige Witz-Buch-Geschenke. Tiefenpsychologen wie der geborene West-Berliner Mario Barth erklären darin, was Frauen wirklich wollen, wenn sie nein sagen; Maybrit Illner - früher SED, heute ZDF - erklärt Überzeugungsakrobatik und Sprache der Politik. Im wahren Leben aber reden wahrscheinlich selbst diese beiden ausgewiesenen Unterhaltungskünstler aneinander vorbei. Denn eins fehlt nach wie vor: der Langenscheidt Ost-West-Deutsch.
*
"Weil Sprachen verbinden", so der Verlags-Slogan, kann es nach 20 unverbindlichen Jahren natürlich nicht mehr um Kaufhalle oder Supermarkt gehen, um Kosmonauten, Broiler und diesen ganzen Ampelmännchen-Mist. Auch die verlässlichsten "Stereotypen" (Angeber-Westdeutsch für Vorurteile) vom herzlichen Landsmann hier und dem Wichtigtuer dort sollten weitgehend verinnerlicht sein.
Das Wörterbuch müsste sich vielmehr an die Fortgeschrittenen unter den Missverstehern und Missverstandenen wenden: An die ewigen Aufbauhelfer in Dresden oder Schwerin zum Beispiel, die inzwischen nicht mal mehr "zwischen den Jahren" nach Hause fahren, weil sie gemerkt haben, dass man sie in Baden oder Westfalen selbst "zwischen den Tagen" nie vermisst hat.
Auf der anderen Seite natürlich an die vielen Straßenbahnfahrer und Krankenschwestern in der bayrischen Diaspora, die in ihrer Heimat tatsächlich fehlen. An Fachleute in der Immobilienwirtschaft hier und in der Altenpflege dort. An Journalisten, die immer noch das SED-Wort "Wende" benutzen. An Politiker, Lehrer, aber auch Eltern, deren Kinder Adverbien wie "voll", "übelst" oder "geil" gedankenlos vermischen, als hätte nicht auch der jugendliche Elativ (wer nur ein westdeutsches Abitur hat, schlägt das bitte nach!) zeithistorische Grenzen, die es einzuhalten gilt.
Etliche Seiten bräuchte das Buch allein für Begriffe, die zwar das gleiche meinen, aber Unterschiede vorgaukeln: "FDJ-Funktionäre" etwa, die genauso als "Bundeskanzler" funktionieren. Institutionen wie das "Elternaktiv", die "Cellophantüte" oder die so genannte "Pressefreiheit". Dass auch im "öffentlich-rechtlichen Rundfunk" das richtige Parteibuch zählt, ist für naive Ostdeutsche wie mich immer wieder ein Schock.
Oder nehmen wir "Jugend forscht", im Westen seit 1965 die Nachahmung der "Messe der Meister von Morgen". Den landesweiten Streber-Wettbewerb gab es in der DDR (1958) nicht nur viel eher. Sogar das Signet - schauen Sie sich das das und das mal an - scheint ein Plagiat zu sein. Wenn "Jugend für Olympia trainiert" ist das nichts anders als die bewährte "Kinder- und Jugend-Spartakiade". Nur kümmert sich nicht mehr der "Deutsche Turn- und Sport-Bund" (DTSB) um besondere Talente, sondern - ohne "T" - der "DSB". Das "Turnen" im Namen lässt man weg, damit besorgte Eltern nicht immer gleich an törnende Substanzen denken. Sogar beim offiziellen Staats-Doping gab es feine Unterschiede: "Unterstützende Mittel" hieß es hier; "Leistungssteigernde Wirkstoffe" heißt es im Westen bis heute.
*
Mit der Sprache ist es wie überall: Während sich der vereinigte Westdeutsche gerade mal ein paar neue Potsleitzahlen merken musste, pauken die Menschen in den besetzten Ländern immer noch Vokabeln. Nicht alle sind so einprägsam wie "Mehrwert" statt "Profit". Die gute alte "Bastelstrasse" blähte sich zum "Markt der Möglichkeiten" auf. Selbst scheinbar einfache Wörter wie "Fortschritt" stiften nach wie vor Verwirrung: Im Westen ein lupenreines Synonym für "Wachstum" hatte es in meiner Muttersprache etwas mit dem zu tun, wozu man heute gern die Phrase von der "sozialen Gerechtigkeit" bemüht. Was hierzulande "angeben" heißt, bedeutet dort lediglich "zeigen, was man hat". "Egoisten" nennt man im Westen "Individualisten". Statt "asozial" sagen sie "neoliberal".
Ehemalige Tugenden unserer noch einsprachigen Urgroßeltern wie "Zurückhaltung" oder "Bescheidenheit" kennen sie gar nicht mehr oder übersetzen entsprechendes Verhalten ihrer fremden Landsleute fälschlich mit "verdruckst" oder "Unsicherheit". Insofern wäre "Ostdeutsch-Westdeutsch" auch eine Art Fremdwörterbuch.
*
Echten Nutzwert - etwa für ostdeutsche Hooligans in westdeutschen Kleinstädten oder westdeutsche Studenten an ostdeutschen Unis - brächte das Werk allerdings erst, wenn es nicht nur synonyme Begriffe alphabethisch auflistet, sondern typische Kommunikationsfallen vermeiden hilft.
Im Westen zum Beispiel sitzt man im Gefängnis, wenn man "Knast hat" - hier geht man eine "Roster" essen. Auch scheinbar schlichte Schimpfwörter wie "Wessi" bedeuten oft mehr als nur "Arschloch". Was früher ein "Timur-Trupp" war, kann man nicht automatisch mit "Ein-Euro-Jobbern" in der Park- oder Altenpflege übersetzen. Ein "Ärztehaus" dagegen ist nichts weiter als eine "Poliklinik", die 10 Euro Eintritt verlangt (200 Mark!).
"Patenbrigaden" gibt es auch wieder, allerdings macht das kapitalistische Sozial-Marketing gleich eine "Initiative Schule - Betrieb" daraus, was wiederum seltsam ostdeutsch klingt. Aus "gesellschaftlicher Arbeit" wurde "ehrenamtliche Tätigkeit". Oft sind die neuen Wörter und Wortschöpfungen noch verwirrend, aber wir haben in der Schule eben auch viel marxistischen Quatsch gelernt.
Sklavenhalter gab es bis 1989 nur in Geschichtsbüchern, heute steht "Personaldienstleister" an jeder zweiten Bürotür. Hinter der halbwegs ehrlichen Abkürzung "KIM" (Kombinat Industrielle Mast), das wusste jeder, verbargen sich Geflügelfabriken. Heute steht "Wiesenhof" auf den Viechern in der Tiefkühltruhe, als hätten sie vorher ein sorgenfreies Hartz-IV-Leben geführt wie wir.
"Einmarsch", "Überfall" oder "Invasion", wie das auch im Westen zu sowjetischen Zeiten in Afghanistan noch hieß, fasst man als "kriegsähnlichen Hilfseinsatz" zusammen. Statt in "USP", dem "Unterricht in der sozialistischen Produktion", bereiten sich Schüler und Studenten in so genannten "Praktika" auf weitere Jahre unbezahlter Arbeit nach der Ausbildung vor. Wer dabei im Büro etwas "ablichtet" statt "fotokopiert" muss zudem aufpassen, dass er wegen seiner ethnischer Herkunft keine Nachteile erfährt. Und Obacht: "Bewährung in der Produktion" wird heute gern als "Zielvereinbarung" im "Mitarbeitergespräch" verharmlost.
*
Ewig könnte man das fortsetzen. Und richtig schwierig wird es, wenn vertraute Redwendungen das Gegenteil meinen. Kündigt etwa ein Westdeutscher seine Heimreise an, wünscht man ihm in der Regel von Herzen "gute Reise". Oft sorgt das auf beiden Seiten für ein gewisses Unbehagen. Wie haben die das gemeint? Kommt er vielleicht wieder? Reden wir jetzt schon zwischen den Zeilen aneinander vorbei?
Innerdeutscher Subtext ist immer riskant und fängt schon an, wenn wir nur fragen "wie es so geht". Ostdeutsche möchten dann meistens wissen, wie es ihrem Gegenüber so geht. Auf Westdeutsch dagegen bedeutet die gleiche Frage: "Sag jetzt nichts, ich will von mir erzählen."
Habe ich das fehlende Wörterbuch weiter oben "Westdeutsch-Ostdeutsch" genannt? Da sieht man mal, wie degeneriert wir schon sind. Natürlich muss es "Westdeutsch-Deutsch" lauten. Die wissen ja nicht mal, dass "Schnauze" Schnauze heißt - und nicht: "Schreib einen Kommentar!" Jetzt tippen schon wieder welche. Wir setzen den Kurs bei Gelegenheit fort, übergeben Langenscheidt und sprechen es alle noch einmal nach: Schnauze!