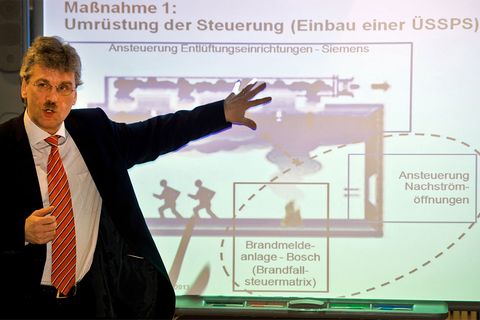Man steht im Büro von Hartmut Mehdorn, im 25. Stock der Bahn-Konzernzentrale, viel Glas und Stahl, lichtdurchflutet auch Mehdorns Büro. Der Bahnchef sitzt an seinem Schreibtisch. Schwarze Bürostühle, ein knallrot bezogener Chefsessel, der Mehdorn durch seine Karriere begleitet hat. Sonst kaum ein Verweis auf Privates, nur der ans Fenster gelehnte Steuerknüppel einer Mig 29 - dass er diesen Kampfjet geflogen hat, darauf ist Mehdorn stolz. Pilot sein - das war sein Kindertraum. Züge, Lokomotiven, dieses langsame Zeugs, interessierten das Kind Hartmut nicht.
Auf Einkaufstour für den globalen Wettbewerb
Der Blick aus Mehdorns Hauptquartier ist unbezahlbar. Mehdorn liegt die Metropole zu Füßen. Er sagt, ohne von seinem Schreibtisch hochzusehen: "Dieser Blick ist sehr praktisch. Wir brauchen keine Bilder und Gemälde an den Wänden." Am Horizont die Plattenbauten von Marzahn, etwas näher das Rote Rathaus, das Brandenburger Tor und der Reichstag, dunkel und wuchtig der Hauptbahnhof, das Kanzleramt wirkt dagegen klein. Konzernzentralen sind nicht nur Orte, sie sind stets auch Ausdruck des Selbstverständnisses der Firmen. Die Bahn, so sieht es aus, hat über die Politik gesiegt. Hartmut Mehdorn federt hinter seinem Schreibtisch hervor, schüttelt dem Besucher die Hand, greift nach der Schulter.
Sagen Sie, Herr Mehdorn, warum kaufen Sie sich in Unternehmen in England, Spanien, China, Amerika ein? Was haben die deutschen Bahnkunden davon, wenn Sie eine Vorortbahn in London erwerben, wenn Sie überall in der Welt unser Steuergeld hinaushauen? "Wir knallen keine Steuergelder raus. Wir verdienen unser Geld mit Fahrkarten, mit Gütertransporten, wir lassen Container auf Schiffe stellen oder lassen sie fliegen. Wir haben einen weltweit offenen Markt, das muss man endlich verstehen und akzeptieren, das müssen Sie verstehen! Wenn wir jetzt nicht in England, Spanien oder anderswo angreifen, dann werden wir hier in Deutschland zurückgedrängt. Dann verlieren wir auch hier." Mehdorn sitzt nun auf der anderen Seite des Tisches, er beugt sich nach vorn, er wippt nach hinten, er redet erst leise, dann wird er lauter, manchmal haut er auf die Tischplatte, manchmal schlägt er mit den Hacken auf den Boden, mal wird der Mund zum Strich. "Wollen Sie, dass es in Deutschland, mehr und mehr, nur noch Franzosen, Polen, Engländer, Holländer oder Russen gibt, die Züge fahren lassen? Ist Ihnen das lieber? Wollen Sie, dass die Chinesen ihre Züge hier herschicken, und dass die Chinesen hier das Geschäft machen? Wollen Sie das? Wir finden: Es ist besser für Deutschland und die Arbeitsplätze, wenn wir unseren Weg gehen. Angriff ist die beste Verteidigung."
"Der Markt ist Wettbewerb"
Kampf. Kampf. Kampf. Ist das so? "Ja. Der Markt ist Wettbewerb. Ich liebe ihn. Entweder Sie gehen nach vorne, Sie kämpfen, Sie gewinnen Umsatz und kontern die Angriffe. Oder Sie bleiben zurück und verlieren. Dann kommen die anderen. Es herrscht im Markt das Gesetz der Gesunden und Starken. Nur die überleben." Mehdorn steckt im Kampfanzug. Er ist einer jener Typen mit kantigem Gesicht, die stolz auf ihre Kanten sind. Er habe sich, sagt er, in seinem Leben kaum geändert. Schon als Kind habe er nie Angst gehabt, sagt er, vor nichts und niemandem. Man denkt, Sportler haben diesen Tunnelblick, sehen rechts nichts, links nichts, so wie Mehdorn, der keine Zweifel kennt. Es gibt kein dialektisches Denken, nur Schwarz oder Weiß, Freund oder Feind, alles oder nichts. Volle Kraft voraus. "Jeder denkt, er weiß, wie die Bahn funktioniert, nur weil er mit ihr fährt und einen Fahrplan gelesen hat. Bei uns meckert man über fünf Minuten Verspätung. Fliegen Sie mal mit dem Flugzeug, fahren Sie mit dem Auto, da wissen Sie, was Verspätung heißt. Ich bin selbstkritisch. Aber ich bin mit mir auch im Reinen, denn ich weiß: Wir haben die beste Bahn in Europa! Und wir werden immer besser, Schritt für Schritt!"
Man denkt: So macht er das also, so verführt er die Politiker, so kriegt er es hin, dass seine Chefs, also der Verkehrsminister, letztlich auch die Kanzlerin, vor ihm kapitulieren, kuschen und sagen: Lasst den Mehdorn machen. Sie lassen ihn Geld ausgeben - und der Staat bezahlt. Lassen ihn einkaufen, eine Spedition wie Schenker, lassen ihn rund um den Globus einkaufen, Transport-, Zug und Frachtflugunternehmen - der Staat bezahlt. Ein Unternehmer mit staatlicher Vollkaskoversicherung. In einer Broschüre der Bahn lässt er sich so beschreiben: "Wahr ist: Die Bahn hat ein Gesicht. Es trägt die Züge eines vitalen Lebens. Eisernen Willen signalisieren schmale Lippen und gewölbte, hohe Stirn, Energie bündelt das Kinn. Die Augen blitzen. Mal kampfbereit, mal voller Lebenslust. Es ist das Gesicht des Hartmut Mehdorn."
Knapp 20 Milliarden Schulden
Eiserner Wille. Energie. Lebenslust. "Nein, den Brocken Eisenbahn tragen keine schmalen Schultern, noch bewegt ihn zierlich eine Pianistenhand. Diesen Konzern regieren nebst dem Verstand auch Kraft und Wille." In der Eloge steht nicht: Die Bahn hat knapp 20 Milliarden Euro Schulden. Dort steht nicht: Knapp 14 Milliarden schießt der Bund jährlich in das Gesamtsystem Schiene. Aber die richtige Frage wird gestellt: "Geht es voran, stimmt die Richtung?" Die Antwort: "Selbstredend." Die Richtung: Die Bahn muss an die Börse, sagt Mehdorn, wie die Telekom und die Post. Und bekäme, anders als Telekom und Post, auch nach dem Börsengang ständig Geld vom Staat - rund zwei Milliarden im Jahr für die Infrastruktur, 4,4 Milliarden für den Nahverkehr.
Wie, verdammt noch mal, schafft es Mehdorn, dass die einflussreichsten Politiker in diesem Land seine Börsenpläne unterstützen? Obwohl sie draufzahlen, ständig, und weiter zahlen werden. Einer, der darauf eine Antwort weiß, residiert in einem Senatsgebäude in Sichtweite von Mehdorns Büroturm: Thilo Sarrazin, Berliner Finanzsenator. Er sagt, Mehdorns Kraft beruhe auf seinem "Vitalitätsüberschuss". Und der träfe auf "ein Intelligenz- und Vitalitätsdefizit der ihn beaufsichtigenden Politikerklasse". Im Übrigen habe Mehdorn nur ein einziges Ziel, und das verleihe ihm Extrakräfte: "In die Weltwirtschaftsgeschichte einzugehen als der Mann, der die Bahn privatisierte und an die Börse brachte."
"Radikaler Vernichtungswille"
So sieht es also Sarrazin. Er war mal bei der Bahn, war mal ein Vertrauter von Mehdorn, und er ist einer der wenigen, der es wagt, mit seinem Namen das Handeln des Bahnchefs infrage zu stellen. "Es gibt so gut wie keinen Abgeordneten des Verkehrsausschusses, der nicht von Mehdorn angepflaumt, angemacht, eingeschüchtert worden ist", sagt der Grünen-MdB Winfried Hermann, auch einer, der offen murrt. Von "Kampfaktionen gegen Mitglieder des Verkehrsausschusses" spricht Horst Friedrich (FDP), eine Ausnahme auch er. Er erzählt, wie die Bahn Erkundigungen über Verkehrspolitiker habe einziehen und Dossiers über Sachverständige habe anlegen lassen: "Das kam uns schon sehr ungewöhnlich vor." Die Bahn: Das sei "kein offizielles und autorisiertes Papier der DB AG".
"Einen radikalen Vernichtungswillen bei allem, was sich ihm entgegenstellt", macht Thilo Sarrazin, der ihn von allen Kritikern am besten kennt, bei Mehdorn aus. Der Volkswirt ist einer der wenigen in Deutschland, der die Bilanzen der Bahn richtig interpretieren kann. Aufrecht, im Maßanzug, sitzt Sarrazin, 63, in seinem penibel aufgeräumten Büro in Berlin-Mitte, seine Welt sind Zahlen, seine Welt sind Bilanzen, er zeigt Grafiken, wirbelt mit Ziffern. Er ist kein einfacher Mann. Er will alles genau wissen, er sagt über sich selbst und im vollen Ernst: "Ich habe das Gefühl, ich weiß es besser."
Erfolgsstory als schiere Propaganda?
Eine Stunde redet er über den Bahnchef, nonstop, nie hebt er seine Stimme. Mehdorn hatte ihn 2000 in den Vorstand der Netz AG berufen. Aber Sarrazin wollte anderes anfangen mit der Bahn, nicht die teuren Hochgeschwindigkeitsstrecken, nicht Mehdorns Versuch, die Bahn zu einer Art Lufthansa umzubauen, Sarazzin wollte eine Deutsche Bahn, nicht einen weltweit agierenden Logistikkonzern, der sich von Bundesmitteln ernährt. Schließlich konnte er das Finanzgebaren seines Chefs nicht mehr akzeptieren. Er ging. Man verlässt das Berliner Senatsgebäude mit dem Gefühl, ein Verrückter ist Herr über die Bahn. Einer, der von niemandem, schon gar nicht von der Politik, kontrolliert wird. Man hat im Ohr Sarrazins Zahlenkolonnen, und die klare Botschaft, kurzgefasst, lautet: Mehdorns Erfolgsstorys sind schiere Propaganda. Weshalb er jetzt sehr rasch an die Börse muss, weil sonst sein Kartenhaus zusammenbricht, weil das Spiel mit den Bilanzen bald ausgereizt ist. Der Macher Mehdorn stünde entzaubert da. Man denkt: Hat Sarazzin recht? Oder wütet er, weil er sich rächen will?
Man kann sich in Berlin mit Abgeordneten aller Parteien treffen, mit Verkehrsexperten, Leuten von der Bahn, und nach ein paar Tagen und vielen Gesprächen fragt man sich verblüfft: Was passiert denn hier? Man trifft Abgeordnete aus der Regierungskoalition, die ihren Namen nicht gedruckt sehen wollen - die Bahn ist ihnen unheimlich. Hat der Bahnchef es vor ein paar Jahren nicht geschafft, dass sein eigener Chef, Verkehrsminister Kurt Bodewig, erst in Ungnade, dann aus dem Amt fiel?
"Holdingmodell" gegen "Volksaktienmodell"
Es geht in diesen Tagen in Berlin um das letzte, richtig große Stück Gemeineigentum im Land. Aber es geht um noch viel mehr. Um die Frage, was für ein Staat dies werden soll, einer mit "Daseinsfürsorge" für seine Bürger? Oder ist das vorbei? Es geht um viele Milliarden, um Millionengewinne. Es ist ein großer Deal. Im Zentrum der Schlacht: Hartmut Mehdorn. Man weiß: Mehdorn und seine Strippenzieher aus der Regierungskoalition, Struck, Steinbrück, Tiefensee, Kauder und ein paar mehr möchten die Bahn privatisieren, sie möglichst schnell an die Börse bringen. Die anderen, die große Mehrheit der Bevölkerung, sind dagegen, auch die Basis der SPD. Wenn schon die Bahn teilprivatisiert werden soll, dann nur auf der Grundlage des "Volksaktienmodells", es soll den Einfluss privater Investoren auf die Geschäftspolitik der Bahn verhindern, so hat es der SPD-Parteitag beschlossen.
Um den Volksaktienbeschluss seiner Partei auszuhebeln, präsentierte Finanzminister Peer Steinbrück Anfang November 2007 das "Holdingmodell". Warum er das getan hat? Dazu sagt er nichts. Stattdessen setzt er zu einem ministeriellen Sonderlob an, das fast wie ein Nachruf klingt: "Nur jemand wie Mehdorn, der auch bereit ist anzuecken, und mit seinem Kopf auch die Wand prüft, war in der Lage, aus der alten, nichts zukunftsfähigen Behördenbahn eines der stärksten Eisenbahnunternehmen der Welt zu schaffen. Dafür gebührt ihm mein ganzer Respekt". Kein Verkehrsexperte, niemand außer den Strippenziehern, weiß bisher offiziell, was Mehdorn, seine Verkehrs- und Finanzminister planen, wie das "Holdingmodell" tatsächlich aussehen wird.
Zum Schweigen vergattert
In den Ministerien sind die Mitarbeiter zum Schweigen vergattert. "Ich reiße jedem die Eier ab, der was rauslässt!" Trotz dieser Drohung eines Abteilungsleiters: Informationen sickern aus dem Verkehrsministerium, "kompliziert und voller juristischer Fallstricke" sei das Ding. Offiziell steht bisher in Sachen Holding nur fest: Das Logistikgeschäft der Bahn, der Personen- und Güterverkehr sollen in einer AG zusammengefasst werden, die schrittweise privatisiert wird. Das Schienennetz und die Bahnhöfe, die Energie blieben zu 100 Prozent in Staatsbesitz.
Auf den ersten Blick ist dieser Entwurf eine krachende Niederlage für Mehdorn. Der hatte jahrelang verbissen dafür gekämpft, dass die Bahn zusammen mit dem Schienennetz an die Börse kommt. Mehdorn aber ist nun überaus zufrieden. Realitätsverlust? Oder kann er seine Niederlage nicht eingestehen? Weil er nur so, abgespeckt zwar, seine Vision des Börsengangs umsetzen kann. Oder ist das nur ein neuer Akt in dem Machtspiel, bei dem er oben bleibt? Weil er als Chef des Doppelkonzerns noch unumschränkter herrschen, sich sogar selbst kontrollieren würde.
Befürchtungen, Bahnkonzern könnte zerschlagen werden
Für den SPD-MdB Hermann Scheer, der das Thema Bahnprivatisierung zu seiner Sache gemacht hat, ist "unfassbar", was da geschieht, er spricht von einem "Fanatismus, der am Werk ist". Und glaubt, dass mit dem Holdingmodell "letztendlich der Bahnkonzern zerschlagen, der Personen und Güterverkehr vollständig an Großinvestoren ausgeliefert wird". Also genau das passiert, was er mit dem von ihm erfundenen "Volksaktienmodell" verhindern wollte. Und noch etwas regt viele Abgeordnete auf: Sie fürchten, dass Mehdorns Truppen das Holdingmodell überfallartig an Bundestag und Bundesrat vorbeimanövrieren.
Der Kampf um die Bahn - es ist ein Kampf mit hohem Symbolgehalt. Ein Shakespeare'sches Drama - mit Opfern und Helden, mit Menschen, die in ihren Rollen gefangen sind. Macbeth muss sich durchsetzen, ein Kämpfer, ein Getriebener, Stillstand wäre sein Untergang. Man steht an einem Februartag vor der Bahnzentrale, dort oben, knapp unterm Himmel von Berlin, ist einer, der jetzt eine gewaltige Schlacht schlägt. Und falls er gewinnt: Was heißt das für die Bürger? Plötzlich fällt einem auf, dass im Gespräch mit Mehdorn etwas Wichtiges fehlte: eben die Bürger. Die Menschen, die seine Fahrkarten kaufen sollen.
Visionen scheiterten an der Realität
Seit 16. Dezember 1999 ist Mehdorn Herr über das Bahnuniversum. Kaum im Amt, zauberte der Bahnnovize Strategiepapiere hervor, etwa: "Die Bahn aus einem Guss", "Schienenverkehrspolitische Vision Deutsche Bahn 2020". Die Experten schüttelten die Köpfe. Die Visionen verschwanden in den Schubladen. Mehdorn versprach, das Ergebnis der Bahn innerhalb von fünf Jahren um 8,4 Milliarden Mark zu verbessern. Die Experten schüttelten wieder die Köpfe. Er versprach, eine Erfolgsgeschichte hinzulegen und einen Börsengang bis 2003. Die Experten schüttelten noch einmal die Köpfe.
Nach einigen Monaten war auch Mehdorn klar, dass das alles nicht so einfach war. Nun änderte er seine Strategie, von Triumphgeheul auf Trauergesang. Er ließ McKinsey kommen, McKinsey kam und fand heraus: Es steht schlecht um die Bahn. Mehdorn malte Untergangsszenarien, verbreitete Panik unter Politikern. Und versprach gleichzeitig Rettung: Die Bahn lässt sich sanieren, glaubt mir, hört auf mich, wenn man sie nur anders finanziert. Und das ist der größte, der geradezu geniale Coup Mehdorns: Verkehrsminister Reinhard Klimmt, er ist heute, nach seinem Ausscheiden aus der Politik, Berater bei der Bahn, gab der Bahn nicht nur zusätzliche Mittel, sondern fast alle Gelder für Investitionen, die von nun an keine Darlehen mehr, sondern "verlorene Zuschüsse", waren im Klartext: Geschenke. Mit dem unbezahlbaren Vorteil, dass man diese Milliardengeschenke in den Bilanzen nicht ausweisen muss.
Ohne Staatsknete nicht lebensfähig
Wirtschaft hat sehr viel mit Psychologie zu tun, eine langsame Sanierung ist langweilig. Um als Held dazustehen, um eine sexy Börsenstory bieten zu können, braucht man spektakulären Erfolg. Und so fuhr nun die Bahn so richtig tief in die Miesen. Mehdorn sagte, das liege an den massiven Investitionen, an den Investitionsoffensiven für die Zukunft. War das so? Fragt man Horst Friedrich, Verkehrsexperte der FDP, hört man dies: Nicht durch Investitionen sei die Bahn in die roten Zahlen gekommen, sondern weil Mehdorn Rückstellungen gebildet habe für spätere spektakuläre Erfolgsbilanzen, die er ja seit 2004 immer wieder vorlegt. Also: um zu blenden. Der Abgeordnete Friedrich spricht ironisch von "Bilanzkosmetik" und wundert sich im Übrigen sehr über Mehdorns Erfolge. "Kein Mensch weiß eigentlich, worin Mehdorns Erfolgsstory bestehen soll. Und trotzdem redet jeder davon. Der Konzern wäre ohne Staatsknete für Netz und Nahverkehr, ohne zugekaufte profitable Logistikgeschäfte keinen Tag lebensfähig." Ein Kaiser, der nackt ist, und keiner wagt es zu sagen? "Ja", sagt Friedrich: "Jeder hat Angst, als dumm dazustehen, wenn er Mehdorn hinterfragt."
Wie macht der Bahnchef das? Hartmut Mehdorn. 1942 als Sohn eines Fabrikanten in Warschau geboren, studiert er im rebellischen Berlin der 1960er Jahre Maschinenbau. Politik und Revolte interessieren ihn nicht, er ist Mitglied einer schlagenden Verbindung, er möchte zur Bundeswehr, Pilot werden. 1965 kommt er zu den Vereinigten Flugtechnischen Werken, 1977 ist er Werksleiter, bald sitzt er im Vorstand der Airbus Industrie in Toulouse, und er will den Dasa-Vorstand Jürgen Schrempp beerben. Doch als der zum Daimler-Chef berufen wird, übergeht man Mehdorn.
Bahn-Schulden unter Mehdorn fast verfünffacht
1995 wechselt er zur Heidelberger Druckmaschinen AG, steigert die Umsätze durch milliardenschwere Zukäufe, bringt das Unternehmen an die Börse. 1999 bietet ihm Kanzler Schröder den Bahnjob an, Mehdorn greift zu, sagt, er sei "happy, endlich mal was fürs Vaterland tun zu können". Als Mehdorn an die Macht kam, plagten die Bahn 4,2 Milliarden Euro Schulden. Ende 2006 sind es über 19 Milliarden. Das Schienennetz ist überaltert - mit absurden Konsequenzen: Auf manchen Strecken fahren die Hochgeschwindigkeitszüge langsamer als vor zehn Jahren. Und: Die Zahl der Reisenden im Fernverkehr ist unter Mehdorn dramatisch gesunken, den Marktanteil am gesamten Personenverkehr konnte Mehdorn seit Amtsantritt nicht steigern, und viel besser sieht es auch im Güterverkehr nicht aus. Eine klägliche Bilanz.
Und doch: Der Mann ist erfolgreich. Er hat, allerdings auf Pump, den Umsatz der Bahn durch gewaltige Zukäufe gesteigert. Und er hat sein Einkommen deutlich gesteigert, um gut 350 Prozent - auf fast 3,2 Millionen Euro. Wie kaum ein anderer Firmenchef in Deutschland hat er Macht auf sich konzentriert. Inzwischen sitzen im Aufsichtsrat der Bahn viele seiner Vertrauten. Freunde und Bekannte, manche aus der Politik, einige aus der Luft-, andere aus der Druckbranche sind im Vorstand, "Mehdorns Messdiener" nennt man sie in der Bahnzentrale.
Politik folgt ihm fast willenlos
Um seinen Einfluss abzusichern, hat sich Mehdorn gut dotierte Berater zugelegt, Ex-Politiker, Landes- und Bundesminister, Oberbürgermeister und Staatsbeamte, ein gutes Dutzend Lobbyisten, die an allen Fronten für ihn arbeiten, politische Bahnbrecher sind. Oder ihm schon als Politiker halfen. Mehdorn ist der erste Bahnchef, dem wahrhaft Außergewöhnliches gelungen ist: Er hat die Politik vereinnahmt, fast alle folgen ihm willenlos. Jetzt kommt die endgültige Machtfrage - sind die Berliner Politiker, die Regierungsparteien, nur Statisten in seinem Spiel? Mehdorn hat die Weichen für den Börsengang gestellt. Schon Anfang Februar, es wurde zufällig bekannt, hat er eine Firma namens DB Mobility Logistics AG ins Handelsregister eintragen lassen - eine Voraussetzung für einen raschen Börsengang. Wie machtklug er vorgeht, zeigt sich in einem Detail: Im Aufsichtsrat sitzt der Chef der Bahngewerkschaft Transnet, Norbert Hansen. Die Botschaft: Diese Gewerkschaft unterstützt Mehdorns Börsenpläne.
Und das ist wichtig, denn Mehdorn weiß: Ihm läuft die Zeit davon. Alle in Berlin wissen: Wenn es in den nächsten Monaten nicht klappt, dann ist es wohl endgültig vorbei mit diesem Coup. Das Zauberwort "Privatisierung" hat viel von seiner Macht verloren. Auf dem SPD-Parteitag haben sich die Genossen, und - quasi per Ehrenwort - Parteichef Beck auf das Modell "Volksaktie" verpflichtet, alles andere müsse neu diskutiert werden - von der Basis, den Gremien, dem Parlament.
Mehdorn zieht die Strippen
Zuletzt sollte es am 3. März zum Showdown kommen. Da tagte der SPD-Parteirat - doch ohne konkretes Ergebnis: Weder setzte sich Mehdorn und seine Minister Steinbrück und Tiefensee mit ihrem "Holdingmodell" durch. Noch das diametral entgegengesetzte Modell der "Volksaktie". Nun bastelt die SPD an einem Kompromissmodell, der beide Varianten miteinander vereinbaren will. Desweilen zieht Mehdorn seine Strippen, und er weiß, was er tut. Fahnen wehen. Flatterbänder der Polizei. Sicherheitskräfte. Ein Spürhund durchsucht sperrige Gegenstände. An einem Klapptisch stehen Arbeiterinnen, sie bieten Kuchen an. Schwarze Wagen der Mercedes-S-Klasse fahren an einem Bahngebäude in Kirchmöser, einem Ortsteil der Stadt Brandenburg, vor. Hier lässt sich an einem sonnigen Februartag studieren, wie das System Mehdorn funktioniert.
Außenminister Frank-Walter Steinmeier möchte den Wahlkreis um Kirchmöser für sich gewinnen. Der Mann möchte auf dem Land bekannt werden, vielleicht sogar Kanzlerkandidat der SPD. Er braucht gute Geschichten - und das Bahntechnik- und Umweltzentrum in Kirchmöser ist einer der wenigen Orte in Brandenburg mit Jobs, die halbwegs sicher sind. Und Mehdorn braucht starke Helfer für den geplanten Börsengang der Bahn. Deshalb ist er hier. Mehdorns Macht. Er umgarnt jene, die wichtig beim Strippenziehen sind, ihnen hilft er, wo es geht. Er hat ein untrügliches Gespür für Macht. So trabt er nun mit Ministerpräsident Matthias Platzeck, Ex-Ministerpräsident Manfred Stolpe und "Frank, der schon im Kanzleramt sehr hilfreich war", durch die Fabrik und lässt sich über Rollkontaktermüdung, Wirbelstromeinrichtungen, automatische Ultraschall-Radsatzprüfungen informieren. Nach dem Rundgang umarmen sich Steinmeier und Mehdorn, zwei Männer, die sich verstehen, und SPD-Chef Beck hat einen Gegenspieler mehr. Mehdorn braust mit seinem Tross zurück nach Berlin. Den verkommenen, vernagelten Bahnhof von Kirchmöser sieht der Bahnchef nicht. Den hat er eh schon 2002 an die Immobilienfirma First Rail Property verkaufen lassen.
Hilfe von Freunden
Vielleicht ist dieser kleine, verfallende Bahnhof ein Menetekel für die Zukunft der Mehdorn-Bahn? Vielleicht ist auch seine Zeit bei der Heidelberger Druckmaschinen AG ein Menetekel? Dort, ähnlich wie heute bei der Bahn, steigerte Mehdorn in einem globalen Einkaufsrausch die Umsätze. Er wollte der Größte werden. Er versprach mehr als 20 Prozent Rendite. Alle waren euphorisiert. Kaum war Mehdorn weg, platzte der schöne Traum, die Mehdorn'schen Visionen fraßen die Erträge auf. Heidelberger Druck kämpfte ums Überleben, trennte sich von Mehdorns Großmannsträumen und steht nun wieder gut da. Vielleicht sollten die Berliner Politiker, denen die Deutsche Bahn am Herzen liegt, mal die Hauptstadt verlassen und nach Heidelberg fahren. Einmal umsteigen, in fünf Stunden und zehn Minuten ist man dort.