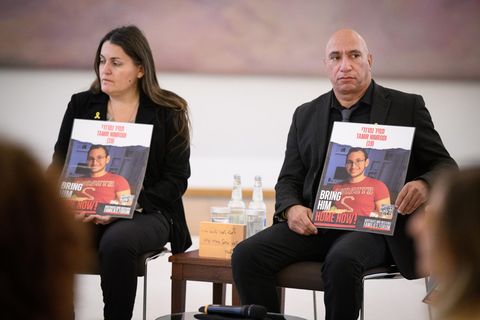Möglicherweise war schon die Ursprungsidee an sich naiv, vielleicht waren es aber auch diverse Kriege, Aufstände, Besatzungen und (Zer)Siedelungen, die dem Zusammenleben im Nahen Osten entgegenstehen. Sicher ist: Seit 76 Jahren ringen Juden und Araber auf dem historischen Gebiet Palästina darum, miteinander auszukommen – bislang gelingt es oft nur mehr schlecht als Recht.
Aus der 1947 von den Vereinten Nationen geplanten Teilung in einen arabischen und einen jüdischen Staat, ist bisher lediglich Israel hervorgegangen – dessen Existenzrecht aber immer noch nicht von manchen Nachbarn anerkannt wird. Etwa von der Hamas, einer Terrororganisation palästinensischer Islamisten, die im Gazastreifen regieren.
Der winzige Landstrich ist zwar weit davon entfernt, ein Staat zu sein, aber de facto das einzige Gebiet, in dem Palästinenser autonom herrschen. Vor dort aus orchestrierte die Hamas am 7. Oktober 2023 das verheerendste Pogrom gegen Juden seit dem Zweiten Weltkrieg.
Wie sah die ursprüngliche Lösung für Palästina aus?
Im November 1947 haben die Vereinten Nation beschlossen, das von Briten verwaltete Gebiet Palästina zu teilen und dort zwei Staaten zu gründen: einen für die dort lebenden Araber und einen für die bereits dort lebenden, sowie die aus Europa und den Nachbarregionen geflüchteten Juden. Ursprünglich war vorgesehen, dass die arabische Bevölkerungsmehrheit im Westjordanland und im Gazastreifen, im Norden des heutigen Israels sowie im Südwesten an der Grenze zu Ägypten leben sollte. Der Rest des Gebiets würde Israel werden. Jerusalem, die heilige Stadt, sollte unter internationale Kontrolle gestellt werden.
Kriege und Besatzung verhindern die friedliche Teilung
Der UN-Plan stieß im arabischen Raum auf Widerstand, aber auch in jüdisch-nationalistischen Kreisen. Unmittelbar nach der Gründung Israels im Mai 1948 wurde das Land von Ägypten, Transjordanien, Syrien, Libanon und dem Irak angegriffen. Den Krieg gewann Israel, das Westjordanland wurde von Transjordanien besetzt, der Gazastreifen geriet unter Kontrolle von Ägypten. Im Sechstagekrieg 20 Jahre später eroberte Israel diese Gebiete plus die Golanhöhen, den Sinai und Ostjerusalem.
Die Eckpunkte einer Zweistaaten-Lösung
1993 begann der langersehnte Friedensprozess zwischen Israel und der PLO als Vertreter der Palästinenser. Vereinbart wurde im Wesentlichen, dass die Palästinenser das Westjordanland und den Gazastreifen künftig selbst verwalten werden. Allerdings mit Einschränkungen. Die in den Gebieten liegenden jüdischen Siedlungen sollten weiterhin von Israel verwaltet werden. Richtig autonom konnten die Araber nicht agieren. Im Westjordanland hat in den vergangenen Jahren die Zahl der jüdischen Siedlungen erheblich zugenommen – Land, das de facto den Palästinensern weggenommen wird.
Das sind die Knackpunkte
Der Friedensprozess kam nach einer Reihe von Anschlägen auf Israelis und zum Teil halbherzig umgesetzter Vereinbarungen im Jahr 2000 zum Erliegen. Aber auch zu Zeiten höchster Kompromissbereitschaft konnten die wesentlichen Streitpunkte nie geklärt werden:
Wo sollen die Grenzen der beiden Staaten verlaufen und was tun mit den jüdischen Siedlungen auf palästinensischem Gebiet?
Welchen Status soll Jerusalem erhalten?
Wohin mit den palästinensischen Flüchtlingen?
Wie bei den vielen Konflikten ist auch im Nahen Osten der genaue Grenzverlauf bei einer Zweistaaten-Lösung umstritten. Die arabische Seite besteht darauf, dass die Situation von vor dem Sechstagekrieg 1967 wiederhergestellt werden müsse. Israels Regierung dagegen genehmigt, vor allem in den letzten Jahren, immer wieder den Bau jüdischer Siedlungen und entsprechender Infrastruktur im Westjordanland und dehnt auf diese Weise sein Einflussgebiet in palästinensischem Gebiet immer weiter aus. Die Siedler selbst sind häufig radikale Zionisten, die auch nicht davor zurückscheuen, die arabischen Nachbarn übel zu drangsalieren. Auch im palästinensisch geprägten Ostjerusalem schafft die israelische Regierung mit ihrer "Betonpolitik" Fakten.
Israel spricht in dem Zusammenhang von seinen Sicherheitsinteressen und verweist auf die Räumung des Gazastreifens 2005. Damals wurden 21 jüdische Siedlungen aufgelöst – doch Frieden brachte der Abzug nicht. Im Gegenteil. Die 2007 an die Macht gekommene Hamas nutzt seitdem jede Gelegenheit, israelisches Gebiet mit Raketen zu beschießen.
Nach dem UN-Plan von 1947 soll Jerusalem weder arabisch noch israelisch sein, sondern als entmilitarisierte Stadt unter Verwaltung der Vereinten Nationen stehen. Beide Seiten aber beanspruchen das Heiligtum dreier Weltreligionen für sich. In zwei Kriegen hat Israel Jerusalem erobert und 1980 zur offiziellen Hauptstadt erklärt. Den gleichen Status verlieh ihr acht Jahre später die PLO, nachdem sie den Staat Palästina ausgerufen hatte. Für den UN-Sicherheitsrat gehört Ost-Jerusalem aber weiterhin zu den Palästinensergebieten. Auch deshalb war der Aufschrei groß, als der damalige US-Präsident Donald Trump 2017 Jerusalem zur alleinigen Hauptstadt Israels erklärte.
"Nakba", die Katastrophe, nennen die Palästinenser die Flucht aus ihrer Heimat, nachdem Israel 1949 den ersten Nahost-Krieg gewonnen hatte. 700.000 Menschen flohen damals in Nachbarstaaten wie den Libanon, Jordanien oder auch in den Gazastreifen. Sie als auch ihre Nachkommen gelten bis heute als Flüchtlinge. Das eigens für sie gegründete Hilfswerk UNRWA kümmert sich mittlerweile um fast sechs Millionen Menschen, die je nach "neuer" Heimat unter teilweise entwürdigenden Umständen leben.
Die entscheidende Frage ist, ob die Flüchtlinge ein Rückkehrrecht haben oder nicht. Israel lehnt es offiziell ab, weil es den "Versöhnungswillen" bei den Rückkehrern vermisst. Daneben dürfte der Regierung die Aussicht nicht gefallen, dass die Bevölkerung im Westjordanland sich dann von jetzt knapp drei Millionen verdreifachen könnte. Die arabische Seite aber pocht auf das Rückkehrrecht, und nicht nur die Palästinenser. Auch Nachbarstaaten wie der Libanon und Ägypten betrachten die Geflüchteten und ihrer Nachkommen eher als Belastung.
Quellen: Bundeszentrale für politische Bildung, "Süddeutsche Zeitung", Deutschlandfunk, ZDF, DPA, AFP