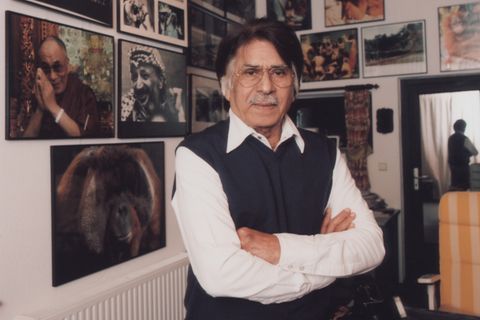»Corriere della Sera«: Das Problem heißt Arafat
Die Mailänder Zeitung »Corriere della Sera« gibt in einem Kommentar vom Donnerstag Palästinenserpräsident Jassir Arafat die Schuld an der Situation in Nahost: »Das größte Problem ist Arafat: Alles deutet darauf hin, dass er nicht länger ein echter politischer Führer ist. Monate lang hat der Präsident der Palästinensergebiete auf Intifada gesetzt, hat die Angebote Baraks und die Anstrengungen Clintons bei den Verhandlungen ausgeschlagen. Er hat Hunderte militanter Islamkämpfer aus den Gefängnissen befreit, und dabei doch zugleich die Gewalt verurteilt und auf Verhandlungen gehofft. Arafat wollte nicht zu weich erscheinen, aber dadurch hat er gerade die Kontrolle über die radikalsten Palästinensergruppen verloren. Heute sieht man, wie sehr seine Taktik fehlgeschlagen ist.«
»The Guardian«: Politische Verantwortungslosigkeit
Die linksliberale britische Zeitung »The Guardian« schreibt am Donnerstag zur Lage im Nahen Osten: »Die «Realität» ist, dass Scharon nicht bereit ist und vielleicht nie bereit sein wird, über die tiefer liegenden Gründe des Konflikts zu sprechen. Im Moment möchte er nicht, dass sich Außenstehende einmischen. Was die UN angeht, ist George W. Bush betrüblicherweise mit den gleichen Vorurteilen behaftet. Zum Nachteil aller schrumpft aus all diesen Gründen die Hoffnung auf Fortschritte. Dies ist kein Weg, auf dem man vorankommen könnte. Dies überlässt die Initiative den Extremisten auf beiden Seiten und macht Unschuldige zu Opfern. Dies schwört das Unheil geradezu herauf - besonders, wenn Scharon meint, ermutigt durch Nachsicht der USA, er könne einige drastische und aufrührerische Vergeltungsaktionen für die jüngsten Angriffe innerhalb Israels anordnen. Dies ist nicht politische Realtität, dies ist grobe politische Verantwortungslosigkeit.«
»Nowyje Iswestija«: Nur Loyalität zum Kreml zählt
Die Moskauer Tageszeitung »Nowyje Iswestija« vergleicht am Donnerstag die von Präsident Wladimir Putin verfügten Personalwechsel im russischen Sicherheitsapparat mit der Politik seines Vorgängers Boris Jelzin: »Putin hat es mit diesen Entscheidungen genauso gemacht wie Jelzin. Bei der Auswahl der Personen für die Schlüsselpositionen im Land hat er sich nicht von ihren professionellen Qualitäten und ihrer Bedeutung für den Staat leiten lassen, sondern einzig von ihrer Loyalität gegenüber dem Kreml-Herren. Und ihrer uneingeschränkten Lenkbarkeit.«
»Der Standard«: Keine Entmilitarisierung in Russland
Durch den neuen russischen Verteidigungsminister Sergej Iwanow werde die Führung dieses Ministeriums keineswegs entmilitarisiert, wie Moskau betont, meint die liberale österreichische Zeitung »Der Standard« am Donnerstag: »Russlands Präsident Wladimir Putin will also das öffentliche Leben des Landes entmilitarisieren. Damit wurde jedenfalls der Wechsel an der Spitze der zwei Schlüsselministerien im Sicherheitsbereich, des Innen- und des Verteidigungsministeriums, begründet. ... Worum es wirklich geht: Iwanow gehört zu jener Gruppe von Geheimdienstlern, aus der auch Putin kommt und die das eigentliche Rückgrat seiner Macht bildet. Sie nennen sich selbst stolz «Tschekisten» (nach der früheren bolschewistischen Geheimpolizei) und sind von einem weitgehend ideologiefreien Ordnungsgedanken getragen, der ein starkes Russland vor allem durch straffe Führung garantiert sieht. Als enger Vertrauter Putins soll Iwanow nun die Reform der demoralisierten, ineffektiven und zu teuren Streitkräfte durchziehen. Die schleichende Entmachtung der Generäle kündigte sich bereits zu Jahresbeginn an, als Putin den Oberbefehl im Tschetschenien-Krieg dem Inlandsgeheimdienst übertrug. Erleichtert wurde sie dadurch, dass die Armeeführung tief zerstritten ist.«
»El Pais«: Zug der Zwietracht in Deutschland
Zu den Protesten gegen die Castor-Transporte in Deutschland schreibt die linksliberale spanische Zeitung »El Pais« (Madrid) am Donnerstag: »Die deutschen Anti-Atom-Aktivisten haben ein weiteres Mal einen großen Publicity-Erfolg gelandet. Sie stoppten den Zug, der 60 Tonnen nuklearer Abfälle aus Frankreich transportierte, wenige Kilometer vor dem Ziel. Der Zug der Zwietracht musste in Deutschland von 20 000 Polizisten geschützt werden. Ein solcher Aufmarsch von Sicherheitskräften dürfte sich kaum beliebig wiederholen lassen. Dabei ist eigentlich geplant, bis 2005 mehrere Castor-Transporte im Jahr vorzunehmen. Bundeskanzler Gerhard Schröder musste lange Zeit politisch manövrieren, um die Grünen überhaupt zu einer Wiederaufnahme dieser Transporte zu bewegen. Der Wirrwarr um den Castor-Zug sorgte dafür, dass die Debatte um die Zukunft der Atomindustrie in Europa wieder einmal die Schlagzeilen dominiert.«