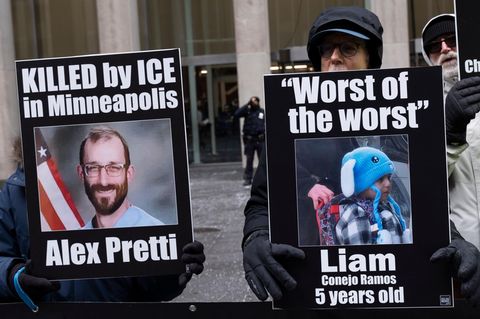Wir sehen die Mädchen fast nicht, weil wir sie nicht hören. Sie bewegen sich lautlos durch die Kirche. Sie huschen vorbei, sie tuscheln nicht, sie senken ihre Köpfe, als seien sie unsichtbar. Sie lachen nicht. Während des Kreuzgangs tragen sie stumm und voller Demut Ikonen.
"Die Welt hält viele Versuchungen bereit", sagt eine Nonne in schwarzem Gewand, die sich Mutter Sophia nennt. "Die Eltern möchte sie davor beschützen." Deshalb haben sie ihre Töchter ins Kloster geschickt. 36 Mädchen leben im Orscher Auferstehungskloster. Die jüngste ist gerade sechs Jahre alt. Einige sind Waisen, sie sind auf Wunsch ihrer Verwandten hier. Manche der Kinder wollen auch nach Abschluss der Schule nicht wieder weg. Vielleicht auch deshalb nicht, weil sie gar kein anderes Leben mehr kennen.
Das Frauenkloster in Orscha liegt wunderschön, hinter dichtem Wald, vor den Toren fließt ein Zufluss der Wolga. Eine kleine Kapelle mit Steg schwimmt darauf, an Feiertagen führt hierher der Kreuzgang.

1. Kirowskij
2. Astrachan
3. Kalmükien
4. Wolgograd
5. Marx, Sorkino
6. Toljatti
7. Dmitrowgrad
8. Innopolis
9. Kasan
10. Nischnij Nowgorod
11. Pljos, Iwanow
12. Twer
13. Orscha (bei Twer)
Die Geschichte des Klosters erzählt nicht von Zerfall, sondern umgekehrt von Aufstieg und Wiedergeburt. Gegründet wurde es bereits im 16. Jahrhundert, Zar Iwan der Schreckliche ließ die Steinkathedrale errichten. Farbfotos aus dem Jahre 1910, aufgenommen von Sergej Prokudin-Gorskij, dem berühmten Fotografen des Zaren, zeigen ein sorgfältig geweißtes Wohnhaus, akkurate Gärten und die runde Kirchkuppel mit goldenen Sternen darauf. Die Sowjets jedoch schlossen das Haus. Sie vertrieben die Nonnen, gliederten das Grundstück einer Kolchose an und lagerten in der Kirche Getreide. Als die ersten Nonnen Anfang der 90-er Jahre in die alten Gemäuer zogen, mussten sie im Winter in ein anderes Wohnheim auswandern, so kalt und feucht war das alte Kloster. Das ganze Anwesen sah aus wie eine Ruine.
Heute strahlen die Mauern wieder in sauberem Weiß, im Garten wachsen Apfelbäume. Zwei neue Wohnhäuser entstanden. Darin sind auch Werkstätten, Ateliers, ein Speisesaal für die Pilger, ein Sportraum für die Mädchen. Die Ikonenwand im Altarraum glänzt golden. Prunkstück ist die Fjodorow-Ikone der Gottesmutter: Ein ganzes Buch erzählt von den Düften und Lichtspielen, vor allem aber von den Wundern, die diese Ikone schuf. Frauen, die kinderlos waren, gebaren, kranke Babys wurden gesund, Ärzte und Ultraschall irrten. Denn erwartete Geburtskomplikationen blieben nach Gebet vor der Ikone aus. "Sehr viele Pilger", sagt Mutter Sophia, "besuchen uns nur deshalb".

Orthodoxie feiert in Russland Renaissance
Seit dem Ende der Sowjetunion erlebt die Orthodoxie eine furiose Renaissance. Im Kommunismus wurde sie nur geduldet, die Menschen im Land blieben dennoch mehrheitlich christlich. Heute agiert die Kirche nicht mehr versteckt: Zwei Drittel aller Russen bekennen sich zum orthodoxen Glauben. Die Orthodoxie steht treu an der Seite Wladimir Putins. Beide profitieren von der neuen Liaison: Den Gläubigen stehen im Land mehr als 33.000 Gotteshäuser offen, allein zwischen 2008 und 2010 gab der Kreml 6 Milliarden Rubel, umgerechnet fast 80 Millionen Euro, für den Bau von Kirchen aus. Der Patriarch verfügt außerdem wieder über Einfluss. Der Kreml nutzt den theologischen Überbau für die Abgrenzung gegenüber dem Westen. Bereits im Jahre 2000 verkündete Patriarch Kirill, die "liberale Doktrin" beinhalte die "Idee derEntfesselung des sündigen Individuums". Nichts verkörpert den erzkonservativen Geist der Orthodoxie so sehr wie die Klöster, denn Demut und Unterordnung werden hier nicht nur gepredigt, sie sind Teil des Lebens.
Den Nonnen in Orscha erscheint das Kloster wie eine Insel des Glücks in einem Ozean voller Bedrohungen: Reden sie vom alten Leben, sagen sie: "Als ich noch in der Welt war." Sicher erscheint ihnen das Leben hier, es ist streng geregelt und lässt keinen Platz für Zweifel. Mehrere Stunden am Tag beten die Schwestern. Erlaubt ist außerdem: Arbeit. Einige Schwestern restaurieren in der Werkstatt alte Ikonen. Misstrauisch empfangen sie Besucher, denn Einblicke in ihre Welt erlauben sie nicht gerne. Im Klosterhof eilen sie wortlos vorbei, mit dem Selbstbewusstsein derer, die glauben, den Weg zu kennen, während alle anderen noch verwirrt herumirren, dem Teufel dienen, in falschen Kirchen beten. Wer der strengen Regeln der mehrstündigen Liturgie nicht mächtig ist, erntet im Gottesdienst schnell mahnende Blicke. Alle Entscheidungen trifft die Oberin. "Sie handelt mit der Liebe einer Mutter", sagt Mutter Sophia, die Nonne.

Mutter Sophia war früher einmal Architektin und hieß Jekaterina. Die Welt erschien ihr kompliziert und ohne Sinn. Sie nahm nicht einmal einen Koffer mit, als sie vor 17 Jahren nach Orscha zog. Sie verlässt das Kloster nie. "Ich wüsste nicht, was ich draußen tun sollte", sagt sie.
Auch die Kinder sind immer im Kloster, selbst in den Ferien. Die Nonnen unterrichten sie in winzigen Klassen im Wohngebäude. Sie spielen Klavier, singen und besuchen die Gottesdienste. Sie erledigen wortlos Tischdienste und helfen in der Küche. Sie tragen lange Röcke und Kopftücher. Sie malen Ornamente auf den Ikonen. Sie dürfen nicht ins Dorf. Sie toben nicht draußen herum. Im Klassenzimmer hängt ein Plakat, auf dem zu sehen ist, wie die Mädchen zu sitzen haben: Gerade. Und die Unterarme liegen auf dem Pult.
Manchmal kommen die Eltern zu Besuch und dürfen im Kloster übernachten. Die Kinder sind nie alleine, selbst nachts schläft eine Nonne in jedem Schlafzimmer. Am Abend, kurz vor dem Schlafengehen, stellen sie sich der Größe nach vor der Zimmertür auf. Über den Betten hängen Ikonen. "Wir haben hier alles, was wir brauchen, sogar noch mehr", sagt Mutter Sophia. "Es ist das Paradies!"
Lesen Sie hier alle 13 Teile unserer Russland-Reportage.