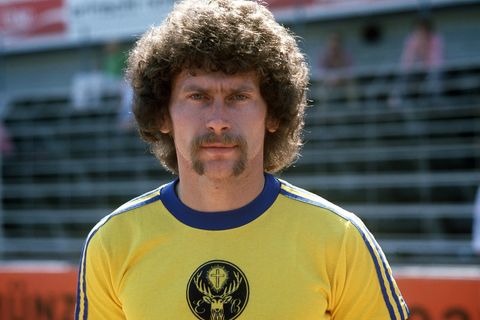Keiner kann Gerhard Schröder vorwerfen, dass das Hauptquartier seines neuen Arbeitgebers übermäßig pompös ist. Hinter einer Tankstelle geht es rechts, dann vorbei am "Beauty-Point". Im Treppenhaus stehen ein runder Tisch und zwei abgewetzte Stühle. Auf die schmutzig weiße Fassade vor dem hauseigenen Parkplatz hat jemand das Graffiti eines Haschisch-rauchenden Punks gesprüht, mit Sprechblase: "This shit is good!"
Das Haus Untermüli 6
im Schweizer Städtchen Zug ist keine prestigeträchtige Adresse. Hier ist der Sitz der North-European Gas Pipeline Company (NEGP), die quer durch die Ostsee eine 1200 Kilometer lange Gasröhre zwischen dem russischen Wyborg und dem vorpommerschen Greifswald verlegen will. Womöglich noch im Februar soll Altkanzler Gerhard Schröder zum Vorsitzenden des NEGP-Aktionärsausschusses gewählt werden.
Das bereitet ihm inzwischen Kopfzerbrechen. Denn NEGP gehört zu 49 Prozent den deutschen Konzernen BASF und Eon - und zu 51 Prozent der russischen Staatsfirma Gasprom. Die machte allein in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 6,6 Milliarden Euro Gewinn, ist an 171 Tochtergesellschaften beteiligt - und gilt als schwarze Kasse des Kreml, der von Schröders Freund Wladimir Putin geführt wird. Unter anderem kontrolliert der Konzern Russlands größten privaten TV-Sender NTW, der von 117 Millionen Menschen empfangen werden kann. Der "Sunday Telegraph" nannte Gasprom die "gruseligste Firma der Welt".
Gasprom heuerte den Ex-Kanzler Anfang Dezember an und hoffte auf Beifall im Westen. Es kam anders: Die Personalie verbesserte nicht den Ruf der Kreml-Firma, sie lädierte den von Schröder.
Nur wenige Wochen nach seinem Abschied vom Amt hatte der Polit-Pensionär das Angebot angenommen. Weil er das Pipeline-Projekt, von dem er profitieren soll, selbst mit eingefädelt hatte, witterte FDP-Generalsekretär Dirk Niebel einen "Hauch von Korruption". Die sonst so verträglichen Grünen fanden, dass sein neuer Job bei der Kreml-Firma "stinkt". Selbst in der SPD gab es außer Vizekanzler Franz Müntefering kaum jemanden, der Schröder vernehmbar zur Hilfe eilte. Mit einem Machtwort im Parteipräsidium sorgte der Vorsitzende Matthias Platzeck dafür, dass wenigstens öffentlich keiner mehr den Genossen Schröder kritisiert.
Anfragen zu dem Gasprom-Job beantwortet Schröders Büro im Bundestag nicht. Der Altkanzler hat einen Fehler gemacht. Aber kann er jetzt wieder zurück? Ohne das Gesicht zu verlieren? Schröder sitzt in der Putinschen Freundschaftsfalle.
Am Dienstag vorvergangener Woche ließ sich der einstige SPD-Chef bei seinem anderen Schweizer Arbeitgeber blicken - dem Zürcher Ringier-Verlag, für den der Sozialdemokrat Geschäfte anbahnen soll, wenn möglich auch in Russland. Von Besuchen bei NEGP im nur 40 Kilometer entfernten Zug ist bisher nichts bekannt. Das liegt sicher auch daran, dass die Pipeline-Firma dort keine eigenen Büros hat. Im Haus Untermüli 6 residiert stattdessen der Wirtschaftsanwalt Urs Hausheer. Er ist der Verwaltungsrat der NEGP und hat schon im Dezember öffentlich gezweifelt, "ob Gerhard Schröder nach dem ganzen Trubel tatsächlich den Vorsitz übernimmt".
Inzwischen ist der 55-jährige Hausheer etwas zugeknöpfter, erst recht, wenn man ihn nach seinen sonstigen Geschäften befragt. Die sind ziemlich ausgedehnt. Allein auf seinem Briefkasten am Zuger Bürohaus finden sich 20 Firmennamen. Bei insgesamt rund 40 Unternehmen fungiert der Schweizer als lokaler Statthalter. Sie tragen fantasievolle Namen wie Cherub AG, Interbalco AG oder Dioki Holding AG; viele sind im Ölbusiness und Rohstoffhandel tätig, einige davon mit Russland-Connection.
Dass Schröders Nominierung so viel Aufsehen machte, "stört" Hausheer. Für ihn ist Diskretion die Geschäftsbasis. Die wahren Eigentümer seiner Briefkastenunternehmen verbergen sich häufig hinter nichtssagenden Firmennamen sowie einer weiteren Briefkastenadresse in Liechtenstein, Luxemburg oder auf den Britischen Jungferninseln.
Von April 1987 bis Dezember 1990 saß Hausheer im Management einer Zuger Firma namens Asada AG. Sie wurde noch 1989 von der Stasi für ihre Hilfe bei der Beschaffung westlicher High-Tech-Waren gepriesen: "Für die Geschäftsleitung der Fa. Asada/Schweiz" bildeten die westlichen Exportbeschränkungen "kein Hindernis für die Zusammenarbeit mit der DDR", hieß es in einem Vermerk des Ministeriums für Staatssicherheit, den die "Neue Zürcher Zeitung" zitierte. Hausheer versichert, dass Asada unter ihm "keinerlei Handelsaktivitäten mit der ehemaligen DDR durchgeführt" hat.
Ebenfalls eine DDR-Vergangenheit hat Matthias Warnig, der als Direktor bei der Pipeline-Gesellschaft NEGP im Gespräch ist: Der heutige Moskau-Vertreter der Dresdner Bank war vor der Wende haupt-amtlicher Stasi-Major.
Auf 1,8 Milliarden Euro werden die Durchleitungsgebühren geschätzt, die NEGP pro Jahr kassieren können wird. Zumindest einen Teil dieser Einnahmen wird die Firma nur der Zuger Steuer von durchschnittlich 14 Prozent unterwerfen müssen - der niedrigsten Unternehmenssteuer in Europa. In Deutschland wären mindestens 34 Prozent fällig. Wegen Steuerzahlern, die in solche Paradiese abwanderten, müssten in Deutschland die Renten gekürzt werden - das war jedenfalls früher die Meinung von Schröders Finanzminister Hans Eichel.
Der BASF-Vorständler John Feldmann erklärt die Wahl von Zug hingegen damit, dass man sich in keinem der Länder niederlassen wollte, "die durch das Projekt berührt sind". Die Schweiz habe sich da mit ihrem "international anerkannten Rechtssystem" angeboten.
Das Schweizer Rechtssystem
hat bereits eine zweite Gasprom-Tochtergesellschaft angelockt. Sie heißt Rosukrenergo AG - und hat ihren Sitz ebenfalls in Zug. Sie geriet in die Schlagzeilen, nachdem Gasprom im Dezember 2005 die Gaszufuhr in die Ukraine gedrosselt hatte, um höhere Preise durchzusetzen. Künftige Lieferungen dorthin, so entschied Gasprom, sollten über die Bücher von Rosukrenergo abgewickelt werden. Im vergangenen Jahr machte die Aktiengesellschaft bei zwei Milliarden Euro Umsatz 420 Millionen Gewinn - vor allem mit turkmenischem Gas an die Ukraine, im Namen der Gasprom. Nicht vollständig bekannt ist, wer von diesen hohen Einnahmen profitiert. Die Hälfte der Aktien gehört Gasprom, die andere wird treuhänderisch von der Raiffeisenbank in Österreich gehalten - nach Angaben der Bank für ungenannte internationale "Investoren mit Erdgas-Know-how".
Olexander Turchinow, der Chef des ukrainischen Geheimdienstes SBU, sagte im Juli 2005 der "Financial Times", es gebe "mehrere Hinweise", dass diese Investoren mit dem berüchtigten russisch-ukrainischen Geschäftsmann Semjon Mogiljewitsch verbunden sein könnten. Doch dies blieb Spekulation. Ermittlungen haben die Ukrainer inzwischen eingestellt.
Mogiljewitsch ist in den USA wegen eines angeblichen Betrugsfalls angeklagt, bei dem Anleger mehr als 150 Millionen Dollar verloren haben sollen - was Mogiljewitsch bestreitet. Das FBI führt ihn bis heute als möglicherweise "bewaffnet" auf seiner Wanted-Liste. Die Raiffeisenbank versichert, er habe nichts mit den Rosukrenergo-Eigentümern zu tun. Deren Namen werde man bald offenlegen, verspricht die Bank.
Einige schreckten solche Gerüchte trotzdem ab. "Aus Imagegründen" legte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG bereits im Herbst ihr Mandat bei Rosukre-nergo nieder. "Die politische Situation in der Ukraine und verschiedene in der internationalen Presse erhobene Vorwürfe beinhalten das Risiko einer Rufschädigung für unsere Unternehmung", hieß es in einem vertraulichen Brief an Rosukrenergo-Verwal-tungsrat Lars Haussmann vom 17. Oktober 2005.
Die Nominierung Schröders soll dazu beitragen, solche Ängste gegenüber Gasprom künftig zu mindern. Gasprom hat eine klare Strategie: Nicht mehr nur Gaslieferant sein, sondern näher ran an die Kunden im Westen, zum Beispiel mit Beteiligungen an deutschen Stadtwerken. Das brächte der Gesellschaft höhere Gewinnspannen, schätzt Wolfram Schrettl, ein Osteuropa-Experte an der Freien Universität Berlin. Die Internationale Energieagentur bezweifelt allerdings, dass diese Strategie "im Interesse der Energiesicherheit in Europa ist".
Von den westlichen Schockreaktionen auf den Streit mit der Ukraine aufgeschreckt, hat Gasprom eine PR-Offensive gestartet. Vorstandschef Alexej Miller besuchte eilig Wirtschaftsminister Michael Glos und versicherte, die Gasversorgung sei sicher. Ein hiesiger Geschäftspartner von Miller sagt, der sei fest überzeugt gewesen, ganz Deutschland werde über Schröders Nominierung jubeln. Doch die Topleute von Eon und BASF erfuhren von Schröders neuem Job erst eine Stunde vor der öffentlichen Ankündigung und waren perplex.
Kann Schröder nun helfen, um von deutscher Seite Einfluss auf Gasprom und den Kreml zu nehmen, wie sein Genosse Müntefering behauptet? Im Streit zwischen Gasprom und Ukraine versuchte Schröder offenbar, hinter den Kulissen zu vermitteln - angeblich bis hin zu Anrufen beim damaligen polnischen Präsidenten Alexander Kwasniewski.
"Aber das war ein bisschen zu spät", sagt der Osteuropa-Experte Schrettl. Im Moment, sagt Schrettl, könne man Schröder nicht raten, sich lautstark für seinen neuen Arbeitgeber in die Bresche zu werfen. "Das wäre nur eine Einladung für die Medien, ihm noch eine überzubraten."
Shit happens - würde der Punk sagen.
Hans-Martin Tillack
Mitarbeit: Andreas Albes, Andreas Hoidn-Borchers, Rolf-Herbert Peters, Hans Peter Schütz