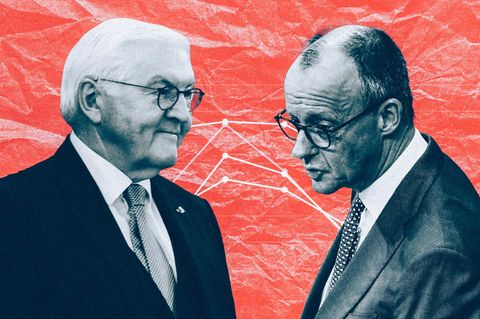Es war der Kampf einer ganzen Generation. Er begann vor bald 30 Jahren am Bauzaun des Kernkraftwerks im südbadischen Wyhl, er ging weiter vor Verwaltungsgerichten und Wahlurnen, er endete vor vier Jahren im Atomkonsens zwischen Bundesregierung und Energiewirtschaft: Kein neues Kernkraftwerk darf in Deutschland mehr gebaut werden, die Laufzeit der bestehenden wird begrenzt. Das letzte KKW soll 2021 vom Netz gehen. Der Kampf gegen Kernkraft und "Atomstaat" war der Gründungmythos der grünen Bewegung, der Ausstieg aus der Nuklearwirtschaft, ordentlich in einem Bundesgesetz geregelt, der historische Sieg des rot-grünen Projekts. Dachte man jedenfalls.
Doch der Kampf ist nicht vorbei. "In der Politik ist nichts unumkehrbar", sagt Klaus Rauscher, Vorstandschef des Energiekonzerns Vattenfall Europa. Will sagen: Das Atomgesetz, das den Ausstieg regelt, kann auch wieder geändert werden. "Jede neue Generation ist selbstbewusst genug, sich nicht vorschreiben zu lassen, auf welche Energieträger sie zu setzen hat und auf welche nicht", sagt Walter Hohlefelder, Chef des Deutschen Atomforums und Vorstand bei Eon. Soll heißen: Sind die in Anti-AKW-Zeiten sozialisierten Politiker der jetzigen Bundesregierung erst einmal abserviert, sind neue Kernkraftwerke nur eine Frage der Zeit. Ralf Güldner, der Deutschlandchef des weltgrößten Reaktorbauers Framatome ANP, hat das Neugeschäft in Deutschland fest im Blick: "Fünf bis sechs neue KKW bis 2020 wäre sicherlich keine unsinnige Zahl."
Frankreich will 59 ältere Reaktoren durch neue ersetzen
Jenseits der Grenzen wird ohnehin geplant und gebaut. Frankreich hat angekündigt, seine 59 älteren Reaktoren durch neue zu ersetzen. In Finnland entsteht ein Europäischer Druckwasserreaktor (EPR), Südafrika will einen so genannten Kugelhaufen- oder Hochtemperaturreaktor (HTR) errichten, in Süd- und Ostasien sind derzeit 20 Meiler im Bau und weitere 40 in der Planung. In den Vereinigten Staaten wurde seit dem Unglück auf Three Mile Island vor 25 Jahren kein neues KKW mehr gebaut - doch nun will ein Energiekonsortium wieder eine Baulizenz beantragen. In den Labors von Kernforschern und Kraftwerksbauern in aller Welt wird an Generatoren neuen Typs gefeilt.
Rekordpreise für Öl und Benzin haben in den vergangenen Wochen das gern verdrängte Energieproblem zurück ins öffentliche Bewusstsein gezwungen. Das Massaker im saudischen Ölzentrum Chobar zeigte den Industrienationen zudem, wie angreifbar die Versorgung mit ihrem wichtigsten Rohstoff ist. Und der Ölpreis gibt das Niveau für die Kosten der anderen Energieträger vor: Steigt er, wird auch Gas teurer, was wiederum die Stromrechnungen nach oben treibt. Die deutschen Haushalte geben so viel für Energie aus wie nie zuvor. Vor allem aber sind die Zukunftsaussichten ungewiss. Auf einer Weltkonferenz über regenerative Energien, die vorige Woche in Bonn stattfand, haben zwar 150 Staaten gelobt, fortan mehr auf Sonne, Wind und Wasserkraft zu setzen. Aber reicht das? Nach einer Forsa-Umfrage für den stern rechnen 53 Prozent der Deutschen damit, dass es zu Engpässen bei der Energieversorgung kommen könnte. Schier unersättlich scheint der Energiehunger der Menschheit. Allein seit 1960 hat sich der weltweite Energieverbrauch nahezu verdreifacht. Bis 2030 wird er nach sich ähnelnden Berechnungen der Internationalen Energieagentur (IEA) und der zuständigen EU- und US-Behörden um weitere 70 Prozent wachsen. Der Ölgigant Shell wagt in einer Studie einen Blick bis ins Jahr 2050. Danach dürfte sich der globale Energiebedarf bis dahin verdoppelt oder sogar verdreifacht haben, je nach gewähltem Szenario.
Schuld ist das Wachstum
Schuld ist das Wachstum - der Weltbevölkerung und ihrer Wirtschaft. Das Problem sind dabei nicht allein die entwickelten Industriegesellschaften. Zwar verbrauchen heute allein die USA fast ein Viertel der weltweit eingesetzten Energie, zugleich aber ist in vielen dieser Staaten die Energieeffizienz enorm gestiegen: Die Deutschen erwirtschaften mit einer Tonne Rohöl ein doppelt so hohes Sozialprodukt wie vor 30 Jahren. Und der Energieeinsatz muss sich nicht proportional zum Wohlstand verhalten: Die Staaten Westeuropas verbrauchen pro Kopf der Bevölkerung weniger Energie als die viel ärmeren Länder der einstigen Sowjetunion.
In den Entwicklungs- und Schwellenländern wächst der Energiehunger oft sehr viel schneller als die Wirtschaft. Chinas Bruttoinlandsprodukt legte im ersten Quartal dieses Jahres um gewaltige 9,8 Prozent zu - doch der Ölverbrauch des Riesenreichs stieg in derselben Zeit um fast 18 Prozent. Ein Grund ist der enorme Energiebedarf, der entsteht, wenn einstige Bauernländer Stahlwerke, Straßen, Autofabriken errichten. Ein anderer sind die Menschen in diesen Ländern, die nach ähnlichem Wohlstand wie dem in den saturierten Gesellschaften des Westens streben: nach Heizungen und Autos und elektrischem Licht. Derzeit leben zwei Milliarden Menschen ohne Elektrizität, vier Milliarden ohne Auto.
Und noch immer stammen mehr als 80 Prozent der weltweit produzierten Energie aus fossilen Quellen: aus Öl, Gas und Kohle. Ihre Reserven schrumpfen, ihre Erschließung wird immer aufwendiger und teurer, ihre Nutzung schädigt das Weltklima und bedroht so die Lebensgrundlagen auf der Erde. Schon so, wie es jetzt ist, dürfte es nicht weitergehen - stattdessen wird es immer schlimmer.
Bei der Atomkraft wird kein Kohlendioxid freigesetzt
In der Krise wittern die Atomkraftfreunde ihre Chance. Denn die Kernspaltung mag gefährlich und schwer durchschaubar sein, einen Vorteil hat sie: Bei ihr wird kein Kohlendioxid freigesetzt. Also nichts von dem schädlichen Gas, das die Atmosphäre aufheizt, das Klima womöglich kippen lässt - und dessen zügige Reduktion die Bundesregierung im Klimaprotokoll von Kyoto international zugesagt hat. Schon heute helfen die umstrittenen Atomreaktoren der EU, jährlich 830 Millionen Tonnen CO2 zu vermeiden - das entspricht den Emissionen des gesamten europäischen Autoverkehrs.
Nicht nur hartleibige Lobbyisten preisen die Kernenergie. "Atomenergie ist die einzige grüne Lösung", sagt der britische Professor James Lovelock, denn nur sie könne die Erderwärmung aufhalten. Lovelock ist 84 Jahre alt; ein prominenter Klimaforscher und Altmeister der britischen Ökologiebewegung. Auch Experten wie Fritz Vahrenholt - einst Umweltsenator in Hamburg, dann Vorstandsmitglied bei Shell und heute Chef der Windkraftfirma Repower - raten, die Restlaufzeit der deutschen Kernkraftwerke über die im Atomkonsens vereinbarten Termine hinaus zu verlängern. So ließe sich Zeit gewinnen - und die sei bitter nötig.
Denn nach bisheriger Planung müssen bis zum Jahr 2020 zwei Drittel der deutschen Kraftwerkskapazitäten ersetzt werden - nur womit, das weiß heute niemand so recht zu sagen. Derzeit feilen Unternehmen wie Siemens und der dänische Energieversorger Elsam an Konzepten für neue Kohlekraftwerke, die völlig emissionsfrei arbeiten sollen: Das Klimagift soll aufgefangen und in leer gepumpten unterirdischen Lagerstätten von Öl oder Erdgas deponiert werden. Das Dumme ist nur: Die verheißungsvolle Technik dürfte frühestens in 15 Jahren serienreif sein.
Die Konzepte der Kernkraftwerksbauer klingen verführerisch
Auch die Kernkraftwerksbauer locken mit frischen Konzepten. Sie klingen so verführerisch wie die Versprechen, die die ersten Erbauer machten, damals vor rund 50 Jahren, als die Kernkraft die Lösung fast aller Energieprobleme verhieß: Sauber sollen die neuen Meiler sein, hoch effizient und sicher, und irgendwann sollen Generatoren der vierten Generation sogar einen großen Teil ihres eigenen radioaktiven Mülls verwerten. Aber auch die famosen neuen Kernkraftwerke sind noch längst nicht fertig. Baureif ist allein der EPR, der nun in Finnland entsteht. Doch er ist, knapp gesagt, letztlich ein konventioneller Leichtwasserreaktor mit sehr, sehr dicken Wänden. "Es bleibt das Risiko von Dampfexplosionen, wenn im Fall einer Kernschmelze das heiße Metall auf Wasser trifft", sagt Christian Küppers vom Darmstädter Öko-Institut.
"Wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera, und es gibt keinen Ausweg", fürchtet der Risikoforscher Ortwin Renn von der Universität Stuttgart. Die Pest, das ist die Erwärmung des Klimas. Die Cholera das atomare Restrisiko.
Eigentlich ein Horrorszenario für jeden Politiker, der Wahlen gewinnen will. Kein Wunder, dass die Entscheidungen immer wieder verschoben wurden. In der Kohl-Ära ließ sich das Problem locker aussitzen; der Atomboom der Siebziger war vorbei und der Ölpreis die meiste Zeit moderat. Rot-Grün leitete zwar nicht nur den Atomausstieg ein, sondern förderte auch erneuerbare Energien. Aber trotz aller Zuwächse beim Einsatz von Sonne, Wind und Wasser zur Stromproduktion reichen die neuen Technologien nicht aus, um den Energiehunger in den kommenden Jahrzehnten zu stillen. Es bleibt dabei, dass vor allem fossile Energien verbrannt werden - mit allen Folgen für die Umwelt und allen Risiken aufgrund von Terror und Instabilität.
Stoiber versucht, auf der Wutwelle zu reiten
Jetzt treiben die hohen Spritpreise die Wahlkämpfer nach vorn. Was jeden Tag in der "Bild" steht, können sie nicht ignorieren. Edmund Stoiber, Zögling des ersten deutschen Atomministers Franz Josef Strauß, war der Schnellste. "Notfalls" müssten neue Atomkraftwerke gebaut werden, zitierte die konservative "Welt" aus einem Strategiepapier der bayerischen Staatsregierung. Niemand in der CSU glaubt, dass die Botschaft, die nicht neu, aber immer wieder provozierend ist, durch Zufall in die Zeitung geriet. Angesichts steigender Spritpreise versucht Stoiber, auf der Wutwelle zu reiten.
Er will die Rot-Grünen da treffen, wo es wehtut. In ihrem sentimentalen Kern. All die Trittins und Fischers samt ihren sozialdemokratischen Kampfgenossen haben noch die Bilder aus Brokdorf im Kopf, die heute wirken wie aus einer anderen Zeit: Bulldozer schieben Hütten, Rucksäcke, Schlafdecken zusammen; Wasserwerfer nebeln Demonstranten ein. Matschige Wiesen verwandeln sich in Schlachtfelder, auf denen eine ganze Generation politisiert wird: gegen den "totalitären Atomstaat", wie es im Gründungsprogramm der Grünen von 1980 heißt. Die heute regierenden Sozis haben sich damals am autoritären Atomfreund Helmut Schmidt abgearbeitet.
Aber Stoibers Spiel ist gefährlich. Denn der Bau zusätzlicher Kraftwerke ist unpopulär. Gerade mal 18 Prozent der Deutschen sind dafür. Und neue Standorte sind kaum durchsetzbar. In Wahrheit geht es dem Bayern vor allem um längere Laufzeiten für bestehende Meiler. Die lehnt zwar ebenfalls eine Mehrheit ab, aber zumindest unter Anhängern der Union stimmen nach der Forsa-Erhebung 61 Prozent zu.
Größter anzunehmender Freund erneuerbarer Energien
Während Stoiber, in einem Kabinett Merkel der mögliche Superminister für Deutschlands wirtschaftlichen Wiederaufstieg, für eine neue Atompolitik trommelt, präsentierte sich Kanzler Gerhard Schröder vergangenen Freitag bei der Bonner Konferenz als größter anzunehmender Freund erneuerbarer Energien. Auch er steckt das Feld ab für die Wahlschlacht 2006. Strom aus Sonne und Wind - das ist endlich mal ein Thema, das Roten und Grünen gute Laune macht.
Der Atomausstieg sollte nach dem ersten rot-grünen Koalitionsvertrag "umfassend und unumkehrbar" innerhalb nur einer Legislaturperiode für alle Zeiten beschlossen werden. Als der Konsens mit der Industrie dann 2000 nach langem Gezerre zustande kam, war viel von dem Pathos verflogen. Zwei Jahrzehnte sollte es bis zum Abschalten des letzten Reaktors dauern. Aber es war geschafft. Zumindest schien es so.
Nun soll offenbar alles wieder von vorn losgehen. "Stoiber will zurück in die Steinzeit", schimpft Grünen-Chefin Angelika Beer. Winfried Hermann, der umweltpolitische Sprecher der Grünen, wittert die Wiederbelebung des alten Paktes von konservativer Politik und Atomindustrie. Stoiber, sagt er, komme "mit dieser hoch riskanten, teuren Alttechnologie um die Ecke und will die Atomwirtschaft bedienen". In der SPD gärt die Angst vor dem GAU, diesmal in einer zeitgemäßen Terrorvariante. "Wenn der Jet groß genug ist", warnt der SPD-Umweltpolitiker Horst Kubatschka, "genügend Benzin getankt hat und die richtige Stelle trifft, kommt es zu verheerenden Folgen."
Wer genau hinhört, spürt, dass die Debatte mehr ist als eine Neuauflage alter Schlachten. Umweltfreunde wie Hermann argumentieren ökonomisch und weisen darauf hin, dass Atomstrom teuer sei. Die Kraftwerksfreunde entdecken ihr Herz für die Ökologie. Der Chef des Energieversorgers EnBW, Utz Claassen, hält Klimaschutz und Kernkraftverzicht zumindest kurzfristig für unvereinbar. Der bullige Manager verpackt seine Zukunftshoffnungen besonders feinsinnig: "Hier wird uns noch viel Kreativität abverlangt werden." Die Entwickler neuer Atomanlagen haben erkannt, dass taktisches Geschick nötig ist, um ihre Visionen zu verkaufen: "Wenn wir mit den Politikern reden, reden wir von Wasserstoff", gibt John Ryskamp vom Laboratorium INEEL im amerikanischen Idaho zu, das an neuen Reaktortypen forscht. Sein Traum ist nuklear erzeugte Energie, die in Wasserstoff gespeichert ist. "Mit einem Kügelchen nuklearen Brennstoffs könnte man so viel Wasserstoff produzieren, dass 220 Autos jeweils 100 Meilen weit fahren können."
Solche Wunderreaktoren sind bislang nur kühne Visionen
Solche Wunderreaktoren der Generation IV sind bislang nur kühne Visionen. Marktreife dürfte die Technik erst um 2030 erlangen, glaubt Ryskamp. Und eine besonders ambitionierte Reaktorvariante, die große Teile ihres eigenen Mülls verwerten kann, dürfte frühestens von 2040 an entwickelt werden.
Damit bleibt ein entscheidendes Problem aller Kerntechnik: der strahlende Müll, dessen Lagerung enorme Summen verschlingt und der über Tausende von Jahren erhalten bleiben wird. "Über neue Kraftwerke brauchen wir gar nicht zu reden, da noch nicht mal die Endlagerfrage geklärt ist", sagt Hans-Heinrich Sander (FDP), niedersächsischer Umweltminister im Kabinett des Christdemokraten Christian Wulff. Trotz 30-jähriger Forschung mochten sich die Deutschen bislang nicht festlegen, wo sie den hoch gefährlichen Dreck endgültig in der Erdkruste versenken wollen. Bis zur Fertigstellung eines Endlagers dürften weitere 45 Jahre ins Land gehen, glauben Experten der Atomindustrie. Und allmählich wird es eng in den Zwischenlagern.
Schnelle Erlösung durch die Kernenergie wird es also nicht geben. Weder sind ihre Probleme der Vergangenheit gelöst, noch stehen ihre Konzepte der Zukunft alsbald zur Verfügung - sollten sie überhaupt je wie versprochen funktionieren. Für alle Zeiten ganz auf die Kernkraft zu verzichten scheint allerdings auch vermessen. Was also bleibt, sind Pest und Cholera: die Erwärmung der Atmosphäre und die Risiken der Nukleartechnik.
Ein zynischer Trost, dass dies ohnehin so ist. Denn die Deutschen mögen national handeln - aber Energiemarkt und Klimawandel sind globale Phänomene. Und obendrein ist der Rest der Welt nicht gewillt, sich an die rot-grüne Beschlusslage zu halten: In vielen Ländern der Erde werden neue Atommeiler gebaut, ob wir wollen oder nicht. Es bleibt nichts anderes, als neue Techniken der Energieerzeugung und des Energiesparens zu entwickeln. Gesucht wird ein Medikament gegen Pest und Cholera. Der Wettlauf hat begonnen.
Mitarbeit: Andreas Albes, Silke Gronwald, Carolin Kaufmann, Michaela Kinzler, Rolf-Herbert Peters, Kerstin Schneider, Sonia Shinde