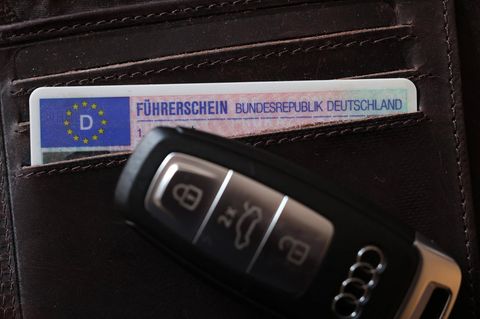Dinge gibt es, die machen keinen Sinn, sie bringen die Menschheit nicht weiter, niemand braucht sie wirklich, sie sind einfach nur schön. Der Eiffelturm zum Beispiel, die Pyramiden von Gizeh oder der Bugatti EB 16.4 Veyron. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, der Neue von Volkswagen soll Automobilgeschichte schreiben, Spätwerk eines technikbegeisterten Konzernlenkers, der Grenzen nur zur Kenntnis nahm, um sie zu überschreiten - leichtsinnig, dynamisch, mutig auch in seinen Fehlentscheidungen.
Der Bugatti Veyron ist Ferdinand Piëchs letztes Geschoss, das ultimative Statement der Kraftnatur, die neun Jahre das Unternehmen Volkswagen steuerte. Der Enkel Ferdinand Porsches, seit 1972 im Konzern, brachte den permanenten Allradantrieb und den TDI-Motor in Verkehr, aber auch den Dreiliter-Lupo. Er pushte die Marken Audi, Seat und Skoda, stieß mit dem Kauf der Nobelmarken Lamborghini, Bentley und Bugatti in die Luxusklasse vor und fuhr mit einem straßentauglichen Einliterauto in den Ruhestand - als Vorsitzender des Aufsichtsrates.
Piëch steckte Milliarden
in seine Träume, baute massenhaft schöne und schnelle Autos und machte den Straßenverkehr zum Breitensport. Nun bringt der Volkswagenkonzern privaten Rennsport auf die Straße und baut den stärksten Sportwagenmotor aller Zeiten, der gerade noch im Bugatti Veyron Platz findet. Ein Rundinstrument links im Armaturenbrett zeigt auf einer Skala die momentan abgeforderte Leistung an: Drückt man etwa beim Anfahren stark aufs Gas, kann es gut sein, dass die Nadel gleich bei 200 von den 1001 möglichen PS steht.
Machtvoll, aber nicht übertrieben ist der Sound des Triebwerks. Tausend Pferde müssen ja nicht brüllen. Vier Turbolader bringen 16 Zylinder in Stimmung, treiben die smarte Flunder auf eine vom TÜV Süddeutschland inzwischen beglaubigte Spitzengeschwindigkeit von mehr als 400 km/h. Nie gab es eine Straßenzulassung für so ein schnelles Auto. Nun sucht es die passenden Fahrer. Viele sind es nicht, die sich melden. Wer fährt schon gern Tempo 400? Wann fährt er die und vor allem, wo? Selbst in den USA und in den Emiraten gibt es nur wenige Rennstrecken, die dafür ausgelegt sind.
Bleiben noch Deutschlands Autobahnen, zum Beispiel ein 17 Kilometer langer, schnurgerader Abschnitt der Autobahn Frankfurt-Darmstadt ohne Tempolimit. Morgens um fünf kann man es riskieren, eine Affäre von 150 Sekunden, dann ist man da durch.
Fahrspaß ist garantiert. Das Problem ist allerdings das Startgeld. Wer einen Bugatti fahren will, kann ihn nicht einfach kaufen. Man muss 300 000 Euro als Anzahlung auf den Tisch legen, dann bestätigt der Präsident von Bugatti den Kaufvertrag und gibt Anweisung zur Produktion. Gebaut wird nur auf Bestellung. Die Auflage ist limitiert, die Kundschaft handverlesen; Milliardäre, Scheichs, Genussmenschen, die keinen Jackpot brauchen, um sich einmal was Schönes zu gönnen. 300 Bugattis sollen möglichst innerhalb von vier Jahren in Molsheim montiert werden, eine Jahresproduktion ist bereits bestellt. Der Listenpreis steht derzeit bei einer Million Euro pro Stück. Vor Steuern. Was für die Mehrwertsteuer von 16 Prozent zu zahlen ist, entspricht dem Preis eines Bentley Continental GT.
Die Kaufsumme
ist bei der angesteuerten Klientel kein Thema. Für den gleichen Betrag bekäme man bei Volkswagen 122 attraktive und anspruchslose Modelle Fox, aber da stellt sich natürlich die Frage: Wohin mit den vielen Autos? Der Kauf eines Bugatti ist also eine platzsparende und ökonomisch sinnvolle Entscheidung. Nie war es möglich, so viel Kapital zu binden, um damit spazieren zu fahren.
Die Investition ist attraktiv. Die rasante, 4,47 Meter lange Skulptur aus Power, Potenz und Politur adelt jede Milliardärsgarage. Sie trägt die silberne Signatur Pierre Veyrons, den Namen eines Rennfahrers, der einst für Bugatti viele Siege eingefahren hat. Renntechnik spielt natürlich mit. Die Sicherheitszelle aus Kohlefaser wurde im Ofen gebacken, Türen und Frontpartie sind aus Aluminium. Zwei mächtige, silbern schimmernde Ansaugstutzen überragen den Fahrer und versorgen den offen liegenden Mittelmotor in seinem Rücken mit Atemluft.
Die High-Tech-Bremsen bringen den Wagen in weniger als zehn Sekunden von Tempo 400 zum Stehen. Und damit der Renner nicht abhebt, regulieren geschwindigkeitsabhängige Klappen im Unterboden und zwei Heckflügel die Bodenfreiheit - Neuland für die VW-Ingenieure und einer der Gründe, warum die Entwicklung des Bugatti Veyron viele Jahre dauerte. Beruhigend: Wer Vollgas fahren will, muss das Fahrzeug vorher freischalten. Sonst sind nur 375 km/h drin. Schneller geht's nur mit einem Extraschlüssel. Das dazu passende Schloss, links neben dem Fahrersitz angebracht, lässt sich nur im Stand bedienen. Ein Dreh genügt, und im Display wird "Topspeed" angezeigt.
Wer einsteigt, sollte gelenkig sein, wenn er sich hinter dem Lederlenkrad in der samtig wirkenden Höhle aus Nubuk- und Alcantara-Leder niederlassen will. In der Mittelkonsole aus Aluminium findet sich der Startknopf, etwas höher Radio, CD-Player, Klimaregler; das Übliche, nur schicker. Die Anzeige des Navigationssystems ist im Rückspiegel abzulesen, keine Karten. Pfeile müssen genügen. Zwischen Fahrer und Beifahrer werkelt ein Siebenganggetriebe, geschaltet wird im Formel-1-Stil mit Wippen am Lenkrad. Ein Schnippen mit dem Finger, und jeder Ölprinz könnte Michael Schumacher überholen, in einem Supersportwagen, der sich im Handling kaum von einem Passat unterscheidet.
Unter der Kühlerhaube
machen sich Kühlaggregate breit, auch die Radhäuser für die eigens gefertigten Hochgeschwindigkeitsreifen von Michelin brauchen Platz. Das Kofferräumchen ist daher nicht der Rede wert. Aber Laptop und Aktentasche passen hinein, ein paar Goldbarren, Negligé und Zahnbürste; was man so braucht. Was sonst noch mit muss, kommt in die Hosentaschen, denn hinter den zwei Sitzen ist kein Stauraum, sondern ein 100 Liter fassender Tank. Wenn man richtig Stoff gibt, ist er in einer Viertelstunde leer.
Molsheim, Heimat von Choucroute, Riesling und Spitzentechnik, ist untrennbar mit dem Namen Bugatti verbunden. Hier gründete der geniale Autobastler, Erfinder und Konstrukteur Ettore Bugatti (1881 bis 1947) die Firma Bugatti Automobile. Er war seiner Zeit voraus, entwickelte schon vor dem Ersten Weltkrieg ein kleines, leichtes Auto, das nur 1,3 Liter Hubraum hatte und 450 Kilo wog, experimentierte 1924 mit Alu-Gussrädern und profillosen, schlauchlosen Reifen. Kritik an seiner Seilzugbremse konterte er mit dem legendären Satz: "Meine Autos sind zum Fahren konstruiert, nicht zum Bremsen."
Bugatti beschäftigte 800 Mitarbeiter. Seine Rennwagen fuhren einen Sieg nach dem anderen ein. Der Typ Lyon T 35 schaffte mit drahtvernähter Karosserie und postkartengroßer Windschutzscheibe fast 2000 Siege. Das Luxusmodell Royale mit Achtzylinder-Motor, 12,7 Liter Hubraum und 300 PS wollte Ettore nur an Könige mit guten Manieren verkaufen. Das majestätische Gefährt verbrauchte 50 Liter Sprit auf 100 Kilometer und war vier- bis fünfmal so teuer wie ein Rolls-Royce. Mit der Weltwirtschaftskrise begann der Niedergang. Die Luxusmarke fand keine Käufer mehr. 1940 kam das Aus.
Zwischen 1910 und 1939 waren rund 8000 Bugattis produziert worden, Rennwagen, Sportwagen, Tourenwagen und Luxuslimousinen. Ein gut erhaltenes Exemplar aus dieser Zeit ist kaum noch zu bezahlen. Der Modezar Ralph Lauren zahlte sieben Millionen Dollar für einen Bugatti Typ 57 SC Atlantic, ein rassiger Sportwagen mit vernieteten Blechen und einem Mittelfalz über dem langen Rücken. Das Auto ist der aufregendste Entwurf der Sportwagenschmiede.
Technische Daten
Technisch gesehen ist der Bugatti ein Leckerbissen erster Güte. Da gibt es das Kohlefaser-Chassis, das an die Formel-1-Technik heranreicht. Auch die Karbon/Keramik-Bremsanlage genügt Rennansprüchen. Hinzu kommt die Luftbremse, die ausfährt, wenn von 200 km/h oder mehr heruntergebremst werden muss. Der 16-Zylindermotor hat vier Turbolader, acht Liter Hubraum und 1001 PS.
Als Piëch 1998 zugriff, hatte zuvor der Italiener Romano Artioli versucht, die Automarke wiederzubeleben. Trotz interessanter Modelle, die als Hommage an den Namensgeber die Buchstaben EB im Signet trugen, wurde es eine grandiose Bauchlandung. Volkswagen kaufte den Namen und setzte die Produktion fort. 1999 war auf zwei Autosalons der EB 218 zu sehen, eine viertürige Limousine mit 18-Zylinder-Motor und 555 PS, und eine VW-Studie des italienischen Designers Giugiaro als Bugatti 18/3 Chiron.
Danach kam der Neuanfang
und die Entscheidung für Molsheim als Produktionsstandort (genauer: für Dorlisheim an der Ortsgrenze von Molsheim). Dort gab es nichts außer einem verfallenen Schloss, das Chateau Jean, das Ettore Bugatti für Repräsentationszwecke nutzte. Der Bau wurde entkernt und im zeitgemäßen Loftstil ausgebaut, zwei nahe stehende Remisen historisch korrekt restauriert und ein Atelier eingerichtet, die eigentliche Montagestätte.
Ein 25-köpfiges Team, darunter acht Franzosen, schraubt seither in dem eleganten Bau aus Glas und grafitgrauen Flächen zusammen, was anderswo produziert wird. Der Heckspoiler kommt aus Österreich, der Motor aus dem VW-Werk Salzgitter, das Fahrgestell vom italienischen Chassis-Spezialisten ATR. Valeo liefert Gebläse, Heizung und Klima. Die meisten Zulieferer mussten sich erst qualifizieren. Spezialbetriebe, die in Handarbeit kleine Stückzahlen perfekt produzieren, hatten sich einem strengen Auswahlverfahren zu stellen. Alles vom Feinsten also. Nur Kabelbaum und Steuergerät sind auch im Golf zu finden. Irgendwo muss es ja Synergien geben im Konzern.
Die Tests waren teuer genug. Vier der Prachtexemplare wurden im Crashversuch zerstört, drei davon gegen die Wand gefahren. Die Disziplinen waren: Frontalcrash, Seitenaufprall, Heckaufprall und ein Überschlag. So wurden vier Millionen Euro in wenigen Sekunden in Schrott verwandelt. Anders hätte der Bugatti Veyron 16.4 weder die Serien- noch die Straßenfreigabe bekommen.
Fehlen nur noch die Nummernschilder. Die Auslieferung beginnt im Herbst. Das Fahrzeug mit der Nummer 007 ist reserviert für Ferdinand Piëch. Er will es seiner Frau zum Geschenk machen.