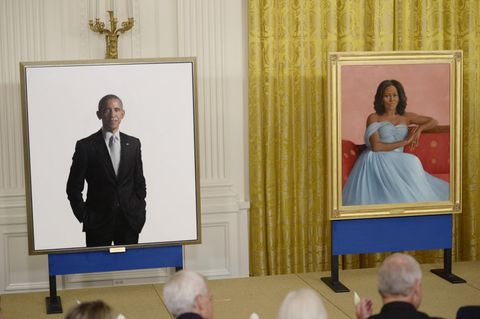Es sind seine letzten Tage in jener Stadt, wo er die Liebe fand und den Glauben und den Einstieg in die Politik und mittendrin auch sich selbst. Er beginnt sie im Fitnessstudio eines Freundes und beendet sie mit Büchern über sein Vorbild Abraham Lincoln, und zwischendurch steht er im Chicagoer Hilton vor Journalisten, die wissen wollen, wie er Amerika nun retten will und dazu die Welt. Barack Obama blickt ausdruckslos, fast starr. Er mag die Fragen nicht, aber man sieht es ihm nicht an. Man sieht ihm nur selten etwas an. Er erzählt etwas vom Wandel im Neuanfang und vom Neuanfang der Hoffnung, er redet etwa zehn Minuten lang, aber danach kann man den Notizblock getrost wegwerfen. Obama ist ein Meister großer Reden, aber auch ein Meister des Nichtssagens. Er ist nicht mehr der Cheerleader der Nation, sondern der Präsident. Er kann sich jeder Situation anpassen - auch dieser.
Im Wahlkampf gab sich Obama noch als Antikriegskandidat, aber nun hat er sich Falken ins Kabinett geholt. Für ihn war die Clinton-Maschinerie ein Relikt der Vergangenheit, nun bedient er sich ebenjener Maschinerie. Er kündigte Steuererhöhungen für Reiche an, will das aber noch mal überdenken. Er bekommt viel Lob, selbst von Präsident Bush und Vizepräsident Dick Cheney, aber einige Demokraten fragen sich bereits, was das für ein Mann ist, der da ins Weiße Haus einzieht. "Er ist ein idealistischer Pragmatiker", sagt Obamas spiritueller Berater Jim Wallis. "Er ist eine freundliche Sphinx", sagt sein ehemaliger Boss Richard Epstein. "Er ist eine Mischung aus vielen Politikern", sagt Abner Mikva. Mikva, 82, sitzt in seinem Büro in Downtown Chicago, und wenn er grinst, sieht man die Spuren eines langen Lebens in der Politik. Es gibt Leute, die sagen, dass Obama nichts wäre ohne seinen Mentor, aber das sieht Mikva anders. "Barack wäre ohnehin dort oben angekommen, er hatte es lange vor." Wie lange? "Seit der Kindheit, glauben ja manche", sagt Mikva grinsend und lässt offen, wie ernst er es meint.
"Obama ist ein Mix verschiedener Leute"
An einem Sommertag vor 15 Jahren betrat der schlaksige Harvard-Absolvent Barack Obama das Büro des ehemaligen Kongressabgeordneten Abner Mikva in der Michigan Avenue. Er strebte eine politische Karriere an und bat den einstigen Kennedy-Berater um Starthilfe. Je länger das Gespräch dauerte, desto klarer wurde Mikva: Da steht der junge JFK vor mir, das gute Aussehen, das Charisma, die Jugend - ein Rohdiamant, sehr roh noch. Du musst deinen Stil ändern, riet Mikva. Mehr Chicago, weniger Harvard. Mehr Martin Luther King, weniger Proust. Und - tat er es? "Obama sagte: Ich werde mein Bestes geben. Eine Woche später sprach er reinsten Chicago-Slang." Wenn man Mikva glauben darf, ging Obama das Projekt Weißes Haus an wie Hausaufgaben. Er studierte die Reden Kennedys und Kings, er sammelte Lebensläufe großer Staatsmänner wie andere Briefmarken, er umwarb Mentoren wie andere Männer Frauen. "Obama ist ein Mix verschiedener Leute", sagt Mikva. "Er bewundert Lincoln und Roosevelt sehr, weil sie bewiesen haben, wie man das Land durch harte Zeiten führt, will sie aber nicht zu oft zitieren. Er bewundert Gandhi, Mandela, und den Redestil hat er von Kennedy." Da hält Mikva kurz inne. Seine Liste klingt wie die Top 10 großer Staatsmänner, wie eine Gebrauchsanleitung fürs Weiße Haus, also fügt er schnell hinzu: "Barack lernt eben unglaublich schnell. Deswegen wird er als Präsident noch besser sein, als er als Wahlkämpfer war." Dieser Satz fällt so oft wie kein anderer in den Interviews mit Freunden, Förderern, Kollegen: Obama ist ein disziplinierter Lerner. Ein akribischer Arbeiter an sich selbst. So wie er die Mission Weißes Haus anging, werde er auch regieren: mit der Systematik eines Ingenieurs und dem eisernen Willen eines Athleten.
Obama über sich im Internet
Lieblingsmusik
Miles Davis, John Coltrane, Bob Dylan, Stevie Wonder, Johann Sebastian Bach: Cello-Suiten, The Fugees
Lieblingsfilme
Casablanca, Der Pate I und II, Lawrence von Arabien, Einer flog übers Kuckucksnest
Lieblingsbücher
Toni Morrison: Solomons Lied
Herman Melville: Moby Dick
Taylor Branch: Parting the Waters
Marilynne Robinson: Gilead
Ralph Waldo Emerson: Self Reliance
Shakespeares Tragödien
Die Bibel
Lincolns gesammelte Schriften
Es ist eine polyglotte Welt im Makiki-Distrikt von Honolulu, auf halbem Weg zwischen Amerika und Japan. In den Häusern in der Beretania Street leben Menschen aller Hautfarben und Konfessionen, Gestrandete aus aller Welt. Hier wuchsen in den 70er Jahren zwei Halbstarke heran, Brüder im Geiste, auf gemeinsamer Suche nach Mädchen und einer Identität: Keith Kakugawa und Barack "Barry" Obama, geboren am 4. August 1961, neun Monate nach dem Wahlsieg John F. Kennedys. Sie waren Farbige in einer bunten Welt, aber trotzdem zwei Außenseiter. Sie gingen auf die Eliteschule Punahou und fühlten sich nicht weiß genug für die Weißen. Sie verbrachten die Nachmittage auf Basketballfeldern und fühlten sich nicht schwarz genug für die Schwarzen. Keith entschied sich für die Rebellion, Barry für die Anpassung. Seine Mutter gab ihm Bücher über schwarze Idole, Thurgood Marshall und Sidney Poitier, aber er lernte lieber Shakespeare auswendig. "Die Menschen waren zufrieden, solang du höflich warst und lächeltest und keine plötzlichen Manöver gemacht hast", schrieb Obama in seiner Autobiografie. "Was für eine Überraschung, einen gut erzogenen jungen Schwarzen zu sehen, der nicht wütend ist." Damals lernte der sensible Junge die Lektion fürs Leben: Betrachte das Leben als Charmeoffensive. Greife die Weißen nicht an. Das Lächeln eines Schwarzen bringt dich viel weiter. "Barry versuchte schon damals zu vermitteln", sagt Kakugawa. "Aber er tat es nicht nur, um Streithähne zu trennen, sondern um sie mitzunehmen auf den Barry-Zug."
Er nahm das ganze Leben als Wettkampf
Kakugawa sitzt in einem mexikanischen Restaurant in einer seelenlosen Gegend von Sacramento. Er ist gerade aus dem Gefängnis gekommen, Drogendelikt. Sein Haar ist zerzaust, der nackte Bauch schaut unter dem Hawaiihemd heraus wie ein flauer Gummiball. Er sagt, ein Magazin habe ihm 30.000 Dollar geboten für dunkle Geheimnisse, aber die würde er nicht mal für drei Millionen preisgeben. In der Autobiografie ist Kakugawa die Antithese zu Obama. "Ich gab ihm den Resonanzboden für seinen Frust", schrieb Obama. "Das stimmt schon", sagt Kakugawa, "aber Barry trug viel mehr Wunden in der Seele, als er zugibt. Er fühlte sich oft allein, im Stich gelassen von seinem Vater, aber auch von seiner Mutter, die in Indonesien blieb. Die Verletzungen haben ihn geprägt. Sein Leben lang hat er nach einem Vater gesucht." Obama schrieb seine Memoiren schon als Student, in oft lyrischer Prosa. Er beschrieb sein Leben als quälende Sinnsuche, als Hindernislauf ins Glück - "Junkie, Kiffer, in die Richtung driftete ich". Er schuf eine fast mythische Figur, eine Geschichte des Überwindens jeglicher Widrigkeit, ohne die kein Film ein Hit wird und keine Biografie ein Bestseller, aber Kakugawa erinnert sich an manches anders. "Obama war nie ein Trinker oder Junkie. Er war immer der Schisser, keiner hat ihn je koksen sehen. Ich liebe ihn, aber er war alles andere als ein unsicheres, herumlungerndes Kind. Es ist alles ein bisschen zu dramatisch im Buch."
Neben Keith sitzt sein Vater Ken, ein alter Mann mit seligem Gesichtsausdruck. Eine Zeit lang war er die Figur, die es nie gab in Obamas Leben. Obamas kenianischer Vater tauchte nur einmal auf, da war er zehn. Sein Großvater, ein erfolgloser Versicherungsvertreter, taugte als Vorbild nicht. Barry verbrachte Tage bei den Kakugawas, er sehnte sich nach einem Mentor auf dem Gebiet, auf dem er am besten war: Basketball. "Er war besessen davon, Profi zu werden und es allen zu zeigen", erzählt der alte Kakugawa. "Als es nicht klappte, schob er es auf seine Hautfarbe. Das stimmte nicht. Er machte zu wenig Punkte." Als es mit dem Basketball auf Hawaii nicht funktionierte, nahm er das ganze Leben als Wettkampf. Er ging in ein 20-jähriges Trainingslager, das ihn auf den Olymp der Weltpolitik führte.
Selbst seine Mimik ist ihm untertan
Er hat kaum geschlafen in der vergangenen Woche. Binnen drei Tagen ist Obama durch vier Zeitzonen gereist, drei Klimazonen, 12.800 Kilometer, und zurück ins Kongresszentrum von Chicago. Er sitzt auf einer großen Bühne vor 2500 Zuhörern, und im Raum steht eine heikle Frage: Wie wäre es mit Reparationen für die Nachkommen der Sklaven? Obama rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her. "Bei der Frage kann ich nicht gewinnen", sagt er lächelnd. Sein Blick springt aus tiefer Ernsthaftigkeit in ein entwaffnendes Strahlen und wieder zurück. Selbst seine Mimik ist ihm untertan. "Die beste Reparation sind gute Schulen", sagt er schließlich, "die beste Reparation ist eine gute Gesundheitspolitik." Eine typische Obama-Antwort. Ein anderer Reporter fragt ihn nach dem Völkermord an Amerikas Ureinwohnern, und Obama rutscht noch ein bisschen unruhiger über seinen Stuhl. Sklaverei, Völkermord - er muss jetzt ins Tiefgeschoss der US-Geschichte. Er könnte sich mal bekennen, aber die Antwort ist wie sein Leben - ein Nichtangriffspakt: "Eine unserer größten Stärken ist doch, dass wir so unterschiedliche Geschichten haben und doch Amerikaner sind."
Obamas Sprache ist wie er selbst. Jedes Wort ist richtig gesetzt. Er sagt nicht immer viel, aber selbst seine Worthülsen klingen wie ein Gedicht. Und niemals zeigt er dabei irgendeine Schwäche, kein Augenrollen, keinen Wutausbruch, seine Selbstdisziplin ist so umfassend, dass er selbst die Kontrolle über seine Gefühle zur Chefsache macht. "Er ist Teilnehmer, aber auch Beobachter seiner selbst", sagt sein Chefberater David Axelrod. "Natürlich ist er auch mal wütend, aber er kanalisiert seine Wut und verwandelt sie in positive Energie", sagt Axelrod, und es klingt wie ein physikalischer Vorgang. David Axelrod, 53, und Obama haben die vergangenen zwei Jahre ständig zusammen verbracht, in Bussen, Flugzeugen, in nächtlichen Sitzungen. "Er hat mehr Zeit mit David verbracht als mit Michelle in 16 Jahren Ehe", sagt ein Mitarbeiter, "aber einen wahren Einblick in sein Seelenleben gibt Barack keinem." Axelrod steht nur einige Meter von Obama entfernt bei einem Wirtschaftsgipfel in Palm Beach. Auch über die kurze Distanz schicken sie sich eifrig Textbotschaften wie zwei Teenager. Manchmal kichert Axelrod. Manchmal sind Basketballergebnisse dabei. Vorn auf der Bühne betet ein Pfarrer: "Herr, lass uns ein Teil von Schicksal und Geschichte werden, leite uns auf den Höhenweg der Anständigkeit und schenke Barack Obama Weisheit und Güte als 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Amen."
4000 Menschen sagen "Amen". Auch Gott ist irgendwie auf Obamas Seite. Seine Auftritte haben noch immer gelegentlich etwas Messianisches. Axelrod mag den Messias-Vergleich nicht. "Er ist derselbe Mensch, den ich vor 16 Jahren traf. Er behandelt alle Menschen gleich, damals wie heute. So wie er privat ist, ist er auch in der Öffentlichkeit. Er will Menschen einfach helfen." Hat er sich gar nicht verändert? "Er ist selbstbewusster geworden, aber bei ihm weißt du: Er war gestern derselbe, der er heute ist und der er morgen sein wird." Auch als Präsident? "Auch als Präsident." Kein "Change"? "Kein Change." An sich selbst hat Obama für "Change" nicht so viel übrig. Vor etwas mehr als 20 Jahren kam Obama erstmals nach Chicago, er arbeitete als Sozialarbeiter auf der rauen South Side. Hinter ihm lagen Universitätsjahre in Los Angeles und New York, in denen er abwechselnd wie ein Mönch und ein Aktivist lebte. Auf Hawaii war er einer der wenigen Schwarzen auf einer weißen Eliteschule gewesen, in Chicago galt er als elitärer "Weißer" in einer schwarzen Welt; später in Harvard war er der Versöhner zwischen Linken und Rechten. "Er war immer in der Diaspora", sagt Alvin Love. "Aber er findet sich überall zurecht." Alvin Love ist Pfarrer in Chicagos South Side. Seit 20 Jahren schon ist er ein guter Freund Obamas, und wer ihn bei der Predigt in seiner Baptistenkirche beobachtet, glaubt Obama vor sich zu haben. Er spricht im gleichen Rhythmus, in eingängigen Refrains, er sieht aus wie eine Kopie, ist aber eher das Original. "Reden hat Barack hier gelernt", sagt Love. "Er war mal ein furchtbarer Redner."
Wer zuhört, hat wenig Feinde
Pfarrer Love ist einer der wenigen, der Obama auch mal schwach erlebte, aber selbst in solchen Momenten wirke er noch stark. "Barack ist durch all seine Kämpfe allein gegangen. Das bringt dich in deiner Selbstfindung weiter." Love beschreibt diese Selbstfindung als eine lebenslange Arbeit, einen fast physischen Kraftakt, wie eine Romanfigur Hermann Hesses verbrachte er sein Leben in ständiger Introspektion. "Darum hat Barack auch die Kraft, auf seinen Gegner zuzugehen und ihn umzustimmen. Er kann Schläge einstecken und schlägt nicht zurück. Das verlangt viel mehr Stärke." Manchmal klingen die Sätze von Love und den anderen Freunden Obamas wie Auszüge aus dem Neuen Testament. Nie würden sie Obama als Heiland bezeichnen, doch in der Dramaturgie ihrer Erzählungen treffen die Endzeit Amerikas und die Ankunft Obamas stets zusammen wie in einem metaphysischen Plan. Er ist der perfekte Deal von Schicksal und Historie. Von Coolness und Seriosität. Und der erste Präsident fürs 21. Jahrhundert, der ideale Kandidat im Zeitalter von Patchworkfamilien, Fusion-Food und Mischehen. Und dabei sind sich die Weggefährten seines Lebens einig, Kommilitonen, Senatoren und die Freundinnen seiner Ehefrau Michelle: Obamas größte Waffe im Zeitalter manischer Selbstdarstellung ist das Zuhören. Er hört zu, um zu lernen, aber auch, um geliebt zu werden. Wer zuhört, hat wenig Feinde.
Obama wird als Präsident kein Alphatier der Sorte Sarkozy oder Berlusconi sein, für die Macht per se sexy ist. Er hat das gleiche Ego, würde aber nie am Zaun des Weißen Hauses rütteln und brüllen: Ich will hier rein. Eher zeichnet er den Weg akribisch am Reißbrett. Vielleicht ist dies bedeutender noch als seine Hautfarbe: Das Land von Clint Eastwood, George W. Bush und des Rappers 50 Cent hat sich für einen einfühlsamen Denker entschieden. In diesem ultimativen Kampf der Alphatiere siegte der Charmeur. Er gewann, so sagen einige, mit den Waffen einer Frau. Man wird keinen Wegbegleiter finden, der etwas Abfälliges über Obama sagt, außer vielleicht Hillary Clinton, die ihn für einen gerissenen Opportunisten hält, aber das darf sie nicht öffentlich sagen. Außer Bill Clinton, der ihn für eine Kopie von Bill Clinton hält, aber das darf er auch nicht sagen. Und außer Richard Epstein, seinem ehemaligen Vorgesetzten, aber auch der ist sich nicht sicher, was er sagen darf. Epstein sitzt im Speisesaal der Universität von Chicago und kämpft sichtbar mit sich. "Barack ist ein netter Kerl", sagt er, "deine Neigung ist sofort, ihn zu mögen. Jeder mag ihn. Ich mag ihn."
"Er kann sich jeder Situation anpassen"
Er war Professor der Jura-Fakultät, als Obama dort 1992 Dozent wurde. Epstein lud ihn zu vielen Akademikertreffen ein, aber Obama kam in zwölf Jahren nur ein einziges Mal und schwieg. Er schrieb nie auch nur einen wissenschaftlichen Aufsatz. "Es ist verdammt schwer mit Barack", bricht es schließlich aus Epstein heraus. "Er sagt dir nie, was er denkt. Er will sich immer alle Optionen offenhalten. Er war immer Politiker, sein ganzes Leben lang, selbst im privaten Gespräch. Er beherrscht diese Regel perfekt: Worte, die du nicht sagst, musst du niemals zurücknehmen. Er hat die Taktik entwickelt, weil er immer Außenseiter war: Verletze ja keinen." Epstein hat den Eindruck, die Welt kenne Obama nicht. "Ich habe so etwas noch nie gesehen. Die Welt ist ihm ja verfallen. Er ist ein Phänomen wie sonst nur Prinzessin Diana. So wie sie die Welt mit ihrem schüchternen Lächeln eingewickelt hat, macht er es mit seinem offenen Strahlen. Und er glaubt tatsächlich, dass die Welt, ja selbst einer wie Irans Präsident Ahmadinedschad, seinem Charme erliegen wird. Ich glaube, dass er zu weich ist." Wenn es Zweifel am Präsidenten Obama gibt, auch unter seinen Freunden, dann dieser: Kann er Entscheidungen fällen, die anderen wehtun? Nie in seinem Leben hat er das tun müssen. Nie hat er Regierungsverantwortung besessen. Weder in Illinois noch in Washington erreichte er als Senator besonders viel. Er hielt sich fern von Kontroversen und wagte nur selten etwas Kühnes.
"Aber Barack hat es mit den mächtigsten Politikmaschinen aufgenommen", entgegnet Abner Mikva. "Mit den Clintons und den Republikanern. Und er schlug beide." Unter Mikvas Obhut hat Obama schon früh gelernt, sich zwischen den Fronten zu bewegen. Er hat sich durch die korrupte Politik Chicagos manövriert, ohne dass etwas hängen blieb. Er hat Bündnisse mit dubiosen Figuren geschlossen, wenn es ihm half. Bei seiner Wahl in den Senat von Illinois trat er gegen seine eigene Mentorin Alice Palmer an und überführte ihr Team der Fälschung von Wählerregistrierungen. "So was lernst du in Chicago", sagt Mikva. "Man sollte nicht unterschätzen, wie taff er sein kann, auch als Präsident. Er kann sich jeder Situation anpassen." Nie fiel es Obama so schwer, sich zu assimilieren, wie im Senat von Illinois. Den schwarzen Abgeordneten war er nicht schwarz genug, und für die weißen im ländlichen Illinois war er zu exotisch. Die Abende verbrachte er häufig beim Pokern mit Lobbyisten und drei weißen Senatorenkollegen, sie rauchten Zigarren und klopften Sprüche und gefielen sich als Al Pacinos der amerikanischen Kornfelder. Obama war nie Pokerspieler gewesen, aber er brauchte neue Allianzen. Er war nie Biertrinker, aber nun arbeitete er tapfer an zwei Flaschen pro Abend.
Alles bis ins letzte Detail geplant
Obama spielte Poker, wie er Politik betrieb: Ohne Risiko, nie setzte er alles auf eine Karte, bis seinem Mitspieler Larry Walsh der Kragen platzte: "Verdammt, Barack, wenn du in der Politik so konservativ wärst wie beim Pokern, könnten wir gute Freunde sein." Das Zimmer des ehemaligen Senators in der Kleinstadt Joliet ist eine Hommage an Obama. Auf dem Tisch steht ein Foto mit ihm, daneben liegt Obamas Buch, an der Wand weitere Fotos. Auch Walsh fühlt sich irgendwie als Mentor. Von ihm habe Obama die Volksnähe und dass man als Politiker auch mal in Hot Dogs beißen und dabei glücklich dreinschauen sollte. Man bekommt langsam den Eindruck, dass es etwa 300 Obama-Mentoren gibt, selbst einen für Hot Dogs. "In einem können Sie sicher sein", sagt Walsh. "Dieser Mann hat alles bis ins letzte Detail geplant. Er hat sich durchleuchtet, da liegt keine Leiche im Keller." In zwei Wochen wird Obama nach Washington ziehen, in jene Stadt, die er "Gewächshaus" nennt oder auch "Fischglas". Als er 2005 als US-Senator nach Washington kam, gab er an sein Team die Devise aus: Keine großen Reden, keine kühnen Gesetze, "ich möchte gemocht werden". Tagsüber bastelte er im Stillen an einem Netzwerk von Mentoren, abends zog er sich zurück in seine Studentenbude in Chinatown und arbeitete lieber an seinem zweiten Buch. Solchen Freiraum wird er nun nicht mehr haben. Denn als Präsident steht Obama nach Meinung zahlreicher Historiker vor einer Vielzahl von Krisen, wie sie selbst Franklin D. Roosevelt 1933 nicht vorfand. Wird er diesen Druck aushalten?
"Er ist unheimlich ruhig und selbstbewusst, auch im Angesicht dieser Szenarien", sagt seine beste Freundin Valerie Jarrett. "Er geht ins Fitnessstudio und entknotet dort sein Gehirn", sagt sein Mitarbeiter Dan Shomon. "Er wird Gott um Führung bitten", sagt Jim Wallis. Wallis sagt den Satz voller Ernst. Der Theologe sitzt in einem gläsernen Büro in Washington und versteht die Skepsis nicht. "Gebete sind Barack wichtig. Er bittet um Gottes Begleitung und Hilfe." Wallis ist eine Art spiritueller Begleiter und erzählt fast andächtig von jenem Moment, als der heilige Geist vor 16 Jahren in der 95. Straße von Chicago auf Obama hinabfiel. "Er ging durch den Kirchgang der Trinity United Church of Christ und hatte auf einmal dieses Bekehrungserlebnis. Er gab sein Leben in Gottes Hände." In Gottes Hände? "Keine Angst", sagt Wallis schnell. "Barack wird nicht der Oberpastor der Nation sein. Es geht nicht um die Verbreitung seines Glaubens, es geht um einen moralischen Kompass." Wallis nennt Obama "Amerikas Brücke" in eine neue Zeit, den fehlenden Link zwischen religiösen und säkularen Fundamentalisten.
Er ist der Schmelztiegel vieler Positionen
Die Bezeichnung "Brücke" fällt oft in Gesprächen über Obama. Die Brücke zwischen Schwarz und Weiß, links und rechts, Erster und Dritter Welt, Christen und Muslimen. Er hat aus seiner Herkunft einfach eine Weltanschauung gemacht. "Barack denkt über Armut wie ein mitfühlender Linker und über Familienwerte wie ein Konservativer", sagt Wallis. "Er wird im Weißen Haus sitzen und sich die besten Ideen herauspicken und dann sagen: Hier ist meine Mosaiklösung." Auch nach seinen zwölf Jahren in der Politik ist es nicht leicht zu sagen, wofür Barack Obama wirklich steht. Er ist der Schmelztiegel Amerikas, aber auch der Schmelztiegel vieler Positionen. Er hinterlässt kaum Spuren, nur ein wohliges Gefühl. Er ist der neue Mann in der Politik, aber nicht unbedingt der neue Politiker. Er ist kein geborener Entscheider, eher der Motivator, Grübler, Mediator. Vielleicht nicht die schlechteste Qualifikation für das höchste Amt in einem schwer geplagten Land.
Mitarbeit: Anuschka Tomat