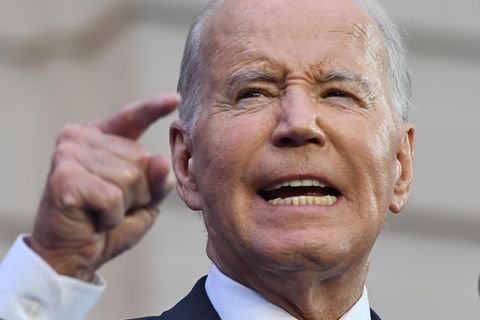Es ist ein erschreckendes Bild, das die europäischen Staats- und Regierungschefs in den vergangenen Wochen in der Flüchtlingskrise abgegeben haben: Wie Teppichhändler haben sie um die Verteilung von Flüchtlingen gestritten, sich mit Vorwürfen und Beleidigungen überzogen. Wieder einmal war es die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die im Zentrum der Kritik stand. West gegen Ost, die Europäische Union hat einmal mehr demonstriert, wie Solidarität nicht geht.
Auf dem "informellen" Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel haben die Chefs versucht zu zeigen, dass Europa doch handeln kann, wenn es darauf ankommt; dass der interne Zwist die reiche Union nicht lähmen muss. Die Voraussetzungen hatten sich in den Tagen zuvor noch einmal verschlechtert. Vor allem aus zwei Gründen.
Die Innenminister und die "nukleare Option"
Erstens: Am Dienstag beschlossen die Innenminister der Union endlich eine Verteilung von 120.000 Flüchtlingen innerhalb Europas. Allerdings nicht einstimmig, sondern mit einer Mehrheitsentscheidung. Das heißt: Es gab Nein-Sager, die überstimmt wurden. Diese Nein-Sager sind Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Rumänien. Für Brüsseler Verhältnis ist es neu, dass es Verlierer gibt, manche nennen den Mehrheitsentscheid die "nukleare Option“. Am Dienstag wurde diese Option gezogen - entsprechend auf der Zinne waren die unterlegenen Staaten - denn sie sind an die Entscheidung gebunden.
Zweitens: Am Mittwochmorgen hatte der ungarische Premier Viktor Orbán einmal mehr gegen die deutsche Kanzlerin gewettert - und zwar ausgerechnet von Bayern aus, von der Klausurtagung der CSU in Kloster Banz. Horst Seehofer, der in der Flüchtlingskrise auf die Ängste wettet, hatte Orbán eingeladen, nun geißelte der einen vermeintlichen "moralischen Imperialismus“ Merkels in der Flüchtlingsfrage. Und auch damit, dass Ungarn die Grenze zu Kroatien schließen werde, droht der Rechtsaußen. Kein gutes Entrée für einen freundlichen Plausch am Abend in Brüssel.
"Zäune sind kein Mittel"
Angesichts dieser Voraussetzungen war der Gipfel am Ende so etwas wie ein Erfolg. Denn weder die Auseinandersetzungen um die Entscheidung der Innenminister noch die Ausfälle Orbáns wurden offiziell diskutiert. Und auch in der Auseinandersetzung mit Orbán bemühte sich Merkel, sich zumindest öffentlich nicht provozieren zu lassen: "Das Klima war konstruktiv", sagte die Kanzlerin, als sie um ein Uhr nachts im ersten Stock des Ratsgebäudes die Ergebnisse vorstellte. Es sei allen klar, dass es in der Flüchtlingsfrage ein "umfassendes Problem“ gebe, das nur gemeinsam gelöst werden könne. Und nein, Zäune seien kein Mittel, mit dem man Probleme löst.
Inhaltlich externalisierte der Gipfel den Konflikt. Statt sich weiter über die heikle Frage der Verteilung der Flüchtlinge in Europa zu streiten, ging es vor allem darum, wie die Fluchtursachen vor allem in Jordanien, im Libanon, aber auch in der Türkei besser bekämpft werden können, wie der EU-Grenzschutz verbessert werden kann und wie man dafür sorgen kann, dass vor allem Griechenland und Italien mit dem Zustrom besser fertig werden. Völlig überraschend hat die EU nämlich festgestellt, dass es den Hilfsprogrammen, die sich in den Nachbarländern Syriens um Flüchtlinge kümmern, an Geld fehlt. Hier soll nun schnell und massiv geholfen werden, damit es für Flüchtlinge weniger attraktiv ist, nach Europa zu fliehen. Auch sollen so genannte "Hot Spots", in denen Flüchtlinge schnell registriert und untersucht werden jetzt schnell gestärkt werden. Hier ist der Fokus auf Griechenland. "Wir müssen Griechenland in das Dublin-System zurückbringen“, sagte ein EU-Diplomat. Mit anderen Worten: Wenn die Griechen Flüchtlinge ordentlich registrieren, dann können die nicht einfach bis nach Deutschland weitergereicht werden.
Wie das alles konkret ausgestaltet wird, ist in vielen Punkten noch unklar oder offen. Aber der Gipfel hat es am Mittwoch immerhin geschafft, etwas Bewegung in die europäische Flüchtlingspolitik zu bringen. Die Gräben sind deswegen noch lange nicht zugeschüttet.