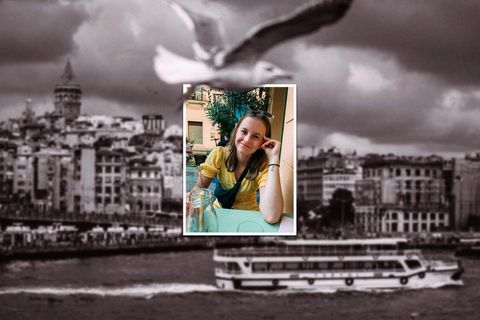Die Präsidentschaftswahlen in der Türkei werden für das Land offenbar zu einer Nagelprobe. Die Regierungspartie AKP möchte Abdullah Gül zum Präsidenten wählen. Bei einem Wahrerfolg hätte die säkularisierte Türkei erstmals einen gemäßigten Islamisten an der Spitze. Kritiker befürchten den Anfang vom Ende der Trennung von Religion und Staat. Die Stimmung ist aufgeheizt. Der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan hat nun eine Rede an die Nation angekündigt. Offiziellen Angaben zufolge wollte sich der Regierungschef am Montagabend um 19.15 Uhr an das Volk wenden.
Zudem berät das Verfassungsgericht über einen Antrag der Opposition, die Wahl auszusetzen. Sollten die Richter dem Einspruch stattgeben, wird mit vorgezogenen Parlamentswahlen gerechnet. Das Urteil soll bis Mittwoch fallen, wenn der zweite Wahlgang im Parlament angesetzt ist. Eine Entscheidung des Parlaments wird aber nicht vor dem dritten Wahlgang am 9. Mai erwartet, in dem die einfache Mehrheit der AKP für eine Wahl Güls ausreichen würde. Bei der ersten Wahlrunde hatte Gül die erforderliche Zweidrittelmehrheit um zehn Stimmen verpasst. Ihre Verfassungsbeschwerde hatte die oppositionelle Republikanische Volkspartei CHP damit begründet, dass mindestens zwei Drittel der Abgeordneten an der Abstimmung hätten teilnehmen müssen.
Parlamentspräsident Bülent Arinc bekräftigte indes, dass die Präsidentenwahl wie geplant fortgesetzt und erfolgreich abgeschlossen werde. Arinc gehört zu den einflussreichsten Politikern der regierenden AKP. Gül beharrte trotz des zunehmenden Drucks auf seiner Kandidatur für das Präsidentenamt. "Das Verfahren hat begonnen und wird fortgesetzt", sagte der islamisch-konservative Außenminister am Sonntag.
In dem sich verschärfenden Streit über die türkische Präsidentenwahl haben am Wochenende in Istanbul zuletzt eine Million Menschen gegen die Regierung und für eine Trennung von Staat und Religion demonstriert. Sie warfen der Regierungspartei und Erdogan vor, die Türkei islamieren zu wollen und damit den EU-Beitritt aufs Spiel zu setzen. "Die Türkei ist weltlich und wird es bleiben" riefen die Demonstranten und forderten die Regierung zum Rücktritt auf. "Wir sind hier, um die Schaffung eines islamistischen Staates zu verhindern", sagte der Geschäftsmann Irfan Kadim. "Schulter an Schulter gegen die Scharia", hatte die Menge skandiert.
Auch die Börse reagierte auf die innenpolitische Krise mit einem dramatischen Kurseinbruch. Der Leitindex der Istanbuler Börse sackte bei der Eröffnung um fast acht Prozent. Auf den Devisenmärkten verlor die Landeswährung gegenüber Dollar und Euro deutlich an Wert, wie türkische Medien berichteten.
"Express" (Köln)
Das Kopftuch der First Lady in spe, der Gattin des türkischen Staatspräsidentschafts-Kandidaten Abdullah Gül, ist der Stoff, der die Türkei in einen Albtraum führen kann - den Militärputsch. Die drohenden Erklärungen der Armeeführung gehen wie Schockwellen durchs Land. Die Generäle fragen: Ist das Kopftuch im Präsidenten-Palais, bis dato eine Festung des Laizismus, der Trennung von Staat und Religion, einmal geduldet - kann es dann in allen anderen Amtsstuben der Republik noch verboten bleiben? Würde ein erstmals aus dem islamisch-konservativen Milieu stammender Präsident im Pakt mit der Erdogan-Regierung nicht weitere entscheidende Schaltstellen besetzen?...
"Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Frankfurt)
(...) Abdullah Gül, der Außenminister,(...) soll Präsident werden. Diese Entscheidung hat die Militärführung brüskiert, die offenbar gehofft hatte, Erdogan werde einen für die eingeschworenen Kemalisten akzeptableren Wahlvorschlag machen. Anders ist die Schärfe der Erklärung nicht zu verstehen, mit der die Generäle wenige Stunden nach dem ersten Wahlgang, in dem Gül zehn Stimmen fehlten, an die Öffentlichkeit gegangen sind: Das türkische Militär droht,(...)mit einem Putsch. Zwar steht noch ein Spruch des Verfassungsgerichts aus, ob der Wahlvorgang den parlamentarischen Regularien entspricht. Doch die Drohgebärde der Generäle und die Mobilisierung Hunderttausender, die auf den Straßen für eine säkulare Türkei demonstrieren, zeigen, dass sich das Land, wenn nicht rechtlich, so faktisch im Ausnahmezustand befindet. (...)
"Fuldaer Zeitung" (Fulda)
Das eindrucksvolle Votum von 300.000 oder mehr Menschen, die allein in Istanbul für ein Gemeinwesen mit strikter Trennung von Religion und Staat auf die Straße gingen, kann nicht darüber hinwegtäuschen: Die Türkei ist noch lange nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Mit großer Sorge betrachten die westlichen Demokratien hier insbesondere die Mitglieder der Europäischen Union die jüngste Entwicklung in Ankara. Was sich gegenwärtig am Bosporus abspielt, wird die ohnehin schwierigen Verhandlungen über einen türkischen EU- Beitritt erheblich komplizieren.
"Mannheimer Morgen" (Mannheim)
Lange waren sie ruhig, doch jetzt haben sie sich mit einem Paukenschlag eindrucksvoll in Erinnerung gebracht: Die Militärs in der Türkei setzen die islamische Regierungspartei AKP brutal unter Druck. Sie drohen mit einem Putsch, sollte Abdullah Gül das Präsidentenamt übernehmen. Ob die Armee tatsächlich interveniert oder nur blufft, ist eine spannende Frage. Offensichtlich will die selbst ernannte Hüterin der laizistischen Verfassung jedenfalls gemeinsame Sache mit der Opposition machen. Diese hat in der Vergangenheit die Türkei abgewirtschaftet und den Reformen der AKP nur düstere Warnungen vor einer Unterwanderung des Staates durch den Islam entgegengesetzt. Dass die Militärführung nicht sofort ausgetauscht werden kann, beweist, wie groß die Macht der Generäle am Bosporus noch immer ist. Schon dies zeigt, welchen weiten Weg die Türkei in Richtung Europa gehen muss.
"Münchner Merkur" (München)
Als Atatürk die türkische Republik aus der Taufe hob, strebte er für das Land eine europäische Identität an. Der Islam wurde dafür zwar entpolitisiert, leider aber nie durch Reformen europäisiert. Und: Die Trennung von Kirche und Staat wurde weder verarbeitet oder legitimiert, noch im Denken der Menschen verankert. Geblieben ist ein fruchtbarer Nährboden, auf dem der islamische Fundamentalismus wuchern kann, gefördert von Politikern der AKP mit Männern wie Regierungschef Erdogan oder Außenminister Gül an der Spitze. Wären nicht das Militär und dessen kemalistisch eingeschworene Führungselite, würden in der Türkei längst die Scharia-Islamisten alles dominieren.
"Nürnberger Nachrichten" (Nürnberg)
Die Türkei steckt in dem bisher wichtigsten Belastungstest für ihre Demokratie. Beim Streit um die Präsidentenwahl geht es nicht um eine Auseinandersetzung zwischen laizistischen und islamistischen Kräften, wie die Gegner der AKP-Regierung von Recep Tayyip Erdogan es gerne darstellen wollen. Es geht um die Frage, ob eine demokratisch gewählte Regierung ihre Politik durchsetzen kann, ohne dass demokratisch nicht legitimierte Institution wie die Armee das verhindern. Die Antwort auf diese Frage wird nicht nur große Auswirkungen auf die Türkei selbst haben, sondern auch auf ihre EU- Kandidatur.
"Stuttgarter Zeitung" (Stuttgart)
Ein Militärputsch in der Türkei? Die Zeiten seien längst vorbei, winkten bis vor Kurzem viele Türken ab. Die Türkei 2007 sei nicht mehr die Türkei des Jahres 1980, als die Generäle das bürgerkriegsähnliche Chaos mit einem Staatsstreich beendeten. Zu eng, so meinen viele, sei das Land inzwischen in den EU-Beitrittsprozess eingebunden, als dass die Militärs eine Machtübernahme wagen könnten denn damit würden sie doch die europäische Perspektive der Türkei aufs Spiel setzen. Diese Argumentation setzt voraus, dass die türkischen Generäle eine Integration ihres Landes in die EU überhaupt wollen. Aber das ist keineswegs mehr sicher.
"Süddeutsche Zeitung" (München)
Das Land muss wählen zwischen der Rückkehr in längst vergangene, finstere Zeiten und einer demokratischen Zukunft. Um nichts weniger geht es, und damit auch darum, ob die Türkei irgendwann ihren Platz in der EU finden kann oder ob sie einfach nicht nach Europa passt.
"Südkurier" (Konstanz)
Die Türkei ist ein zerrissenes Land. Die Reformer um Regierungschef Erdogan wittern die historische Chance, den Präsidenten zu stellen und den Staat nach ihren Vorstellungen umzuformen. Die Angst vor den Islamisten in Erdogans Umfeld treibt in Ankara und Istanbul Hunderttausende auf die Straße. Sie sehen Atatürks Gebot einer strikten Trennung von Staat und Religion in höchster Gefahr. Mit dieser Sorge liegen sie vermutlich richtig. Dennoch: Mit den Brechstangen des Militärs lässt sich dieser Konflikt nicht lösen. Wenn die Türkei wirklich Teil Europas werden will, muss sie lernen, andere Antworten zu finden. Die EU kann dabei helfen, indem sie gemäßigte Kräfte ermutigt und Scharfmacher zurückpfeift. Sie gibt es in beiden Lagern.
"Volksstimme" (Magdeburg)
In der Person Abdullah Güls spiegelt sich die ganze Widersprüchlichkeit der heutigen Türkei wider. Zum einen ist der Präsidentschaftskandidat ein pragmatischer, Europa zugewandter Reformer, zum anderen ein traditionsbewusster Muslim, dessen Frau für das Recht auf das Kopftuch schon vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gestritten hat. Wohin ginge die Reise für die Türkei unter einem solchen Präsidenten? Die türkischen Generäle sind sich sicher: Weg von den laizistischen Vorgaben Kemal Atatürks und hin zu einem islamischen Staat. Das fürchten auch hunderttausende Türken ohne Uniform, die gegen Gül und die Regierungspartei AKP auf die Straße gehen...
"Thüringer Allgemeine" (Erfurt)
Die Zeiten in Europa sind vorbei, dass sich Generäle als Hüter der Verfassung aufspielen. Doch glauben sie in der Türkei offenbar noch immer, dass ihre Putschgelüste von NATO und EU toleriert werden, weil sie einer Islamisierung entgegenstehen und das Prinzip des Laizismus verteidigen. Auch diesmal gibt die Armeeführung vor, sie wolle verhindern, dass die religiös-konservative Partei AKP Premier und Präsident stellt und damit das gesamte Land in die Hände bekommt. Der Anlass scheint der Generalität jedoch eher willkommen zu sein, um alte Machtpositionen wieder herzustellen, die gerade durch die Annäherung zur EU beschränkt wurden.
"El Mundo" (Madrid)
"Besonders Besorgnis erregend ist die Ankündigung der türkischen Militärführung, die Islamisierung des Staates notfalls mit Waffengewalt zu bekämpfen. Man darf nicht vergessen, dass die Militärs in der Türkei seit 1960 drei Mal geputscht und 1997 die Regierung zum Rücktritt gezwungen haben.
Die Europäische Union sollte ihren Einfluss geltend machen, damit sich so etwas nicht wiederholt und der Wille des Volkes respektiert wird. Die Demokratie in der Türkei darf nicht unter der Vormundschaft des Militärs stehen. Sonst würde der ohnehin komplizierte Beitritt des Landes zur EU noch zusätzlich erschwert."
"Luxemburger Wort" (Luxemburg)
"Die Türkei befindet sich auf dem Weg zur Demokratie ... Aber eben erst auf dem Weg! Gleiches gilt für das Streben in die Europäische Union. Beispiele? Könnte man sich etwa in Deutschland eine Drohung der Bundeswehr bei der Wahl des Kanzlers vorstellen? In der Türkei ist dies politische Realität! Am anderen Extrem stehen die islamistischen Staatsmodelle der Fundamentalisten. Weder eine Art Bosporus-Militärdemokratie noch ein lauer Gottesstaat sind jedoch EU- kompatibel. ... Die augenblickliche Krise in Ankara zeigt schlichtweg, dass Land, Gesellschaft und Armee noch nicht reif für eine Vollmitgliedschaft in der Wertegemeinschaft EU sind."
"Nepszabadsag" (Budapest)
"Das Modell Atatürk ist der wahr gewordene Traum der amerikanischen Neokonservativen: der praktische Beweis dafür, dass sich ein muslimisches Nahost-Land tatsächlich in eine Demokratie verwandeln lässt. In der NATO verfügt die Türkei über die zweitgrößte Armee. Über die Dilemmata der türkischen Rechtsstaatlichkeit pflegen sich die Bündnispartner nicht den Kopf zu zerbrechen, wenn sie etwa plötzlich den Luftstützpunkt Incirlik benötigen. Nur dass sich auf einmal die selben „Bündnispartner“ - nur diesmal mit dem EU-Hut auf dem Kopf - vor der Herrschaft der Generäle fürchten. Mit ihren Drohungen vom Wochenende lieferten diese genau jenen in der EU Argumente, die die Annäherung der Türkei an die Union aus völlig anderen Gründen hintertreiben wollen."
"Die Presse" (Wien)
"An sich ist die Vorstellung ja nicht unsympathisch: Eine einflussreiche Institution ist wachsam, gibt acht, dass die Türkei auf Westkurs bleibt und ja nicht in den Islamismus abgleitet. Doch bei dieser hehren Vorstellung gibt es einen gewaltigen Schönheitsfehler: Die mächtige Institution, die den Schutz der weltlichen Türkei übernommen hat, ist durch und durch autoritär und weiß mit europäischen Werten wie Demokratie und Menschenrechten nur wenig anzufangen: Die türkische Armee als Hüterin der Freiheit - das ist mit Sicherheit eine klare Fehlbesetzung.
(...) Der Kampf für eine westliche, laizistische Türkei ist schön, gut und wichtig. Er darf aber nur dem türkischen Wähler und der Zivilgesellschaft überlassen werden. Für die Streitkräfte eines Landes, das sich Europas Werten verpflichtet fühlt, ist dabei kein Platz."
"La Repubblica" (Rom)
"Kann man Abdullah Gül vertrauen, dem praktizierenden Muslim, der in dieser Woche Präsident der Türkei werden könnte? Oder hat der türkische Generalstab recht, der die Säbel klingen lässt, um so den obersten Gerichtshof dazu zu bewegen, die Wahlen zu unterbrechen, bevor etwas Irreparables geschieht? Wenn Europa mitreden könnte, dann würde es wahrscheinlich den hunderttausenden Türken zustimmen, die in der vergangenen Tagen (...) auf die Straße gegangen sind, um Gül aufzufordern, sich zurückzuziehen und die Generäle dazu zu bewegen, auf ihrem Platz zu bleiben. (...) Falls die Generäle die Demokratie aufheben würden (...), würde dies all denjenigen ein hervorragendes Argument bieten, die die Türkei nicht in der Europäischen Union wollen."
"Der Standard" (Wien)
"Die schwere innenpolitische Krise in der Türkei birgt auf mittlere Sicht weit mehr positive Chancen als zerstörerisches Potenzial. Denn ein offener Putsch in der Türkei ist heutzutage ebenso wenig realistisch wie die Errichtung einer sunnitischen Theokratie. 'Erdogan ab in den Iran' - einer der Slogans bei der jüngsten Großdemonstration in Istanbul, ist, was er ist: die polemische Zuspitzung eines Richtungsstreits innerhalb der türkischen Demokratie, nicht mehr. Der politische Ausgleich wird folgen müssen, zu groß ist der Druck von außen wie von innen auf die politischen Entscheidungsträger. Die Nato und der Westen können sich keinen Obristenstaat in Südeuropa mehr leisten wie noch in den 70er-Jahren; die faktische Gründung einer islamischen türkischen Republik wäre das Aus für den EU-Beitritt."