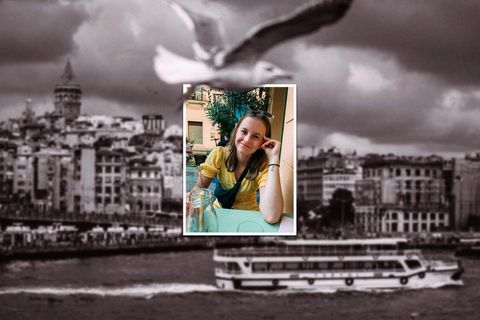Die Türken haben am Sonntag in einem historischen Referendum über die Stärkung der Macht von Präsident Recep Tayyip Erdogan abgestimmt. Der 63-Jährige sagte bei der Stimmabgabe in Istanbul, der Volksentscheid über die Einführung eines Präsidialsystems sei eine Abstimmung "über die Zukunft" der Türkei. Die umstrittene Verfassungsänderung hat das Land gespalten, die Umfragen lassen ein enges Rennen erwarten.
Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu sagte bei der Stimmabgabe in Ankara, "wir stimmen heute über das Schicksal der Türkei ab". Er hatte bei seinem letzten Auftritt am Samstag gewarnt, das neue System wäre wie "ein Bus ohne Bremsen mit unbekanntem Ziel". Die Opposition befürchtet im Fall eines Ja-Votums die Schwächung von Demokratie und Gewaltenteilung und das Abgleiten in eine autoritäre Ein-Mann-Herrschaft.
"Ich habe Nein gestimmt und hoffe, ein Nein wird aus der Wahlurne kommen", sagt der 45-jährige Nihat Aslanbay in der Kurdenmetropole Diyarbakir, wo die Wahllokale wie in den anderen Provinzen im Osten bereits um 7 Uhr öffneten. "Ein Ein-Mann-Regime wird diesem Land keinen Nutzen bringen. Ich habe Nein gesagt für eine egalitäre Verfassung, die die Kurden berücksichtigt, und für die Freiheit."
"Ein starkes Ja wird dem Westen eine Lehre erteilen"
Der pensionierte Soldat Hencer Senkom sagte in Ankara, er sei "gegen diese Regierung, weil ich ihre Weltsicht kenne". Er warf Erdogan vor, er habe weder den versprochenen Beitritt zur EU erreicht, noch den Terror im Land besiegt. Der Wähler Emrah Yerlinkaya sagte dagegen nach der Stimmabgabe in Istanbul: "Natürlich habe ich zur Unterstützung des Präsidenten gestimmt. Wenn wir heute dort sind, wo wir sind, ist es dank ihm."
Die Wähler können bis 17 Uhr Ortszeit ihre Stimme abgeben. Umfragen lassen einen knappen Ausgang erwarten, weshalb das definitive Ergebnis wohl erst nach Auszählung aller Stimmen am Abend feststehen wird. Ministerpräsident Binali Yildirim versicherte bei der Stimmabgabe im westtürkischen Izmir, "der Wille des Volkes wird respektiert werden", egal ob das Ja oder das Nein siege.
Der Vorsitzende der ultrarechten MHP, Devlet Bahceli, der Erdogan bei der Reform unterstützt, bezeichnete das Votum als "wichtigen Wendepunkt im Leben unseres Volkes und der Türkei". Erdogan hatte sich bei einer seiner letzten Wahlkampfauftritte in Istanbul zuversichtlich gezeigt, dass das Ja siegt. "Wir dürfen aber nicht träge werden. Ein starkes Ja wird dem Westen eine Lehre erteilen", sagte er.
Erdogan auf Konfrontationskurs mit Europa
Der Wahlkampf hat die Beziehungen zu den EU-Partnern auf einen Tiefpunkt sinken lassen, nachdem Erdogan Deutschland und den Niederlanden nach der Absage von Auftritten türkischer Minister Nazi-Methoden vorgeworfen hat. Erdogan bezeichnete Europa als "verrottenden Kontinent" und kündigte an, das Verhältnis nach dem Referendum auf den Prüfstand zu stellen.
Der Wahlkampf hat zu einer beispiellosen Mobilisierung, aber auch zu einer starken Polarisierung des Landes geführt. Obwohl Erdogan als Präsident zur Neutralität verpflichtet ist, tourte er über Wochen unermüdlich durch das Land, um auf dutzenden Kundgebungen für das Präsidialsystem zu werben. Das Fernsehen übertrug sämtliche Auftritte der Ja-Kampagne, während Straßen und Plätze mit ihren Transparenten behängt waren.
Die Nein-Kampagne, die die kemalistische CHP, die prokurdische HDP ebenso wie zivilgesellschaftliche Initiativen und Teile der Nationalisten vereinte, war dagegen deutlich weniger sichtbar. Ihre Vertreter beklagten Einschränkungen und Benachteiligung in den Medien. Auch die Wahlbeobachter der OSZE kritisierten, dass keine fairen Bedingungen im Wahlkampf geherrscht hätten.