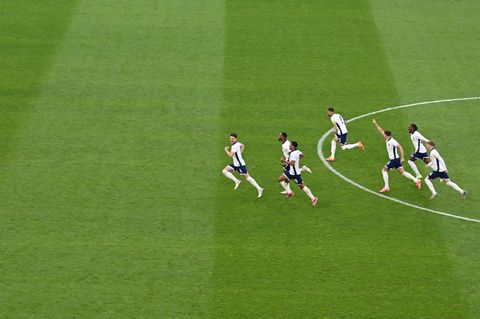Nach den strengen Gesetzen der Vexillologie ist Sloweniens Staatsflagge ein Ding der Unmöglichkeit. "Weiß als Farbe für den Berg im Wappen verbietet sich, das Symbol für das Wasser hat eine Linie zu wenig, und der rote Rand ist indiskutabel", sagt Professor Peter Klasinc, Sloweniens höchste Instanz in Sachen Flaggenkunde. Der 57-Jährige ist im Auftrag des Parlaments seit drei Jahren damit beschäftigt, fürs Vaterland eine neue Flagge zu finden. Pünktlich zum EU-Beitritt soll ein überarbeitetes Banner flattern. Klasinc stöhnt: "Das Schlimmste an der alten Flagge ist, dass sie so oft mit der russischen und der slowakischen verwechselt wird."
Schlimm genug, dass US-Präsident George W. Bush Slowakei sagt, wenn er Slowenien meint. Auch die Post stellt dem slowenischen Präsidenten jede Woche säckeweise Briefe zu, die an das slowakische Staatsoberhaupt adressiert sind. Künftig soll den slowenischen Würdenträgern wenigstens die Schmach erspart bleiben, bei Staatsbesuchen oder Siegerehrungen vor dem falschen Tuch strammstehen zu müssen.
Gerade musste Vexillologe Klasinc mit einer fünfköpfigen Jury unter 40 Vorschlägen eines landesweiten Wettbewerbs eine Auswahl treffen. Und wenn es ums Nationalgefühl geht, sind schnell Empfindlichkeiten berührt. Aber er sagt: "Ich bin begeistert, an einem neuen Symbol der nationalen Identität mitwirken zu dürfen."
Von der Provinz zum Musterländle
Es ist die Identität eines Staates, den es so nie gab. Zumindest nicht in den letzten 1000 Jahren. Das heutige Slowenien war Provinz der k. u. k. Monarchie, dann Provinz des Königreichs Jugoslawien, später Teilrepublik von Titos Jugoslawien. Heute ist Slowenien das Musterländle unter den neuen EU-Mitgliedern. Das Problem der Slowenen ist, dass kaum einer dies weiß.
Dabei haben sie, gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, schon fast den Standard Griechenlands und Portugals erreicht. In Sachen Lebensstandard liegt das Land südlich von Österreich und östlich von Italien sogar vor dem Regierungsbezirk Dresden und nur kurz hinter Leipzig. Da schmerzt es die Slowenen, dass ihr Land bei den regelmäßigen Erhebungen der EU immer als jenes Land genannt wird, das in der Gemeinschaft am wenigsten willkommen sei.
"Hinter den Antworten steckt pure Ignoranz", schimpft Janez Potocnik, 45, der Europaminister des Volkes, in dessen Umgangssprache sich so urdeutsche Wörter wie Phasenprüfer, Sicherheitsnadel, Hebel, Blinker, Bohrmaschine oder Kloster eingenistet haben. Ein Land, nicht ganz so groß wie Hessen, aber mit nur zwei Millionen Einwohnern, die so unterschiedliche Dialekte sprechen, dass sie einander manchmal nur mit Mühe verstehen. Ein moderner Staat, in dem man auch tagsüber verpflichtet ist, mit eingeschalteten Scheinwerfern Auto zu fahren, beim Parken die Fenster verschlossen zu halten, und in dessen Hauptstadt Ljubljana die Mieten so hoch sind wie in München. Ein Land, in dem, seit neuestem, Alkoholkonsum im Büro verboten ist, das nach Litauen und Ungarn die weltweit höchste Selbstmordrate aufweist und das stolz darauf ist, Heimat der fleißigsten Biene der Welt zu sein, der apis mellifera carnica.
Aus seinen großen Zielen macht der Zwergstaat kein Hehl. Der Vorsitzende der Staatsversammlung, Borut Pahor, formulierte es am letzten Nationalfeiertag in Frageform: "Nachdem wir uns bislang bemüht haben, einer der höchstentwickelten EU-Kandidaten zu sein, wäre dann das Ziel, im Jahr 2015 einer der höchstentwickelten EU-Staaten zu sein, zu ehrgeizig?" Die Frage war rein rhetorisch. Denn selbstverständlich wollen sie das packen.
Hohe Qualitätsstandards bei relativ niedrigem Lohnniveau
"Diese Losung gefällt mir sehr gut für unser Land", sagt Iztok Seljak, der Vizepräsident von Hidria, einem der Paradebetriebe der jungen Republik. Die 2500-Mann-Firma liefert Elektromotoren, Ventilatoren für Klimaanlagen und Vorwärmglühkerzen für Dieselmotoren an Kunden wie Buderus, Kärcher, Stihl, Bosch und den französischen Bosch-Konkurrenten Valfond. Ein Essen mit den französischen Kunden im firmeneigenen Schlösschen hat Seljak soeben hinter sich. "Mit denen habe ich einen Zwölf-Millionen-Euro-Vertrag für die nächsten drei Jahre abgeschlossen", sagt er und berichtet stolz, dass sich der Umsatz seiner Firma in den vergangenen drei Jahren verdoppelt hat. So soll es weitergehen. Hoffnungen sind berechtigt. Jetzt, da die Industrie im alten Europa Slowenien als zuverlässigen Zulieferer von Nischenprodukten entdeckt hat, der hohe Qualitätsstandards bei immer noch relativ niedrigem Lohnniveau hält, stehen die Zeichen auf Grün. "Früher war es fast unmöglich, Geschäftsleute aus dem Ausland hierher zu bekommen.
"Die dachten immer, bei uns tobt der Jugoslawienkrieg", sagt Manager Seljak und lässt sich einen heimischen Rotwein dekantieren. "Das ist der Wein, von dem sogar unsere Franzosen beeindruckt sind. Mittlerweile kommen die gerne", sagt Seljak. Die Anreise ist kurz, die Angst verflogen. "Zum Flughafen Venedig sind's von hier aus gerade mal zwei Stunden." Die Niederlassungen in Holland und in Ecuador produzieren schon. Expansion steht auf dem Programm. Dividende? Fehlanzeige. Gewinne werden sofort wieder investiert.
Im Land herrscht Aufbruchstimmung. Der Ski-Hersteller Elan stand vor drei Jahren noch kurz vor dem Bankrott. Nun rettet ein knallhartes Management die Firma, die für den slowenischen Nationalstolz so große symbolische Bedeutung hat wie Mercedes für Deutschland. Gearbeitet wird auf Erfolgsbasis. Geht's gut, bekommen die Manager einen Großteil des Gewinns. Läuft's schief, gehen sie leer aus. Die Produktion verdoppelte sich in den vergangenen zwei Jahren. Beim Küchengerätehersteller Gorenje, dessen Produkte Quelle in Deutschland unter der Marke "Privileg" vertreibt, verdoppelte sich der Umsatz in den vergangenen sieben Jahren.
Wie bei Elan wird auch hier immer mehr Geld in Forschung, Marketing und Entwicklung gesteckt. Designer, die sonst Nobelkarossen von Lamborghini und Ferrari den Look verpassen, möbeln die Kühlschränke und Tiefkühltruhen optisch auf. "Wir kombinieren deutsche Qualität und Latin Flavour", sagt der Vorstandsvorsitzende Franjo Bobinac. Er hat in Harvard studiert und in Paris gearbeitet, spricht akzentfrei Italienisch und Deutsch. Vor kurzem hat er Produktionsverträge mit Bosch und Siemens unterzeichnet. "Wir haben das alles geschafft, obwohl mit dem Zusammenbruch Jugoslawiens unser wichtigster Markt plötzlich völlig verschwunden war", sagt Bobinac.
Initialzündung für den Zerfall Jugoslawiens
Der Boykott der jugoslawischen Zentralregierung gegen slowenische Produkte begann schon, ehe die Slowenen am 23. Dezember 1990 per Volksentscheid für die Unabhängigkeit votierten - Initialzündung für den Zerfall Jugoslawiens. Mit deutlichen Anleihen beim deutschen Grundgesetz zimmerten Intellektuelle eine neue Verfassung für den abtrünnigen Staat, über dem noch am Abend der Gründungsfeierlichkeiten Milosevics Militärflugzeuge kreisten.
Es grenzt an ein Wunder, dass der Unabhängigkeitskrieg nur zehn Tage dauerte. Kein jahrelanges Blutvergießen wie später im zerfallenden Restjugoslawien. Das Land hat die Kämpfe ebenso unbeschadet überstanden wie die Vertreter der herrschenden Klasse, deren Repräsentanten sich zum großen Teil seit gemeinsamen Kindergartentagen kennen. "Die neue Elite ist die alte Elite", sagt der Münchner Slawistikprofessor Peter Rehder. "Selbst die neuen Führungskräfte sind im alten System ausgebildet und ideologisch geprägt worden." Getrimmt und geformt an Universitäten im Ausland oder auf der eigenen Business School im idyllischen Bergdörfchen Bled, wo schon zu alten Zeiten die besten Professoren aus der ganzen Welt kommunistische Kader in die Kunst einwiesen, mit Aktien zu jonglieren, verschachtelte Firmenimperien zu basteln und Gewinne zu optimieren.
Als im Rahmen des Privatisierungsgesetzes von 1993 jeder Staatsangehörige Anteile an den Unternehmen bekam, die ehedem als "gesellschaftliches Eigentum" galten, war ihre Stunde gekommen. Die meisten Arbeiter verkauften ihre Aktien schnell wieder, oft unter Wert und oft ans eigene Management. Mitunter sind Besitzverhältnisse so verschleiert, dass es ausländische Investoren das Fürchten lehrt. So wie den belgischen Brauerei-Multi Interbrew, dessen gescheiterter Versuch, die slowenische Union-Brauerei zu schlucken, "eine Vorschau sein kann auf das, was da noch lauert", wie das "Wall Street Journal" schreibt.
"Der Privatisierungsprozess war eine Katastrophe. Da hat sich eine Clique systematisch bereichert", sagt Professor Rehder. Selbst Milan Kucan, ehemals Chef des Bundes der Kommunisten Sloweniens und später zweimal hintereinander Ministerpräsident der ersten "Republik Slowenien", gesteht Versäumnisse ein. "Die größte Sünde, das moralisch am meisten Verwerfliche ist, dass sich manche Manager mit den Anteilen der Arbeiter bereichert haben", sagt der 63-Jährige, den viele noch immer als "Herr Präsident" anreden. "Mangelnde Transparenz ist ein großes Problem."
Nationalstolz durch Wirtschaftswunder
Doch Skandale und Skandälchen versanden im lahmen, korrupten Justizapparat, der auch von der EU stets bemängelt wird. Kritische Berichte gehen im frisch erwachten Nationalstolz unter, der sich vornehmlich auf das Wirtschaftswunder stützt, das bis vor kurzem bei fünf Prozent Wachstum jährlich lag. Geschafft, ohne dass ein großer Bruder vom Westen Geld ins Land geschaufelt hätte. Unter der Ägide jener Leute, die schon unter Tito dafür gesorgt hatten, dass die Slowenen zum Shopping nach Triest fahren konnten. Denen traut man weiterhin einiges zu, auch wenn Einkaufen in Triest für viele heute unerschwinglich ist.
Die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern geht durch viele Familien. Da sind Selfmade-Männer wie der Informatiker Marko Kolbl, 36, der seit der Unabhängigkeit mit Plakatwänden im ganzen Land gute Geschäfte macht und sich zu den Glücklichen der neuen, jungen Selbstständigen zählen darf. Seine Mutter zog sich wie Tausende von Landsleuten aus "gesundheitlichen Gründen" in den vorzeitigen Ruhestand zurück.
Sie klagt nicht über ihre kärgliche Rente, obwohl ihr die Teuerung zu schaffen macht. Die Arbeiter nehmen vieles hin, wenn sie nur ihren Job nicht verlieren. Nullrunden sind völlig normal, ebenso die bis zu 50 Prozent Abzug vom ohnehin schmalen Lohn, der nicht nur ihre soziale Absicherung speist, sondern auch den riesigen Staatsapparat und 500 000 Pensionäre, ein Viertel der Bevölkerung.
An den Zufahrtsstraßen jeder größeren Stadt salutieren die Autohäuser in funkelnden Glaspalästen, Obi-Märkte und Gartenzentren. In den Innenstädten locken Benetton und H&M, Designer-Läden und Nobelfriseure, Filialen der Fischkette Nordsee. Slogan: "Jetzt auch hier". In den angesagten Kneipen, in denen es auch nach Mitternacht noch mal eine Happy Hour gibt, tanzen die jungen Erfolgreichen. Viele von ihnen haben längst ihr Ferienhaus in Kroatien. Oder ein Boot. Oder beides. Da verhallen Stimmen der Oppositionellen wie Rudi Seligo, der vom Erfolg der Revolution nicht mehr so überzeugt ist. "Wir haben die Demokratie erkämpft", sagt er. "Aber es gibt sie nur auf dem Papier, nicht im Parlament. Die Leute mit wirtschaftlicher Macht haben auch das politische Ruder fest in der Hand." Er darf das ungestraft sagen. Und auch schreiben. Doch seine Zeitschrift "Nova Revija", die den Umsturz mit herbeigeschrieben hat, findet gerade noch 1500 Abonnenten.
Ein Extremskifahrer als Held der Nation
"Es ist ein Klima, in dem ganz besondere Leistungen möglich sind. Wir wollen, dass man Slowenien über die Grenzen hinaus wahrnimmt. Wir wollen zeigen, wozu wir fähig sind", sagt der Extremskifahrer Davo Karnicar, 41. Er ist ein Held der Nation, der erste Nicht-Politiker, der im eigenständigen Slowenien zur Persönlichkeit des Jahres gewählt wurde. Zuvor hatte der ehemalige Kommunisten-Chef Milan Kucan den Titel achtmal in Folge eingeheimst. Bis Karnicar vom Mount Everest zurückkehrte, als erster Mensch, der vom höchsten Gipfel der Erde auf Skiern abgefahren war, ohne auch nur das kleinste Teilstück auszulassen. "Das Risiko war nicht kalkulierbar. Eigentlich bescheuert", sagt der Nationalheld. "Ein Franzose, dessen Vater zu Hause ein Hotel hat, macht so was nicht. Da musst du hungrig sein."
Hungrig ist er immer noch. Er hat zwar eine Verdienstmedaille bekommen. Aber er lebt mit Frau und fünf Kindern immer noch auf 52 Quadratmetern. Zu einem Kredit für den Aufbau einer Bergsteigerschule konnte er die staatlichen Banken nicht bewegen. Noch heute ist es von Bedeutung, heißt es, auf welcher Seite die Vorfahren im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Für Hitler. Oder für die heldenhaften Partisanen. Oder überhaupt nicht.
In den Bergen versteckte Krankenhäuser für die Partisanen gelten als nationales Heiligtum, sind Pilgerstätten für die patriotisch gesinnten Slowenen. Die meisten von ihnen bekunden ihre Heimatliebe mit dem Aufstieg zum 2864 Meter hohen Triglav, dem höchsten Berg des Landes. Erst wer da oben stand, sagt man, ist ein richtiger Slowene. Manchmal stauen sich schon morgens um acht Uhr 400 Alpinpatrioten am Gipfelgrat.
Beschaulichkeit und landschaftliche Vielfalt
Trotz hoher Gagen hat die europäische Union Probleme, Dolmetscher für Slowenisch nach Brüssel zu locken. Die Menschen bleiben am liebsten in ihrem kleinen Land, in dem sie auch aus dem entlegensten Winkel in rund zwei Stunden das Meer oder alpines Gebirge erreichen können. Sie lieben die Beschaulichkeit und die landschaftliche Vielfalt, in der auch Touristikexperten Potenzial entdecken, einen Markt vor allem für Individualurlauber. Noch sind es nur 60 000 Ausländer jährlich, die Slowenien gezielt als Ferienort ansteuern. Das Gros, mehr als eine Million, brettert auf gepflegten Autobahnen mit modernen Leitsystemen durch nach Kroatien. Staumeldungen im Autoradio gibt's in drei Sprachen, auch auf Deutsch.
Die Transitreisenden verpassen eine Menge. Den kitschig schönen See bei Bled mit Alpenkulisse und königlichem Golfplatz. Knapp 6000 Karsthöhlen, von denen etliche zu den schönsten und größten Europas zählen. Das Hafenstädtchen Piran mit venezianischem Flair. Das Pferdegestüt in Lipica, das gerade darum kämpft, den Herkunftsnamen auch im vereinten Europa führen zu dürfen. Die Kneipe der Brüder Avsenik in Begunje, Geburtsstätte der Oberkrainer-Musi, zu der täglich drei Busse mit Volksmusikfreaks aus aller Welt angekarrt werden. Die Hauptstadt Ljubljana, laut einer slowenischen Internetumfrage für Singles der attraktivste Platz Europas. Oder die Weinberge bei Maribor und Jeruzalem, wo die Winzer von einer Karriere wie Ales Kristancic träumen.
Der 42-Jährige ist der Star unter den Weinbauern des Landes. In Szene-Restaurants in Manhattan wird sein Wein mitunter für 150 Dollar entkorkt. Nur 700 Meter sind's bis zur italienischen Grenze von Kristancics stattlichem Landsitz im toskanischen Stil. Ausladende Terrasse, Blick über das Tal, stets ein wenig Wind. "Qualität ist immer gefragt", sagt der Hausherr, der das Glück hat, dass sein Vater schon zu Zeiten des Sozialismus privat wirtschaftete und mehr auf Klasse als auf Masse achtete. Er muss gehen, der Landvermesser kommt. Gerade ist er dabei, dem staatlichen Weingut weitere drei Hektar Rebland abzukaufen. Fotos sind jetzt unerwünscht, bitte kein Aufsehen.
"Die Orientierungslosigkeit ist groß"
Aufmerksamkeit genießt er mehr, als ihm lieb ist. Vor allem bei den heimischen Bauern, deren Betriebe meist kleiner als zehn Hektar sind, nie und nimmer konkurrenzfähig im europäischen Markt. "Fast alle werden gezwungen sein, ihre Produktion entweder ein- oder vollkommen auf Nischenprodukte umzustellen", sagt Agraringenieur Georg-Roland Mull, 59, im Auftrag der deutschen Landwirtschaftministerin in Slowenien als Berater unterwegs. Ein gefragter Mann. Noch sind die Kassen der EU für Anlaufhilfen oder Umstrukturierungen offen. Geld fließt zum Beispiel an Neu-Winzer für den Bau von Gästezimmern oder Ferienwohnungen, weil im Land als weiterer touristischer Anreiz eine Weinstraße entstehen soll. "Möglichkeiten für die Landwirte sind da, doch den Bauern geht der Arsch auf Grundeis", sagt Mull. "Die Orientierungslosigkeit ist groß."
Auch bei der Frage, welche Flagge die Slowenen künftig hissen wollen, ist das Hin und Her noch nicht zu Ende. Von prominenter Seite bekommen die Erneuerer Gegenwind. Ex-Präsident Milan Kucan will am alten Staatssymbol festhalten. Er habe sich bereits mit den Präsidenten Russlands und der Slowakei ausgetauscht: "Putin hat gesagt, dass es ihm völlig egal ist, wenn es ab und an zu Verwechslungen kommt. Und der slowakische Präsident hat mir versichert, dass es seinen Landsleuten manchmal ganz angenehm ist, mit den Slowenen verwechselt zu werden."