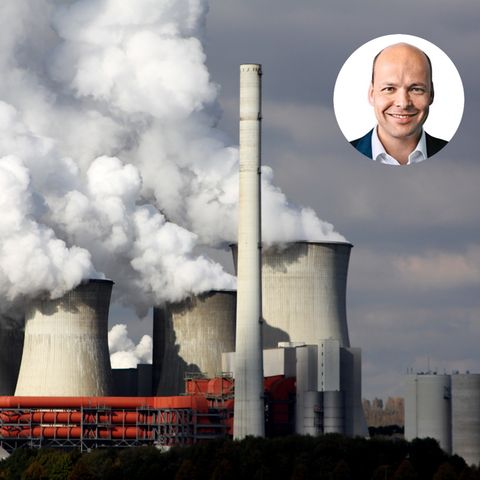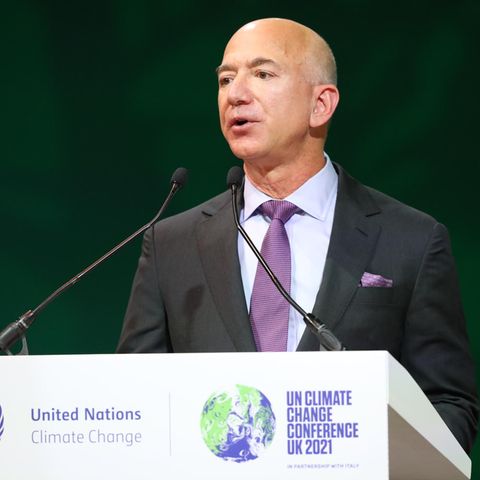Die COP26 in Glasgow ist Geschichte – und die Reaktionen könnten unterschiedlicher kaum sein. Diejenigen, die angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise sozusagen die Rettung der Welt erwartet hatten, reagierten zutiefst enttäuscht. Von "Blablabla" (Greta Thunberg) und "Betrug an allen jungen Menschen auf dieser Welt" (Luisa Neubauer) sprachen beispielsweise Aktivistinnen von "Fridays for Future". Fachleute, die wissen, welche dicken Bretter auf den Weltklimagipfeln gebohrt werden müssen, um die zahllosen Interessen von fast 200 teilnehmenden Nationen unter einen Hut zu bringen, betonen dagegen lieber die Fortschritte. Denn die habe es in Glasgow durchaus gegeben. Doch reichen sie aus, um die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß einzudämmen?
COP26: Beschlüsse reichen nicht aus
Zumindest in diesem Punkt dürften sich Verhandlungsdelegationen, Aktivist:innen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch die Politik weitgehend einig sein. Dass auf Grundlage der Beschlüsse von Glasgow das angestrebte Klimaziel aus dem Pariser Abkommen von 1,5 Grad globaler Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Epoche verfehlt wird, bestreitet niemand ernsthaft. "Wir dürfen uns nichts vormachen: Wir haben den Klimawandel nicht geschlagen", konstatierte Großbritanniens Premier Boris Johnson zum Ende der COP26 am Freitag, äußerte aber zugleich die Hoffnung, "dass wir auf die COP26 in Glasgow als Anfang vom Ende des Klimawandels zurückblicken werden."
Woher nimmt Johnson diese Hoffnung? "Dieser Klimagipfel hat schon das erreicht, was so ein Gipfel erreichen kann", stellte Klimaforscher Niklas Höhne vom New Climate Institute, Co-Autor der Weltklimaberichte, im Deutschlandfunk fest. Es habe eine Fülle von Initiativen und Ankündigungen gegeben, diese hätten "einen Schubs gegeben", dass sich etwas bewegen könne, und auch die Abschlusserklärung sei für die Umstände, unter denen sie zustande komme, nämlich "dass da 190 Staaten allem, jedem Komma zustimmen müssen, dafür ist sie stärker als ich das gedacht hatte", ordnete Höhne die Glasgower Beschlüsse in den Rahmen von UN-Verhandlungen ein. Er stellte aber auch unumwunden fest: "Damit haben wir das Problem nicht gelöst. Bei weitem nicht gelöst. Es war nur ein ganz ganz kleiner Schritt, und eigentlich müsste die Welt in den Notfallmodus schalten."
Fortschritte, aber kein Notfallmodus
Doch davon kann keine Rede sein. Und aus der Perspektive der ärmeren Länder und Inselstaaten, die schon jetzt vom steigenden Meeresspiegel überspült werden oder unter vom menschengemachten Klimawandel verstärkten Dürren oder Unwettern akut leiden, ist der Glasgower Gipfel schon allein deshalb gescheitert. "Die COP26? Big failure", stellte die namibische FFF-Aktivistin Ina Maria Shikongo in der "taz" fest. "Warum können einige Länder weitermachen, wie sie wollen, und andere leiden? Inseln wie Tuvalu, die saufen gerade ab." Es seien mehr Klimasünder auf der COP gewesen als Betroffene. "Amazon-Gründer Jeff Bezos und andere solche Leute waren da. (...) Sie sind doch der Grund, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht schaffen", so Shikongo.
Weder die 1,5 Grad noch die im Pariser Abkommen als Mindestanforderung notierten "deutlich unter 2,0 Grad". "Wir sind immer noch auf dem Weg in Richtung 2,7 Grad Erderwärmung", ging auch Greta Thunberg am Sonntagabend im schwedischen Fernsehen SVT mit den Gipfelbeschlüssen hart ins Gericht. "Wir sind weit von dem entfernt, was nötig ist." Zwar sei die in Glasgow erzielte Verständigung zum Kohleausstieg und der Wille zum Absenken des weltweiten Treibhausgas-Ausstoßes um 45 Prozent bis 2030 ein guter Anfang, so die 18-jährige Begründerin der "Fridays for Future"-Bewegung. "Aber wir müssen verstehen, dass es bei der Klimakrise um Zeit geht. Natürlich können wir kleine Fortschritte machen und langsam gewinnen. Aber das ist genau das Gleiche wie zu verlieren."
Ganz oder gar nicht keine Alternative
Eine Einschätzung, die Klima-Unterhändler:innen und Politiker:innen in dieser Absolutheit in aller Regel nicht teilen. Ihre Argumentation: Jeder kleine Schritt bringe die Welt im Kampf gegen die Klimakrise zumindest etwas voran. Ein Ganz oder gar nicht sei keine Alternative und würde die Situation nur verschlimmern. So gilt den meisten Beobachtern bei aller Kritik die COP26 unter dem Strich durchaus als Erfolg, weil auf dem Gipfel in einigen Punkten wichtige Weichen gestellt worden seien. Dazu gehören:
- Abschied von der Kohleverbrennung erstmals Konsens
- Ausstieg aus Subventionen für Öl, Gas und Kohle
- Klares Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel
- Aus für Benzin- und Dieselautos bis 2040
- Stopp von Öl- und Gasproduktion
- Absenken des Methan-Ausstoßes um 30 Prozent
- Ausstieg aus der Entwaldung
Alle Punkte gelten als entscheidender Fortschritt; der Teufel liegt im Detail: So erreichten China und Indien beim Kohleabschied im Schlussabkommen eine Umformulierung von "Ausstieg" auf den weicheren "schrittweisen Abbau". Bei einigen Punkten fehlen konkrete Zeitvorgaben. Ein Ausstieg aus der Entwaldung, dem sich sogar Brasilien anschloss, wurde 2014 schon einmal beschlossen – ohne Wirkung. Dass es diesmal anders kommt, gilt als fraglich. Und was das Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel angeht: War das nicht ohnehin klar? Die öffentliche Debatte erzeugte diesen Eindruck, laut Pariser Klimaabkommen ging es bisher aber um ein Ziel deutlich unter 2,0 Grad. Dass dies nicht ausreicht und nun der im Abkommen als "ideal" notierte Wert von 1,5 Grad angestrebt werden soll, gilt daher als Fortschritt. Ebenso wie das Bekenntnis von sechs großen Autoherstellern, darunter Mercedes und Ford, zum Verbrennerausstieg bis spätestens 2040. "Gut ist, dass Klimaneutralität nun anerkannt und damit jetzt zur Norm wird", bilanzierte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Montag.

Staaten müssen ambitionierter werden
"Diese COP hat Fortschritte gebracht und liegen gebliebene Aufgaben erledigt. Entscheidend ist aber, was jetzt in der Umsetzung passiert", sagte Hans Pörtner, Co-Chef der Arbeitsgruppe Impact, Anpassung und Vulnerabilität beim Weltklimarat der "taz". Wie schwierig diese Umsetzung sei, könne man auch in Deutschland immer wieder sehen. Dass einige der größten Klimasünder wie Russland oder China kaum oder nur eine deutlich geringe Bereitschaft zeigen, die Norm der Klimaneutralität zu erfüllen, gilt als eines der größten Hindernisse beim Kampf gegen die Klimakrise. Pörtner: "Eine Steigerung der Ambitionen weltweit ist überlebenswichtig."
Quellen: Homepage COP26; Deutschlandfunk; "taz"; Nachrichtenagentur DPA