Dieser Text beruht zum größeren Teil auf einem Auszug aus dem neu erschienenen Buch des Reporters Martin Debes: „Deutschland der Extreme. Wie Thüringen die Demokratie herausfordert.“ Ch. Links Verlag, 278 Seiten, 20 Euro.
Im September dieses Jahres steht die bundesrepublikanische Demokratie vor ihrem wohl bisher größten Härtetest. Bei den sogenannten „Ost-Wahlen“ könnte die AfD stärkste Kraft werden, womöglich sogar die Macht übernehmen.
Aus Westdeutschland wird zumeist mit Unverständnis, wenn nicht gar mit Verachtung auf diese prekäre Lage geschaut. Warum nur, wird gefragt, müssen die Ossis immer Ärger machen?
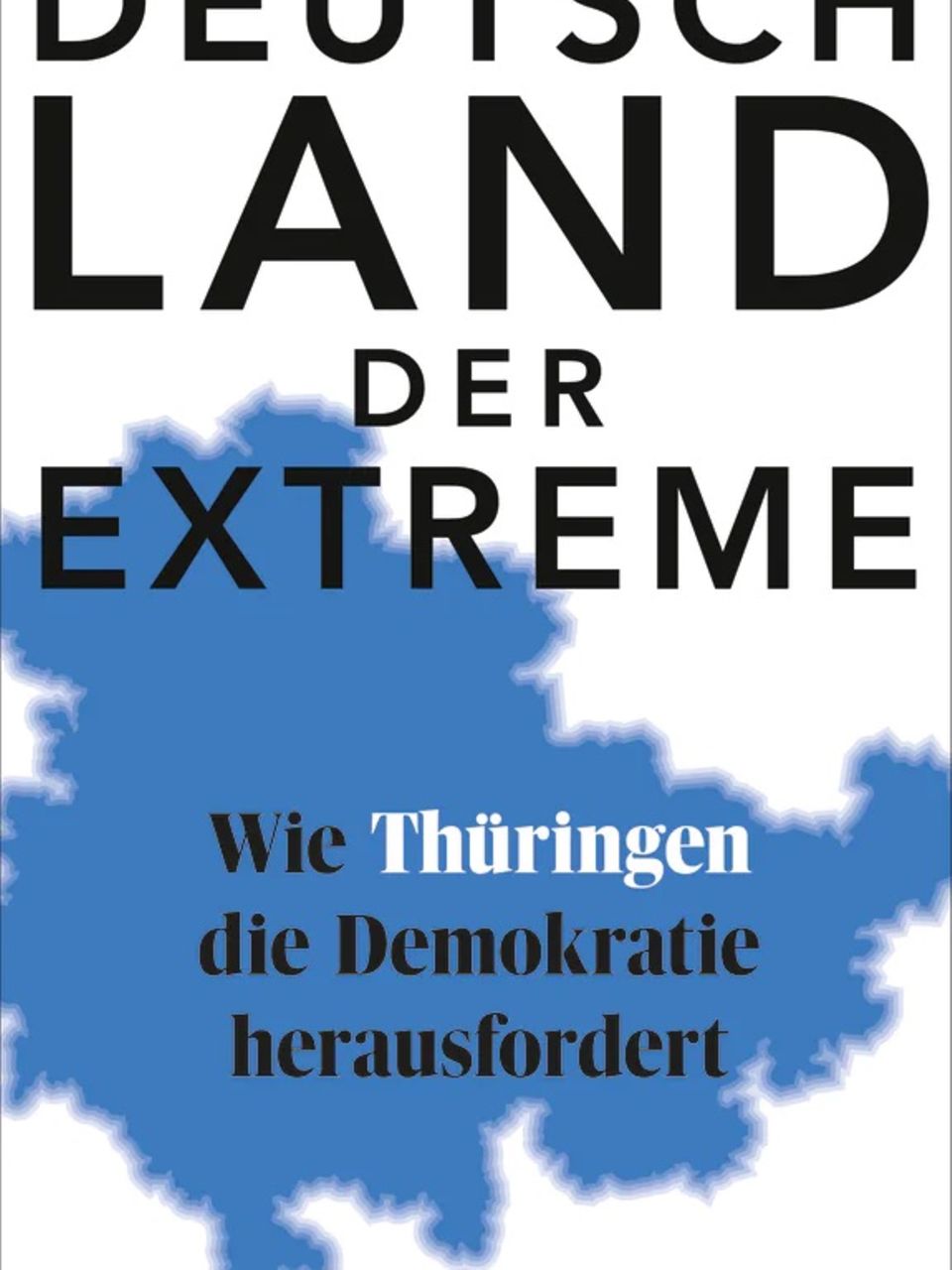
Doch um darauf Antworten zu finden, sind präzise Betrachtungen statt Pauschalurteilen nötig. Dies beginnt schon mit dem geradezu gedankenlosen Begriff „Ost-Wahlen“. Ostdeutschland ist kein homogenes Gebiet. Es ist auch kein bloßes Beitrittsgebiet und schon gar keine „frühere DDR“. Die drei Länder, um die es geht - Sachsen, Thüringen und Brandenburg - sind in ihrer langen Geschichte und politischen Konstellation ziemlich unterschiedlich. Was sie allerdings eint, ist die gemeinsame Erfahrung von realsozialistischer Diktatur und turbokapitalistischer Transformation.
Nur so, durch die differenzierte Betrachtung, ist auch der Sonderfall Thüringen zu erklären, in dem der einzige Ministerpräsident der Linken, Bodo Ramelow, mit Björn Höcke einem der extremsten und einflussreichsten AfD-Politiker gegenübersteht – und in dem die CDU erneut die Gefahr droht, zwischen beiden Polen zerrieben zu werden. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es nach der Wahl wieder nur für eine instabile Minderheitsregierung reichen wird.
Man kommt an den Folgen der Wendejahre nicht vorbei
Diese Selbstblockade hat längst nicht nur mit den Handelnden in Erfurt zu tun. Die zeitweise Stärke der PDS, später der Linken, sowie das aktuelle Momentum der AfD liegt in Entscheidungen in Bonn und später in Berlin begründet. So wenig die Ostdeutschen an der Administration der Wiedervereinigung beteiligt waren, so unterrepräsentiert sind sie bis heute. Ramelow etwa stammt aus Niedersachsen, Höcke aus Nordrhein-Westfalen. Auch die meisten anderen Spitzenkandidaten für das Thüringer Parlament wurden in der alten Bundesrepublik geboren.
Das ist kein Zufall, sondern hat System, wie ein Blick in die Geschichte zeigt.
Alles begann formal am 3. Oktober 1990 mit dem Beitritt der sogenannten neuen Länder zum Bundesgebiet nach Artikel 23 des Grundgesetzes: Quasi über Nacht ist das Gebiet, das 40 Jahre lang DDR hieß, Teil des rechtlichen, sozialen und ökonomischen Systems des Westens – einschließlich dessen Institutionen, von denen sich keine einzige im Osten befindet. Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat sitzen in Bonn. Das Bundesverfassungsgericht befindet sich in Karlsruhe, die Bundesbank in Frankfurt am Main. Auch alle Bundesbehörden operieren von Westdeutschland aus.
Gleichzeitig beginnt ein Elitenaustausch, für den es in der Geschichte kein Beispiel gibt. Ob nun in Ministerialverwaltungen und großen Unternehmen, in Gerichten und Staatsanwaltschaften, in Zeitungsverlagen und im Rundfunk, in Universitäten und Hochschulen: Das Personal des größeren, reicheren und erfolgreicheren Teils von Deutschland übernimmt die Führung des kleineren Teils. Und dabei bleibt es auch.

Noch ein knappes Vierteljahrhundert später sind gerade einmal acht der 33 Abteilungsleiter in den Thüringer Ministerien gebürtige Ostdeutsche.Nach über dreißig Jahren stammt nur die Hälfte des Spitzenpersonals der Ministerien und der nachgeordneten Behörden aus Ostdeutschland. Im Justizbereich ist es aktuell sogar bloß ein knappes Viertel.
Gleichzeitig pumpt die Bundesrepublik damals Abermilliarden D‑Mark in Banken, Unternehmen und Sozialkassen im Beitrittsgebiet. Bis zum Jahr 2020 werden 1,6 Billionen Euro von West gen Ost transferiert. Darüber hinaus erhält der Osten viele Milliarden aus europäischen Struktur- und Sozialfonds, die wiederum zum größeren Teil aus dem Etat des EU‑Mitgliedlands Deutschland stammen. Für die Zuwendungen und Hilfen erwarten die Westdeutschen Dankbarkeit. Nur wenige reflektieren ihre privilegierte Situation. Ihr Respekt gegenüber dem Osten beschränkt sich auf die Legende der friedlichen Revolution und besitzt oft genug eine hörbar paternalistische Note.
Die Wiedervereinigung markiert den Beginn eines gegenseitigen Missverständnisses. Denn die meisten Ostdeutschen schätzen die neuen Freiheiten. Sie genießen die Vorteile des Rechtsstaats, die Öffnung zur Welt, den Zuwachs an Konsum und Wohlstand. Und ja, sie sind dankbar dafür.
Für viele war die Wende auch ein Verlustgeschäft
Was viele aber auch erfahren müssen, ist der Verlust ihres Arbeitsplatzes und – wichtiger noch – ihres bisherigen Status. Sie hatten einen respektierten Beruf, waren Brigadier, Hebamme, Ingenieur, Funktionär, Dozentin, Facharbeiter oder Chefsekretärin mit einem sicheren Auskommen. Jetzt müssen sie umschulen, in den Westen pendeln oder umziehen, um ihre schiere Existenz zu erhalten. Sie erleben, dass ihre Abschlüsse nicht oder nur bedingt anerkannt werden und dass sie als mutmaßliche Mitläufer unter Generalverdacht stehen.
Dagegen steht die Ignoranz vieler Westdeutscher, die das Reden über Abwertung und Diskriminierung als Jammern abtun. Viele wissen nicht einmal, dass der 1991 eingeführte Solidaritätszuschlag nicht direkt an den Osten überwiesen wird, sondern erst einmal im Gesamthaushalt des Bundes aufgeht – und dass der Beitrag selbstverständlich auch von allen ostdeutschen Steuerzahlern zu entrichten ist.
Währenddessen wird kaum thematisiert, wie sehr der Westen von der Vereinigung profitiert. Die Bundesrepublik überwindet 1990 ihre lähmende Rezession, weil im Osten ein schier unersättlicher Absatzmarkt entsteht. Die neuen Bundesbürger setzen den größten Teil ihrer D‑Mark in Westprodukte um, in Autos, Kühlschränke, Fernsehgeräte, Baumaterialien, Lebensmittel. Während der Osten in die Wirtschaftskrise rutscht, beginnt im Westen der Wiedervereinigungsboom. Hinzu kommt, dass dort die Lücken im Arbeitsmarkt mit gut ausgebildeten und hochmotivierten Fachleuten aus dem Osten geschlossen werden. Sie arbeiten für Einstiegsgehälter in der Industrie, im Handwerk oder im Dienstleistungssektor.
Der ostdeutsche Wanderungsverlust
Allein 1989 und 1990 ziehen etwa 800 000 Menschen aus der DDR in den Westen. Es geht vor allem der junge, gebildete und mobile Teil. Insgesamt verlassen in den ersten drei Jahrzehnten nach 1990 etwa 3 680 000 Menschen Ostdeutschland Richtung Westen.In die Gegenrichtung zieht es 2 450 000 Westdeutsche, von denen wiederum viele Führungspositionen in Politik, Verwaltung und Wirtschaft übernehmen. Sie siedeln sich eher in städtischen als in ländlichen Regionen an. Unterm Strich beträgt der ostdeutsche Wanderungsverlust gut 1,2 Millionen Menschen. In Thüringen sind es 310 000.
Nicht nur dass viele jungen Frauen gen Westen gehen: Die Zahl der Geburten pro Frau halbiert sich binnen weniger Jahre.Agrargenossenschaften, die sich aus den LPG gebildet hatten, gehen pleite. Die Treuhand zerteilt, privatisiert oder schließt die einstigen Kombinate und VEB im Akkord.
Noch im Vereinigungsjahr 1990 sinkt in Ostdeutschland die Zahl der abhängig Erwerbstätigen um 1,6 Millionen oder 18 Prozent. In Thüringen ist der Rückgang mit 21 Prozent am höchsten.Im Durchschnitt des Jahres 1991 werden dann etwa 150 000 Arbeitslose im Land registriert. Doch die Zahlen überdecken die Tiefe des Einschnitts. Denn zusätzlich zu den Arbeitslosen befinden sich rund 80 000 Menschen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen,weitere 167 000 haben eine Weiterbildung beginnen müssen.
„Da muss auch mal Blut fließen“
„In der ostdeutschen Wirtschaft muss auch mal gestorben werden“, sagt Anfang 1991 der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Horst Köhler, der später als Bundespräsident oft die Vorzüge der Einheit preisen wird. „Da muss auch mal Blut fließen.“ In Thüringen sieht das dann so aus: Die Eisenacher Wartburg-Werke entlassen 5000 ihrer 7000 Mitarbeiter. Robotron Sömmerda baut die Hälfte seiner 13 000 Mitarbeiter ab. Bei Carl Zeiss werden 15 000 Menschen arbeitslos.
Dabei ist der finale Einschlag politisch verzögert worden. Mit dem 1. Juli 1991 laufen sowohl der tariflich vereinbarte Kündigungsschutz für die Beschäftigten der früheren DDR-Betriebe als auch die im Einigungsvertrag festgelegte Warteschleife für ehemalige Staatsbedienstete aus. Der Stichtag bedeutet darüber hinaus automatisch das Aus für alle Kurzarbeiter, die jetzt auf »Null-Stunden« gesetzt werden.Spätestens jetzt laufen die Arbeitsämter über.
Neue Klein- und Kleinstfirmen entstehen vor allem im Handel- und Dienstleistungsbereich. Aber auch hier sind es hauptsächlich westdeutsche Ketten, die Supermärkte oder Filialen eröffnen sowie die alten Konsum- und HO‑Läden übernehmen oder verdrängen.
Die ostdeutsche Gesellschaft teilt sich in Gewinner und Verlierer. Mobile, eher jüngere Ostdeutsche mit einer kaum kompromittierten Vergangenheit und einer westkompatiblen Ausbildung haben die besten Chancen – und nutzen sie oft auch. Deutlich weniger Optionen besitzen Menschen jenseits der 50, die Jahrzehnte in einem VEB arbeiteten, womöglich in der SED waren und nicht so einfach den Ort wechseln können. Sie sind auch auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt nicht gefragt.
Das Enttäuschungsgefühl wird noch lange nachwirken
Die Gewinner-, aber auch die Verlierergeschichten werden sich auf die nächsten Generationen übertragen. Kinder erfahren die Arbeitslosigkeit von Mutter und Vater als eigenes Trauma. Nach den Jahren von Diktatur, Indoktrination und Mangel beginnt nun für viele Junge eine Zeit der Unsicherheit, mit Umzügen, ständig wechselnden Unterrichtsplänen und Lehrern – und Eltern, die damit beschäftigt sind, sich auf die neue Zeit einzustellen. Nicht nur an den Schulen herrscht Anarchie, die zu Gewalt und Ausgrenzung führt.
Das kollektive Enttäuschungsgefühl wird lange nachwirken – und wirkt bis heute. Wer sich fragt, warum die Ossis immer noch Ärger machen, könnte hier eine Antwort finden.
Das Buch wird am 17. April, 18 Uhr in der Berliner Landesvertretung Thüringens in der Mohrenstraße 64 vorgestellt. stern-Chefreporterin Miriam Hollstein moderiert.








