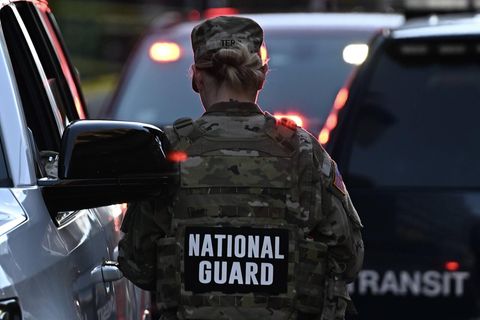Früher konnte man davon ausgehen, dass ein Stein am Wegesrand ein Stein war, ein Eisenrohr nur ein Eisenrohr und ein Schutthaufen bloß ein Schutthaufen. Heute nicht mehr. Angestrengt späht Feldwebel A. vom Beifahrersitz des offenen "Wolf "-Geländewagens in die vorbeigleitende Mondlandschaft: Sieht irgendetwas verdächtig aus? Hat sich etwas verändert? Zeichnen sich ungewöhnliche Spuren im Staub der Piste ab?
Seit Stunden ist die Patrouille in der flimmernden Vormittagshitze unterwegs in der Umgebung von Camp Marmal, dem größten Lager der Bundeswehr in Afghanistan. Ihr Auftrag: Brücken, Baustellen, Röhrenstapel zu inspizieren, alles, wo sich ein Sprengsatz unterbringen ließe. Einer dieser verheerenden Sprengsätze. Immer wieder wird angehalten, abgesessen, mustern die Soldaten die Umgebung: Fängt jemand plötzlich an zu telefonieren, sobald die Deutschen auftauchen?
Viele der Männer rauchen immerfort, es ist zermürbend, in allem Normalen die Option des Tödlichen zu sehen. Ein blaues Häufchen Elend an einem Kreisverkehr bringt die gesamte Patrouille zum Halten: eine Bettlerin in blauer Burka? Oder ein mit Burka getarnter Sprengsatz? Hektische Debatten über Funk, bis sich unter dem blauen Stoff eine dürre Hand hervorschiebt. Dabei ist Masar-i-Scharif, die Metropole des Nordens, noch der ruhigste Einsatzort der Deutschen. Hier, im Camp Marmal, wo das Gros der knapp 3500 Soldaten stationiert ist, darunter die "Quick Reaction Force", die Schnelle Eingreiftruppe, und die Tornado-Aufklärer, hat es seit zwei Jahren keinen Raketenbeschuss, keine Anschläge gegeben.
Ständige Gefahr
"Die Feindlage heute", hatte der Feldwebel die Morgenlage vor Abfahrt begonnen: "Warnungen vor einem Selbstmordattentäter, der in einem blauen Toyota Corolla herumfährt auf der Suche nach einem Ziel!" Weiterhin sei ein Mann pakistanischer Herkunft mit einer Sprengstoffweste unterwegs.
Stummes Nicken. Neun von zehn Autos in Afghanistan sind Toyotas, Modell Corolla. Und wodurch sich ein Mann pakistanischer Herkunft hervorhebt, kann auch niemand erklären. Das ist es, was das sperrige Modewort von der "asymmetrischen Kriegsführung" im Alltag der Soldaten bedeutet: Die Bauern am Wegrand grüßen freundlich. Trotzdem kann jede Erhebung ein Sprengsatz, jeder entgegenkommende Toyota eine Bombe mit lebendem Zielleitsystem sein. Die Bundeswehr ist im Jahr sieben ihres Einsatzes in Afghanistan vor allem eines - ständig in Gefahr.
Ist das Krieg? 2008 gab es mehr und technisch raffiniertere Anschläge auf die Bundeswehr als je zuvor. Auch starben seit 2002 noch nie so viele Menschen bei Gefechten und Bombardements - Afghanen wie ausländische Soldaten, auch im Norden. Doch hier führen die Taliban ihren Kampf inmitten einer Bevölkerung, von der die allerwenigsten etwas mit ihnen zu tun haben möchte.
Am 13. Oktober läuft das Mandat der Deutschen aus. Der Bundestag wird über die Verlängerung abstimmen und auch über den Regierungsantrag, das Kontingent von 3500 auf 4500 Soldaten aufzustocken. Eine Mehrheit der Bürger ist schon heute gegen den Einsatz, und jeder tote Soldat lässt die Zustimmung weiter sinken. Weshalb die Politiker, allen voran Verteidigungsminister Franz Josef Jung, immer neue Wortverrenkungen finden: Man sei nicht im Krieg, sondern im "Stabilisierungseinsatz" oder in einem robusten "Friedenseinsatz".
"Meine Freundin denkt, ich bin im Krieg"
Auf einer Patrouille in den Bergen im Nordosten wiegt ein deutscher Soldat den staubbedeckten Kopf: "Meine Freundin denkt, ich bin im Krieg. Wenn ich mit der telefoniere, glaubt sie, dass es hier andauernd kracht. Aber das tut es nicht." Am Armaturenbrett klebt trotzdem eine Christophorus-Plakette, "man weiß ja nie". 50 Stück hatte der katholische Militärpfarrer Alfons Schöpf gesegnet und verteilt, nach wenigen Tagen musste er weitere 50 Stück nachsegnen.
Im Morgengrauen sind wir vom Einsatzlager Faisabad in sechs "Wölfen", den offenen, kaum gepanzerten Geländewagen, aufgebrochen. Sichere Fahrzeuge wie die Zwölf-Tonner-"Dingos" sind in dem Gelände zu schwerfällig. Für eine Strecke von wenig mehr als 100 Kilometern werden wir 14 Stunden brauchen. Es geht darum, Präsenz zu zeigen, "show of force" nennen sie es. Außerdem ist der zuständige Offizier für zivile Projekte mit dabei, Herzen und Hirne zu gewinnen mit begrenzten Mitteln, einem Teppich für die Moschee, Möbeln für eine Schule, Hilfe im Kampf gegen die ebenso trägen wie korrupten afghanischen Behörden.
Auf dem Pfad der unkonventionellen Wortführung eröffnet Oberleutnant S. im ersten Weiler das Gespräch mit dem Malik, dem Dorfvorsteher: Nach dem letzten Krieg mit Russland sei Deutschland vollkommen zerstört gewesen - und dann habe die ganze Welt Deutschland geholfen, so zu werden, wie es heute sei. "Ah, Krieg mit Russland", der Malik nickt, und dann ist alles kaputt, jaja, das kenne er.
Die historischen Details mögen deutlich anders gewesen sein, aber das tut nichts zur Sache. Es geht darum, eine Brücke zu bauen, verständlich zu machen, was man hier überhaupt will, nämlich weder die Traditionen abschaffen noch die Macht übernehmen. Die liegt in Händen der Afghanen, ihrer Ministerien, Provinzgouverneure und Distriktverwaltungen. Deren Aufgabe wäre es, die maroden Schuldächer zu flicken, Straßen oder wenigstens Pisten zu bauen, Ärzte zu schicken, Stromleitungen zu legen, kurzum: sich zu kümmern. Daher hat die Mission der Nato ihren Namen: ISAF, "International Security and Assistance Force". Für Sicherheit soll sie sorgen und die Regierung in Kabul unterstützen.
Wenig lukrativ
"Ach, die Regierung ..." Der Malik, wie jeder im Verlauf des Tages, schüttelt traurig den Kopf, und Oberleutnant S. ahnt immer schon, was als Nächstes kommt. Ob die Deutschen nicht alles selbst übernehmen könnten? Schulen, Straßen, Strom et cetera. Die Regierung tue nichts für sie. Nordafghanistan im Herbst 2008: Einige wollen die deutschen Soldaten partout umbringen, andere wären froh, wenn sie gleich die Regierung entmachteten.
Die Bundeswehr operiert zögerlich. Es hat Jahre gedauert, bis das weitgehend gescheiterte Konzept einer Polizeiausbildung durch deutsche Polizisten geändert wurde - kaum ein deutscher Beamter wollte freiwillig nach Afghanistan, und zwingen konnte man keinen. Nun bilden Feldjäger die afghanischen Polizisten aus, in Faisabad unterrichtet ein afghanischer Staatsanwalt sie in Rechtskunde. Der Staat, dem die Deutschen eigentlich nur assistieren wollen, muss erst einmal entstehen. So wie auch das Wort vom "Wiederaufbau" irreführend ist: Mit "wieder" hat das Ganze nicht viel zu tun. Die Schulen, Straßen, Brunnen, die im Norden entstehen, hat es zuvor nicht gegeben.
Seit 2006 immerhin werden die Soldaten der Afghan National Army, ANA, auch von Deutschen trainiert. Und das nicht nur im Schießen. Unterwegs auf einer Nachtfahrt von Bundeswehrausbildern und einem Trupp ANA-Soldaten nahe Faisabad formieren sich die Soldaten zur Straßensperre. Major Heiko P. fragt den afghanischen Patrouillenführer, Leutnant Hurachip, was denn zu tun sei, wenn ein Auto nicht halte: "Na, dann schießen wir!" Worauf? "Na, aufs Auto." Der Major seufzt. "Also noch mal": Als Erstes sei ein Warnschuss in die Luft abzugeben. Dann einer auf den Motor, aber nicht gleich auf den Fahrer.
Denn da liegt die Gefahr, in die Falle der Taliban zu stolpern: Wenn jedes Auto eine potenzielle Bombe ist, wenn eine Sekunde zu spät zu reagieren den Tod bedeuten kann, dann werden in einem Moment der Angst irgendwann die Falschen getötet. So wie am 28. August nahe Kundus, als ein Feldjäger am Maschinengewehr dachte, er müsse ein angekündigtes Auto von Attentätern stoppen. Und eine Mutter mit zwei Kindern erschoss.
Kampf gegen Windmühlen
Nichts spielt den Taliban mehr in die Hände als der Tod von Zivilisten, getötet von ausländischen Soldaten. Denn die Wut der Afghanen gilt zuerst denen, die schießen. Nicht jenen, die sie dazu provozieren. Und was es heißt, verhasst zu sein, erfahren die US-Truppen tagtäglich im Süden und Osten, wo sie mit ihren Bombardements und Offensiven immer mehr Feinde schaffen als töten.
So sind die Regeln in Afghanistan. Weshalb der Kommandeur der deutschen "Quick Reaction Force" (QRF), Oberstleutnant Gunnar Brügner, den Einsatz unkonventioneller Kampfmittel erwägt: "Wir denken über Kieselsteine nach. Oder halb volle Wasserflaschen", um die auf Autos zu werfen, die nicht stoppen, "denn wenn da zehn Leute drinsitzen und auch noch Musik hören, kriegen die einen Warnschuss doch gar nicht mit!"
Die QRF hat von allen deutschen Einheiten in Afghanistan die umfangreichste Ausrüstung, bis hin zu Marder-Schützenpanzer. Sie wurde in Berichten flugs zur ersten deutschen "Kampftruppe" hochgejazzt. Aber was nützen die schwersten Waffen, wenn der Gegner - zumindest im Norden - gar nicht offen angreift?
Am nächtlichen Checkpoint in Faisabad hat Major P. seine Einweisung beendet. Nun warten alle auf ein Auto. Langsam schiebt sich ein Lichtkegel durch die Hügel, die ganze Truppe geht in Gefechtsbereitschaft. Leutnant Hurachip stoppt den verängstigten Fahrer, Major P. beobachtet aus der Ferne. Eigentlich sollte der Fahrer als Erstes den Motor ausschalten. Tut er aber nicht. Der Wortwechsel mit den afghanischen Soldaten wird lauter, bis die alarmierten Deutschen näher kommen. Doch kein Aufständischer steht da neben seinem betagten Gefährt, sondern ein Bild des Jammers: "Bitte! Bitte, wenn ich jetzt den Motor ausschalte, kriege ich ihn nie wieder an!" Major P. seufzt abermals. Ja, nun. Das sei schon okay. Sehr erleichtert tuckert der Fahrer davon.
Wenn schießen, dann sofort
Zwei Nächte später werden Raketen aufs deutsche Lager in Faisabad abgeschossen. Sie verfehlen das Camp, bis auf einen kleinen Krater nahe dem Tor bleiben selbst die Einschlagstellen unauffindbar. Glückssache, in Kundus durchschlug vorigen Herbst eine Rakete das Dach der Truppenküche.
In dieser Nacht geht es wieder hinaus, die Umgebung der Abschussstelle soll beobachtet werden. Major P. führt die deutsch-afghanische Patrouille zum Fluss, von dessen gegenüberliegendem Ufer geschossen wurde. In einer Talsenke stehen zwei "Fennek"-Panzerspähwagen mit leistungsstarken Infrarotkameras. Oben auf der Hügelkuppe liegen Scharfschützen, eingegraben seit Stunden.
Was die denn täten, wenn sie Männer sähen, die abermals Raketen abfeuerten? Allgemeine Verwunderung. "Na, was wohl? Die erschießen, natürlich!" Wobei: Das sei eine knifflige Angelegenheit. Einen Mann zu sehen, der nachts beispielsweise etwas vergräbt - kein Grund zu schießen. Habe er aber eine erste Rakete abgefeuert, sei die Lage klar. Dies sind die deutschen "Rules of Engagement": nur bei "unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben" zu schießen. Dann aber sofort.
Es ist das einzige Mal, dass Oberstleutnant Andreas Durst, der Chef des Stabes in Faisabad, seine Ruhe verliert: als wir ihn auf den ersten offiziell von deutschen Soldaten erschossenen Afghanen, einen Hirten, ansprechen und den Vorfall tragisch nennen. "Tragisch? Dagegen wehre ich mich! Der Mann hat nachts aus nächster Nähe auf uns geschossen! Pures Glück, dass er niemanden getroffen hat. Das nenne ich nicht tragisch!"
Respekt verschaffen
Es sei nicht nur richtig zurückzuschießen, sondern notwendig, urteilt Chalid Mustafawi kühl, Herausgeber der einzigen unabhängigen Wochenzeitung in Faisabad: "Sonst nimmt die Deutschen doch keiner mehr ernst!" Wenn sie Rechtssicherheit schaffen wollten, müssten die Einheimischen auch glauben, dass sie sich durchsetzen. Es ist ein schmaler Grat, auf dem die Bundeswehrsoldaten unterwegs sind. Nicht zu brutal auftreten, sich aber auch nicht wegducken.
Sie führen den Kampf gegen die Taliban, indem sie es den Afghanen überlassen, selbst zu entscheiden, in welcher Welt sie leben wollen. Schon heute ist das Land de facto zweigeteilt in einen Süden und Osten, wo unzweifelhaft Krieg herrscht, wo die Taliban das Land bis auf die großen Städte und die Überlandstraßen (und nachts oft selbst die) kontrollieren - und in den Westen und Norden, wo Schulen, Straßen, Brunnen entstehen, wo es Jobs gibt und weder die Taliban Essen, Unterkunft, Geld oder Söhne von den Bauern erpressen noch ausländische Truppen die Dörfer bombardieren. Die Afghanen stimmen mit den Füßen ab, Zigtausende ziehen in die sicheren Landesteile. Man mag es Kundus nicht ansehen, aber es ist eine prosperierende Stadt, die Märkte sind voll, und in der ganzen Provinz gehen mehr als 200.000 Kinder zur Schule - im Vergleich zu 15.000 im Jahr 2001. Eines greift ins andere: Gibt es Kleinkredite, können Bauern neues Land urbar machen, gibt es Straßen, können sie ihre Produkte zu den Märkten bringen.
Doch sind es die mühsamen Fortschritte wert, dass dafür deutsche Soldaten ihr Leben riskieren? Ein paar Tage nach dem nächtlichen Beschuss in Faisabad sprengt sich ein Selbstmordbomber wenige Meter vor einer deutschen Fahrzeugpatrouille in Kundus in die Luft, Glück und Panzerung retten die Insassen. Aber ausgerechnet vor Ort, wo die Gefahr dieses Einsatzes real ist, stellt ihn keiner infrage - nicht mal abends in der "Talibar" getauften Kneipe beim Bier. "Wir wissen, dass wir hier unser Leben lassen können", sagt ein Soldat, "aber verdammt, das ist unser Einsatz. Wir können doch nicht wegrennen, wenn wir angegriffen werden!" Dieses Dasein in andauernder Gefahr schafft eine eigentümliche Stimmung im Lager, ein trotziges Gegenhalten.
Lästiges Einmischen
Die Frustration, die spürbar ist, hat andere Gründe. Da war der Konflikt um die "Wolf "-Geländewagen, die weder den Blick nach hinten noch von den vier Sitzen ein rasches Entkommen durch die zwei Türen zuließen, weshalb die Soldaten sie auf eigene Faust umbauten. Bis die Order aus Berlin kam: Alles wieder rückgängig machen! Sonst erlösche die Garantie des Herstellers. Oder die Sache mit den Morphium-Autoinjektoren, Standardausrüstung anderer Armeen, die der Bundeswehr jahrelang verweigert wurden, weil sie gegen das deutsche Betäubungsmittelgesetz verstießen. Und zuletzt noch die Ankündigung des Verteidigungsministeriums, jenem Feldwebel, der die drei Zivilisten in Kundus erschoss, keinen Rechtsbeistand gewähren zu können, sondern höchstens ein Darlehen. Es sind die Details, die kränken, wie die Wortwahl bei Todesfällen. "Da steht dann, der sei verunglückt. Nicht gefallen", ärgert sich ein Feldwebel. "Aber wenn einer stirbt, weil ein anderer mit 100 Kilo Sprengstoff auf ihn zurast, dann ist der doch nicht verunglückt!"
"Die schicken uns hierher in einen Einsatz, der bitte schön auch so verlaufen möge, wie man sich das in Berlin gedacht hat", sagt ein Unteroffizier auf einer der langen Patrouillenfahrten: "Aber seit es nicht mehr so läuft, wollen sie damit möglichst nichts mehr zu tun haben." Was immer auch im deutschen Einsatzgebiet in Afghanistan geschehe, heißt es intern im Verteidigungsministerium, sei auf gar keinen Fall Krieg. Denn das wäre versicherungstechnisch eine ganz heikle Angelegenheit: Krieg taucht im Kleingedruckten vieler Lebensversicherungen als Haftungsausschluss auf. Also möge man doch bitte weiterhin vom Friedenseinsatz sprechen.
Am Tag der Abreise wird Camp Marmal mit Mörsergranaten beschossen. Zum ersten Mal seit zwei Jahren.