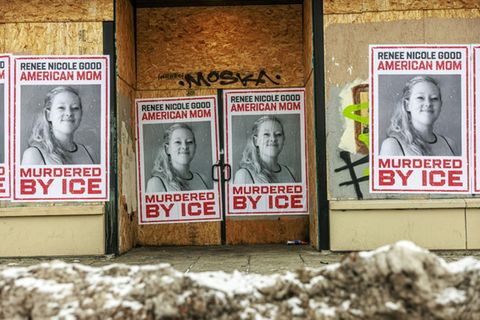Eine Terrorzelle in London? Junge Männer pakistanischer Herkunft hätten geplant, ein paar Flugzeuge in die Luft zu jagen? Da kommen Tahar, 35, die Tränen. Vor Lachen. Er sitzt mit seiner Mutter vor der großen Badshahi-Moschee in Lahore. Die beiden genießen das lange Wochenende, am Montag feierte Pakistan den 59. Jahrestag seiner Gründung. "Ist es nicht ein Zufall, dass die Engländer das Komplott genau dann aufdecken, wenn die Israelis wieder ein muslimisches Land terrorisieren?" Fakten tut er ab. Dass viele der Verdächtigen in Pakistan in Haft sind, stört Tahar nicht. Der junge Londoner, dessen Aussage die Terrorpläne in England aufgedeckt habe, sei kein Pakistani, sondern Brite. Und dass aus dessen Umfeld der eilige Auftrag kam, in London zur Tat zu schreiten? Tahar sieht das alles als Teil einer großen Intrige, gesponnen von den drei Kräften, USA, Großbritannien und Israel, die für fast alle Übel unserer Zeit verantwortlich seien.
Al Qaeda? Das sei ein Verein, den ebenfalls die Amerikaner erfunden hätten. Wenn es ihn gäbe, hätten ihn die USA mit all ihren modernen High-Tech-Waffen schon längst finden und ausschalten können. Tahar meint auch zu wissen, warum das bisher nicht geschehen ist: "Weil sie Osama bin Laden als Vorwand brauchen, um auf uns einzuschlagen."
Die Amerikaner
kontrollierten die Welt, auf ihrer Gehaltsliste ständen nicht nur die saudischen Herrscher, Ägyptens Mubarak und der König von Jordanien, sondern auch Pakistans Präsident Musharraf, "der mit Wahlbetrug an die Macht gekommen ist. Wir haben ihn nicht gewählt". Er sei eine "Marionette der USA", der sich vom korrupten Militär beschützen ließe. Lang werde er sich nicht mehr an der Macht halten: "Das Volk hasst ihn."
Tahar ist ein sanfter Mann mit leicht schütterem Haar, Buchhalter in einer Versicherung. Nein, er sei absolut kein islamischer Extremist, sondern "glatter Durchschnitt", so wie er denke "die große Mehrheit der Pakistani".
Safarish, 22, der die größte Koranschule von Lahore besucht, ist überzeugt, dass die mutmaßlichen Londoner Attentäter nur "äußerlich Muslime sind, im Inneren sind sie es nicht". Der Prophet verbiete es ihnen.
Mohammed, 53, der Leiter der Koranschule Jamia Darul Uloom, formuliert es noch schärfer. Der hagere Mann mit dem weißen Kinnbart ist verantwortlich für 900 Schüler, die in seiner Madrassa oft jahrelang kostenlos unterrichtet, gekleidet und untergebracht werden. Draußen prasselt der Monsunregen nieder, er bringt etwas Erfrischung in diesen erstickend heißen Tagen. Die jungen Männer von London, findet Mohammed, könnten keinesfalls Muslime sein, denn der "Koran sagt, wer einen Menschen tötet, bringt die ganze Menschheit um".
Nicht an allen pakistanischen Madrassas herrscht ein so friedlicher Geist. Einige hundert Kilometer weiter westlich liegt direkt an der Hauptverbindungsstraße nach Afghanistan in einem staubigen Nest die Madrassa Haqqania. Taliban-Chef Mullah Omar höchstselbst studierte einst hier, der Direktor zählt ihn bis heute zu seinen persönlichen Freunden. Gern erzählt der bärtige Ideologe, wie er seine Schützlinge über die Grenze nach Afghanistan schickte, wann immer die Taliban Kämpfer brauchten. Deren Sturz hat dem Rektor der Koranschule nichts von seinem Selbstbewusstsein genommen: "Wir sind in einer guten, starken Position. Bush hat die gesamte islamische Welt wachgerüttelt. Wir sind ihm dankbar."
Die Madrassas von Pakistan haben in den vergangenen Jahren einen wahren Boom erlebt. Weil die meisten nicht staatlich registriert sind, ist ihre Zahl unbekannt. Es gibt mindestens 10 000, möglicherweise aber bis zu 40 000 solcher religiösen Institute mit bis zu 1,5 Millionen Schülern. Immer mehr von ihnen lernen den gewaltsamen Dschihad: Einer Studie der Weltbank zufolge steht in jeder fünften Madrassa auch militärisches Kampftraining auf dem Lehrplan.
"Gelingt es uns, jeden Tag mehr Terroristen zu fangen, zu töten, abzuschrecken oder umzustimmen, als die Madrassas und die radikalen Kleriker gegen uns rekru- tieren, trainieren und ins Feld führen?", fragte US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld in einem internen Arbeitspapier. Sein politischer Ziehvater Ronald Reagan hatte die jungen Kämpfer aus den pakistanischen Koranschulen noch als "moralisch ebenbürtig mit den Gründungsvätern Amerikas" gelobt. Das war zu einer Zeit, als sich die US-Regierung über jeden Islamisten freute, der für sie in Afghanistan gegen die Sowjets kämpfte. Sie lieferte nicht nur Waffen an die Mudschaheddin, sondern sorgte auch für ideologische Aufrüstung: Ein Madrassa-Lehrbuch aus den 80er Jahren zeigt einen jungen Kämpfer, der, das Gewehr im Anschlag, fest voranschreitet, trotz abgeschossenem Kopf. Text zum Bild: "Solche Männer opfern Wohlstand und Leben, um das islamische Recht durchzusetzen." Die Kosten für Druck und Papier hatte die CIA übernommen.
Für die meisten Pakistani bieten die Koranschulen die einzige Möglichkeit, ein Mindestmaß an Bildung zu bekommen. 58 Prozent des 150-Millionen-Volkes können nicht lesen und schreiben, Tendenz steigend. Die Regierung investiert fast dreimal so viel Geld ins Militär wie in die Bildung. 15 Prozent der Schulen im Land haben kein festes Gebäude, 40 Prozent keinen Wasseranschluss, 71 Prozent keinen Strom. Eine Untersuchung im Bundesstaat Punjab ergab kürzlich, dass in 4000 von 15 000 Schulen kein Lehrer anwesend war. Viele Lehrstätten sind nur sporadisch geöffnet.
Solche Zustände sind ein Armutszeugnis für ein Land, das einst angetreten war, ein "Land der spirituell Sauberen und Reinen" zu werden. August 1947: Als die Briten ihr Kolonialreich in zwei Länder aufteilen - Indien für Hindus und Sikhs, Ost- und West-Pakistan für die Muslime -, soll ein islamischer Vorzeigestaat entstehen. Tatsächlich aber werden Menschen verschiedener Religionen, die lange Zeit friedlich zusammengelebt haben, zu erbitterten Feinden. Zwölf Millionen verlieren ihre Heimat. Auf der Flucht metzeln sie einander in wenigen Wochen zu Hunderttausenden dahin.
Der pakistanische Gründungsvater Mohammed Ali Jinnah stirbt gut ein Jahr nach der Unabhängigkeit. In der Folge regiert ein kleiner Zirkel mächtiger Familien das Land wie seinen Privatbesitz. 1971 rebelliert Ost-Pakistan gegen die Zentralregierung in Islamabad und spaltet sich als eigenständiger Staat Bangladesch ab. Immer wieder reißt die Armee die Macht an sich.
Das Nachbarland Indien zündet 1974 seinen ersten Nuklearsprengkopf. Im Jahr darauf verschwindet ein pakistanischer Wissenschaftler, der bis dahin beim europäischen Atom-Konsortium Urenco in Holland gearbeitet hat, spurlos - und mit ihm Blaupausen für hochmoderne Zentrifugen zur Urananreicherung. Wenig später taucht Abdul Qadir Khan in Islamabad wieder auf: als Chef des neuen pakistanischen Atomprogramms. "Wenn Indien die Atombombe baut, werden wir Gras und Blätter essen, wir werden sogar hungern - aber wir werden unsere eigene Bombe bekommen", hat der pakistanische Präsident Zulfikar Ali Bhutto geschworen. In seinen Labors bei Islamabad bastelt Khan fortan am wichtigsten Staatsprojekt. Mit Zündung der ersten Testsprengköpfe am 28. Mai 1998 wird Pakistan Mitglied im exklusiven Kreis der Atommächte. Das Land zieht endlich mit den verhassten Indern gleich. Ein merkwürdiger Atomstaat ist da entstanden; er beherrscht modernste Technik, zugleich gilt das islamische Strafrecht. So droht Dieben öffentliche Züchtigung, und wer das Fasten im Ramadan bricht, muss mit zwei Monaten Gefängnis rechnen.
1999 putscht sich Luftwaffengeneral Pervez Musharraf an die Macht. Wenige Monate zuvor hatte er die Armee in den indischen Teil Kaschmirs einmarschieren lassen. Zweimal bereits haben Pakistan und Indien um die Provinz Krieg geführt. Die Pakistani besetzen strategisch wichtige Gipfel jenseits der Waffenstillstandslinie. Mit Mühe gelingt es den USA, Musharraf zu zügeln und einen Nuklearkrieg zu verhindern.
Nach dem 11. September 2001 steigt der General zu einem der wichtigsten Verbündeten Amerikas auf. Bin Ladens Terrornetz, das hinter den Attentaten von New York und Washington steckt, hat seine Ausbildungslager in Afghanistan. Doch die Wurzeln des Terrors reichen bis nach Pakistan. Dort war al Qaeda in den 90er Jahren gegründet worden, dorthin zieht sich bin Laden zurück, als er aus der afghanischen Bergfeste Tora Bora vertrieben wird. Musharraf verspricht, den islamistischen Sumpf auszutrocknen. Fast alle bis heute verhafteten Top-Leute von al Qaeda werden in pakistanischen Großstädten geschnappt.
In Karachi
stellen Fahnder Ramzi Binalshibh, den Chef-Logistiker der Attentäter aus Hamburg, am ersten Jahrestag des 11. September. Knapp sechs Monate später geht pakistanischen und amerikanischen Ermittlern Khalid Sheikh Mohammed ins Netz. Der Drahtzieher der Anschläge von 2001 wird in Rawalpindi festgenommen, 20 Kilometer südlich von Islamabad, im Villenvorort Westridge, wo zahlreiche Armee-Offiziere wohnen.
Doch zugleich kann sich Musharraf nur mit Unterstützung radikaler islamischer Parteien an der Macht halten. Und deren Einfluss wächst: Während der Präsident Pakistan international als Speerspitze im Kampf gegen den Terror darstellt, gelangen Islamisten in zwei der vier pakistanischen Bundesstaaten an die Regierung. Diese Gebiete entgleiten dem Staat zusehends. In der Grenzprovinz zu Afghanistan wird unter ihrer Aufsicht Recht gesprochen, wie bei den Taliban. So werden in der Stadt Miram Shah Männer, die Musikkassetten verkauft haben, geköpft und an Laternenpfähle gehängt. In der Südprovinz Belutschistan bricht eine bewaffnete Rebellion aus. Islamabad entsendet Zehntausende Soldaten und bekommt die Lage dennoch nicht unter Kontrolle.
Einige der radikalen Gruppen im Land toleriert der Staat, weil sie mit ihrem Terror für die Befreiung Kaschmirs kämpfen. Dazu gehört die 1993 gegründete "Armee der Vorzüglichen" (Lashkar-e Toiba): militante Islamisten mit eigenen Ausbildungslagern in Pakistan und Kaschmir. Al Qaeda finanziert Anschläge dieser Gruppe, darunter einen besonders spektakulären: Am 13. Dezember 2001 stürmen fünf mit Gewehren und Granaten bewaffnete Männer das indische Parlamentsgebäude in Neu Delhi und können erst kurz vor dem Plenarsaal gestoppt werden. Mehrere indische Polizisten und Attentäter sterben dabei. In der Folge kommt es fast zum Krieg der Atommächte Indien und Pakistan.
Mit Hilfe von Lashkar-e Toiba taucht Anfang 2002 der Al-Qaeda-Operationschef Abu Zubaida in Faisalabad unter. Der junge Palästinenser, der von Pakistan aus jahrelang die Verteilung von Rekruten aus aller Welt in afghanische Terrorcamps gesteuert hat, fungiert nun als Verbindungsmann für Terrorzellen in Amerika, Nahost und Europa. Bei einem Feuergefecht mit Sicherheitskräften wird er im März 2002 schwer verletzt und verhaftet. Einige Wochen später sterben in Karachi durch Autobomben elf französische Ingenieure vor dem Sheraton-Hotel und weitere zwölf Menschen vor dem US-Konsulat.
2003 wird Ahmed Omar Sheikh gefasst, Drahtzieher der Entführung und Enthauptung des US-Journalisten Daniel Pearl. Sheikh hatte den jüdischen US-Reporter Anfang 2003 in Karachi in eine Falle gelockt. Der Sohn eines reichen pakistanischen Geschäftsmannes, in London aufgewachsen, hatte an der London School of Economics studiert. Mit Anfang 20 schloss sich Sheikh einer militanten Organisation in Pakistan an. In Indien entführte er drei Briten und einen Amerikaner, wurde verhaftet und 1999 durch eine Flugzeugentführung freigepresst. Danach konnte er in Pakistan untertauchen. Gerüchte besagen, Sheikh habe gute Beziehungen zum Militärgeheimdienst ISI.
Wie gefährlich das von westlichen Geheimdienstlern als halbherzig gewertete Vorgehen gegen Terroristen ist, zeigt sich Ende 2003. Zwei Monate nachdem bin Ladens Stellvertreter Ayman al-Zawahiri in einer Audiobotschaft die Pakistani aufgefordert hat, sich gegen ihren Präsidenten zu erheben, überlebt Musharraf nur knapp zwei Bombenattentate. Beim zweiten Anschlag Weihnachten 2003 sterben 17 Menschen. Auftraggeber und Finanzier ist ein Al-Qaeda-Führer, der später in Pakistan festgenommen wird.
Im Sommer 2004 setzt die Polizei einen Computerexperten der al Qaeda in Lahore fest. Bei den Verhören schildert Muhammed Naim Nur Khan, 25, wie Botschaften der Al-Qaeda-Führung aus dem afghanischen Grenzgebiet durch ein Kurier-Netzwerk zu ihm gelangten. US-Ermittler entdecken in seinem Computer Fotos und Dokumente, die Vorbereitungen für Anschläge auf die New Yorker Börse, Banken in Washington und Ziele in London belegen. Wenig später werden im englischen Luton Islamisten verhaftet, die Anschläge auf den Flughafen Heathrow und Londoner U-Bahnen planen. Die Männer sind Briten pakistanischer Herkunft - wie später die Attentäter vom 7. Juli 2005, bei deren Anschlägen in London 52 Menschen sterben. Mehrere von ihnen waren vor der Tat nach Pakistan gereist. Was genau sie dort taten und wen sie trafen, kann nie mit letzter Sicherheit ermittelt werden. Die britische Regierung geht davon aus, dass die späteren Massenmörder "operatives Training" erhielten, vielleicht in einem schwer bewachten Lager von Lashkar-e Toiba bei Lahore.
Fachleute zählen die U-Bahn-Bomber zur "dritten Generation" islamistischer Terroristen. Junge Leute wie sie, in der neuen Heimat geboren, gut ausgebildet, hatte Al-Qaeda-Kommandeur Abu Musab al-Suri übers Internet dazu aufgerufen, eine "geheime Bandenkriegsstruktur" mit eigenständigen Zellen aufzubauen. In Pakistan wird der 48-Jährige nach einer Schießerei mit Sicherheitskräften verhaftet, wie Behörden im Mai 2006 bekannt geben. Sein Ideengut beherzigen offenbar auch radikalisierte Islamisten in Indien. Am 11. Juli 2006 sterben bei synchronisierten Anschlägen auf Pendlerzüge in Bombay 185 Menschen, 700 werden verletzt. Die Täter von Bombay sind jung, intelligent, gut ausgebildet, einer hat als Software-Experte für eine US-Firma im südindischen Bangalore gearbeitet.
Von den ersten Taliban über al Qaeda bis zu den Attentätern der dritten Generation gibt es somit eine Gemeinsamkeit: die Inspiration in Pakistan.
Die Jungs aus den britischen Vorstädten, die in das Land am Indus fahren und sich dort zu Selbstmordattentätern ausbilden lassen, folgen einer Route, die ihre Eltern und Großeltern in umgekehrter Richtung auf dem Weg nach England zurückgelegt hatten - der Grand Trunk Road. Entlang der Ost-West-Magistrale von Kaschmir über Lahore und Islamabad bis nach Afghanistan hatte die königliche Kolonialarmee hoch gewachsene Paschtunenkämpfer rekrutiert und drahtige Kaschmiris als Heizer für die Schiffe der Handelsmarine. Viele von ihnen holten ihre Verwandtschaft nach, als England in der Boomzeit der späten 50er und 60er Jahre dringend Arbeitskräfte brauchte.
In keiner Stadt an der Grand Trunk Road ist diese Zeit noch so lebendig wie in Lahore, dem alten geistigen Zentrum des Islam auf dem indischen Subkontinent. Die Einwohner hielten jahrelang den Islamisten stand, so etwa beim Frühlingsfest, wenn Tausende Radikale gegen den angeblich unislamischen Brauch demonstrierten, unzählige Drachen steigen zu lassen. Erst 2006 hatten die Islamisten Erfolg: Mit dem Hinweis, dass sich alljährlich Dutzende Menschen an den scharfen Drachenschnüren verletzen, verbot die Stadtverwaltung das Spektakel. 1100 Drachenbauer und -verkäufer wurden vorsorglich verhaftet. An den Tagen des Frühlingsfests dann noch einmal 1400 Drachenbesitzer, die sich nicht an das Flugverbot hielten. Der leere Himmel über Lahore erinnerte viele Menschen an Afghanistan unter den Taliban: Die hatten Drachensteigen auch untersagt.
Wir stehen mit Ghazi, einem Jurastudenten, im kleinen Park hinter der gewaltigen Festung, die Großmogul Akhbar einst errichtete. Am Kiosk gibt es kaltes 7Up. Auf dem Getränkemarkt haben US-Firmen ein Quasi-Monopol in Pakistan. Mit Peitschen verjagt die Polizei eine Gruppe Heroin rauchender Männer, sie fliehen an uns vorbei in die dunklen Gassen der Altstadt. Harte Drogen, sagt Ghazi, seien auch eines der Werkzeuge, mit denen Amerika die Muslime strafe. Er unterstütze die Taliban keineswegs, aber als die noch in Afghanistan regierten, habe auf Drogenanbau die Todesstrafe gestanden. Seit aber die USA das Land besetzt hätten, würde Pakistan mit billigem afghanischem Stoff geradezu überschwemmt. "Zufall?", fragt er.
Ist es nicht etwas einfach, für alles die Amerikaner verantwortlich zu machen? Nein, erklärt uns Hameed, 42, ein Reiseführer, "sie sind es wirklich". Seit dem 11. September 2001 hat er kaum noch Arbeit, denn Touristen trauten sich nicht mehr nach Lahore, einer der schönsten Städte der Welt. "Der Westen verachtet uns, er hält uns für minderwertig", sagt er.
Die antiamerikanische
Grundstimmung im Land - erst recht seit dem Krieg im Libanon - ist so virulent, dass der Präsident praktisch unter Dauerbeschuss steht. Leitartikler Shafik Rehman, 50, von der Tageszeitung "Jai Jai Din" nennt Musharraf schlicht den "Oberpudel des Westens". Tatsächlich halten die USA sein marodes Regime - nur zwei Millionen Pakistanis zahlen Steuern - mit Hilfszahlungen und Schuldenerlassen in Milliardenhöhe über Wasser. Amerikas Regierung sah weg, als sich Musharraf 2002 in einem offensichtlich gefälschten Referendum mit 98 Prozent der Stimmen im Präsidentenamt bestätigen ließ. Sogar als 2003 herauskam, dass Abdul Qadir Khan, der Vater der pakistanischen Bombe, das Know-how zu Urananreicherung und Atombombenbau unter den Augen der pakistanischen Armee an Amerikas Erzfeinde Iran, Nordkorea und Libyen (und womöglich noch andere Kunden) weiterverkauft hat, ließ Washington Musharraf nicht fallen.
Wir treffen den Leitartikler Rehman in seinem dunklen Büro, wo er gerade seinem Assistenten eine Kolumne gegen Israel in den Computer diktiert. Mit Ausnahme des Iran seien "fast alle Regierungen islamischer Länder nichts als Lakaien des Westens, die vor nichts mehr Angst haben als vor freien Wahlen. Wenn es die gäbe, wären sie nämlich morgen verschwunden". Laut Rehman gibt es die USA zweimal, "einmal in Nordamerika, das andere Mal als United Slaves of America (Vereinigte Sklaven von Amerika) in der muslimischen Welt". Aber die Leute hätten die Schnauze voll von ihrer korrupten Oberklasse, die sich bereichere, "während mehr als die Hälfte der Pakistani unterhalb der Armutsgrenze lebt und zwei Drittel Analphabeten sind". Der Tag sei nicht fern, an dem die "Wirtschaftskriminellen, die unser Land ruinieren", davongejagt würden. Im Iran habe es schon geklappt, dort sei das Volk "aus dem Dunkel ins Licht geführt worden". Zum Ende des Jahrzehnts werde auch die übrige islamische Welt folgen und sich "starke Führer wählen und keine Pudel".
Das ist das Szenario, vor dem der Westen zittert: ein islamisches Land, das von Radikalen regiert wird, aber nicht mehr an der Bombe herumbasteln muss. Weil es sie schon hat.