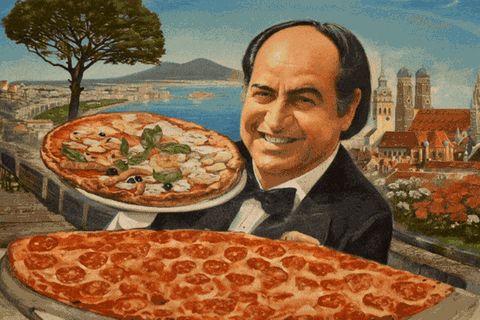Die Müllpyramiden von Taverna del Re sehen aus wie eine gespenstische Tempelanlage. Auf viereinhalb Quadratkilometern türmen sich am Rande von Giugliano, einer Kleinstadt bei Neapel, mit schwarzer Plastikfolie verhüllte Berge aus geschredderten Abfällen. In der zynischen Sprache der amtlichen Entsorger heißen die Bausteine der Pyramiden, die knapp acht Millionen Tonnen Müll bergen, "Öko-Ballen". Winzig klein wirkt der verlassene Bauernhof inmitten des Abfallgebirges. Sein Besitzer ist erst vor Kurzem ausgezogen. Trotzdem pflanzen er und die Nachbarbauern in ihren Treibhäusern gleich nebenan weiter Erdbeeren, Tomaten und Salat an. Kühllaster laden die Ware nachts auf, haben die Anwohner beobachtet.
Enzo Tesoro, ein pensionierter Elektriker, hat hier im Viertel für sich und seine drei Söhne vor Jahren in Eigenarbeit ein Haus gebaut. Seine Enkel sollten auf dem Land aufwachsen, weit weg vom Gestank Neapels. 2004 wurden in wenigen hundert Meter Entfernung die ersten Müllberge angehäuft. Heute dürfen die Kleinen an manchen Tagen nicht mehr zum Spielen in den Garten, wenn der Wind den bestialischen Gestank der Fäulnisgase und Abfallreste herüberweht. Etwa 70 Familien wohnen in Enzos Viertel, fast alle würden lieber heute als morgen wegziehen, doch ihre Häuser sind unverkäuflich geworden.
Als seine Frau Emilia vergangenes Jahr an Lymphdrüsenkrebs erkrankte, hat sich Enzo mit ihr in eine Nachbarstadt zu Verwandten umquartiert. Die Zahl der Tumorkranken, melden die Medien, ist erschreckend angestiegen im müllverseuchten Umland Neapels. Zusammen mit anderen Anwohnern haben sich die Tesoros aus Protest neulich am Haupttor der Deponie angekettet, doch dann hat die Polizei sie vertrieben und die Zufahrtsstraße gesperrt. "Für ihren Profit ruinieren sie die Zukunft unserer Kinder", sagt Enzo Tesoro, "und niemand wird dafür bezahlen: nicht die Politiker, die schuld sind an dieser Katastrophe - und nicht die Verbrecher, für die sich Müll in Gold verwandelt. So ist Italien heute."
Nicht einmal mehr jeder Fünfte vertraut Parteien
Was ist los mit dem Wallfahrtsort für Prada-, Papst- und Pasta-Pilger? Dem Land, das wir für seine Kultur ebenso lieben wie für sein Meer und seinen Mozzarella? Das uns immer wieder irritiert, weil es schon zweimal einen zwielichtigen Medien- Milliardär wie Silvio Berlusconi zum Regierungschef gewählt hat?
Inzwischen verkommen ganze Landstriche Süditaliens unter der Regie der Mafia zum Abfalleimer Europas, der Mozzarella steht unter Dioxinverdacht und Alitalia, die nationale Airline, vor dem Aus. Im Parlament prügeln sich Abgeordnete wie in einer Hafenkneipe, vor den Stadien randalieren die Tifosi. Und während die organisierte Kriminalität immer geschmeidiger Politik, Wirtschaft und Moral durchdringt, während Venedig langsam untergeht und das einstige Gütesiegel Made in Italy oft zu chinesischer Billigware verkommt, wächst in der Bevölkerung die Angst vor dem Abstieg. Neun von zehn Italienern wünschen sich heute einen "starken Mann". "Keinen Mussolini", wie der Politologe Ilvo Diamanti sagt, "aber einen, der fähig ist, mit dem Saustall aufzuräumen und anständig zu regieren." Viele scheinen das dem selbstherrlichen Berlusconi am ehesten zuzutrauen: Nach allen Umfragen steht der straff geliftete 71-Jährige vor seinem dritten Wahlsieg.
15 Jahre nach dem Zusammenbruch des korrupten Parteiensystems um die Democrazia Cristiana haben die Italiener "das Gefühl, dass in der Politik alles beim Alten geblieben, ja schlimmer geworden ist". Der Imageverlust seines Standes veranlasste Staatspräsident Giorgio Napolitano unlängst zu einem ungewöhnlichen Dementi: "Das Parlament ist doch kein Hort von gierigen Faulenzern." Nicht einmal mehr jeder Fünfte vertraut Parteien und staatlichen Institutionen, zwei Drittel zweifeln gar am Sinn der Demokratie. "Tiefe Resignation und eine breite Verweigerungshaltung" haben die Meinungsforscher ausgemacht.
"Ohne das Versagen der Politik hätte die Mafia keine Chance"
Daran hat auch Walter Veltroni wenig geändert, der jetzt gegen Berlusconi antritt: Der Ex-Bürgermeister von Rom gehört selbst seit über 30 Jahren zum verkrusteten Parteienapparat. Viel Stoff für den Komiker und Gift-und-Galle-Blogger Beppe Grillo, dessen "Basta!"-Tiraden gen Rom täglich bis zu 500.000-mal angeklickt werden: "Italiens größte Mülldeponie ist sein politisches Establishment."
Giuseppe Mammoliti drückt es so aus: "Ohne das Versagen der Politik hätte die Mafia keine Chance." Der rundliche Mann ist der Bürgermeister von San Luca, dem Heimatdorf der Duisburg-Killer in der Provinz Reggio Calabria. Nur mühsam kommt man in den 4000-Seelen-Ort, weil die 500 Kilometer lange Autobahn von Neapel nach Reggio Calabria seit 30 Jahren Italiens größte Baustelle ist. "Und der Rest sind Straßen wie in Kenia", klagt Mammoliti. Tiefstes 'Ndrangheta-Land ist das hier, wo Straßenbau, Krankenhäuser, das ganze Gemeinwesen am Tropf der rund 140 Mafia- Clans hängen. Die lassen Investitionen nur zu, wenn Fördermillionen aus Rom und Brüssel in ihre Taschen fließen.
"In Kalabrien infiltriert nicht die Mafia den Staat", resümiert Italiens oberster Mafia- Fahnder Pietro Grasso, "mit Glück gelingt manchmal das Gegenteil." Auch hier wird kaum ein Politiker ohne die Stimmen der Paten gewählt, egal, von welcher Partei. Früher mussten die Bosse den Leuten für das richtige Kreuz auf dem Stimmzettel einen Job versprechen - heute reicht ein neues Handy.
Die Mafia ist Italiens Branche mit den größten Zuwachsraten
"Lokal denken, global handeln" ist nach Ansicht der Mafia-Experten das Erfolgsrezept der 'Ndrangheta, die längst als gigantische Schatten-Holding agiert. Vermutlich ist deshalb von den 22 Milliarden Euro aus dem weltweiten Kokainhandel in San Luca mit seinen ärmlichen Gassen und den zementgrauen Häusern nicht mal was zu ahnen.
Viele in San Luca sprechen holpriges Deutsch. Die Älteren waren Gastarbeiter, die Jungen sind arbeitslos oder Pendler: Pizza backen und kellnern bei der Verwandtschaft in Germania, dann wieder Rumhängen in San Luca. Giovanni Strangio, der flüchtige mutmaßliche Killer von Duisburg, hat es auch so gehalten. Giovannis Vater kommt vorbei, wird vor der Bar mit Schulterklopfen begrüßt. Domenico Strangio, ein Bauer um die 60, will seine Olivenbäume schneiden. "Mein Sohn ist kein Mörder", wehrt er jede Frage ab. Lieber spricht er über seine Prostata-Probleme und die Politiker: "Käuflich. Alle. Von denen haben wir nichts zu erwarten." Die anderen grinsen über die Doppeldeutigkeit.
Die Mafia ist Italiens Branche mit den größten Zuwachsraten. Der Rest der Wirtschaft dümpelt bei Nullwachstum. "Uns fehlen strukturelle Entscheidungen für die Zukunft des Landes", klagt Fiat-und Ferrari-Chef Luca Cordero di Montezemolo, dessen Unternehmen zu den wenigen erfolgreichen Ausnahmen gehört. Im einstigen Luxusdistrikt der Lederbranche rund um Florenz lässt sich der Ausverkauf des Made-in-Italy beobachten. 50 Prozent der Taschen und anderen Lederwaren werden heute von chinesischen Sub- und Großunternehmen hergestellt. Von Leuten wie der 30-jährigen Sara Lin: In ihrem eleganten Showroom im Industrievorort Osmannoro sind die neuesten knallbunten Handtaschenmodelle ausgestellt für Großhändler aus ganz Europa: In China zu Billiglöhnen gefertigt, in Italien mit letzten Details vollendet, gehen sie von hier aus konkurrenzlos billig als italienische Markenware nach Polen oder Rumänien, Deutschland oder Frankreich. Zehn Millionen Taschen vertreibt die Tochter chinesischer Einwanderer heute im Jahr. Sie hat italienisches Verkaufspersonal eingestellt, vor ihrem herrschaftlichen Büro parken firmeneigene Mercedes-Limousinen. "Da ist ein mörderischer Verdrängungswettbewerb im Gang", sagt Cristina Settimelli, Gewerkschaftssekretärin in der Toskana, "jedes achte heimische Unternehmen musste inzwischen schließen."
Große Schere zwischen Arm und Reich
Der Blick von Roberto Cavallis Landgut über Florenz ist atemberaubend, die Kuppel des Domes scheint zum Greifen nah. Zigarre paffend empfängt er in einem gläsernen Pavillon unterhalb des Herrenhauses, zwischen Madonnenstatuen und Tigerfelldecken. Der Mann gehört zum Urgestein unter Italiens Kreativen, der mit schrillem Glitzerlook ein Familienunternehmen von Weltrang aufgebaut hat. Aus Treue zur Heimat lässt er seine Lederwaren von toskanischen Firmen produzieren, die mit dem Siegel "100 % italiano" ausschließlich anständig bezahlte Spitzenqualität aus der Region garantieren. Doch wie viele Kollegen sucht er heute nach internationalen Finanzpartnern. "Die Lage ist schwierig", sagt er, "auch weil wir den höchsten Steuersatz Europas zahlen für einen Staat, der nichts taugt, und für eine Klasse von Politikern, die es nicht wert sind." Schon seit Jahren lebt er lieber in London und den USA als in seinem Heimatland, "wo Stillstand herrscht. Wo alles ein bisschen grau geworden ist. Wo die Lebensfreude und die Lust am Geldausgeben verschwunden sind".
Das ist nicht überraschend. Denn das Durchschnittseinkommen in Italien liegt bei 13 000 Euro pro Jahr, und im Land explodieren die Energie- und Lebensmittelpreise. Während sich Italiens Politikerkaste mit mehr als vier Milliarden Euro Steuergeldern jährlich alimentieren lässt, leben 11 Prozent der Italiener heute unter dem Existenzminimum. Weitere 15 Prozent kommen höchstens noch drei Wochen im Monat zurecht - und das nicht nur im Süden, wo die Bingo-Hallen mit Hausfrauen überfüllt und die Wucherer gut im Geschäft sind.
Die soziale Schere hat sich weit geöffnet. Da gehen bei der Messe "Luxury & Yachts" in Vicenza an einem Wochenende brillantenbesetzte Jeans für 100.000 Euro, Kleinflugzeuge und Yachten für je rund eine Million Euro weg sowie eine unbekannte Anzahl "exklusiver Luxuswohnungen in den Apartment-Türmen von Dubai". Die Kundschaft kommt aus Mailand, Modena und dem heimischen Veneto, Italiens reichster Region. Ferrari meldet derart große Nachfrage für seine 270.000 Euro teuren Super- Sportwagen auch aus dem eigenen Land, dass lange Wartelisten geführt werden.
Angst vor dem Abstieg
Derweil bröckelt Italiens Mittelschicht. Zwei Drittel der Italiener glauben, dass ihre Kinder den Status der Eltern nicht werden halten können. "Bei uns tauchen heute Leute auf, die du früher in guten Restaurants treffen konntest", sagt Francesco Dante, der die Armenküche der katholischen Sant'-Egidio-Vereinigung im römischen Stadtteil Trastevere leitet. Auch beim eben eröffneten Laden für Gratis-Lebensmittel der Caritas in Rom stehen die Menschen Schlange. "Geschiedene mit Kindern, Kleinfamilien, Rentner", sagt Caritas-Sprecher Alberto Colaiacono, "normale Bürger, die sich verschämt bei ihren Pfarrämtern gemeldet haben, weil sie nicht mehr über die Runden kommen."
"Walter Veltroni und sein Vorgänger haben Roms Zentrum kulturell wiederbelebt, aber sie haben die Peripherie vernachlässigt", klagt Sandro Medici, parteilos und Bürgermeister des Stadtbezirks Cinecittà. Seit 2004 hat er 250 zum Verkauf stehende Wohnungen beschlagnahmen lassen, um Menschen vor der Räumung zu bewahren. Seit Ende der 90er Jahre die Mietpreisbindung für die ehemals staatlichen Wohnungen fiel, sind Mieten wie Kaufpreise in astronomische Höhen geschnellt - und das nicht nur im Zentrum von Rom.
Deshalb tobt ein Häuserkampf in der Ewigen Stadt: Organisationen wie "Action" oder "Lotta per la Casa" (Kampf für Wohnraum) halten fast zwei Dutzend Mietshäuser, ausrangierte Kliniken und ehemalige Schulen besetzt. Und die Stadtverwaltung sieht zu, übernimmt häufig sogar die Miete, "weil sie froh ist, uns von der Straße zu haben", sagt Michela, 27-jährige Filmstudentin, die sich im vergangenen Juni mit 60 Familien in der früheren Tumorklinik Regina Elena eingerichtet hat.
"Das Syndrom des Abstiegs", sagt der Politologe Diamanti, "nützt vor allem Berlusconi." Arbeiter und Angestellte, Handwerker und Selbstständige fühlen sich gleichermaßen vom Wohlstand ausgeschlossen. Nach letzten Umfragen ist das rund die Hälfte der Bevölkerung. Sie tendieren klar zur Rechtskoalition des Medienmagnaten. Instinktsicher hat Berlusconi deshalb Postfaschisten, die rassistische Lega Nord und offen Rechtsradikale unter seiner Flagge des "Volkes der Freiheit" versammelt.
Die teuersten Politiker Europas
Für einen wie den Landvermesser Paolo Manfrin aus Padua kann es gar nicht rechts genug sein. Der Mann mit dem kantigen Kinn gehört zu den Wortführern einer Bürgerwehr, die nachts in Problemvierteln mit Baseballschlägern und Schlagringen Jagd auf den "Abschaum" macht: Drogendealer und Prostituierte aus Afrika und Osteuropa, "alles, was hier nicht hergehört". In ihren Vierteln leben viele illegale Zuwanderer, die als billige Arbeitskräfte lange hochwillkommen waren. Manfrin und seine Rambo-Truppe haben sich inzwischen Waffenscheine besorgt, stolz präsentieren sie Präzisionsgewehre und Pistolen vor der heimischen Sofaecke. "Wir normalen Bürger sind es, die sich heute wehren müssen", sagen sie, "die Reichen in ihren bewachten Ghettos juckt das doch nicht."
Der Zugang zur "Casina Valadier" wird von Bodyguards in Zirkusuniformen kontrolliert. Von den mit Fackeln beleuchteten Terrassen der Luxusvilla auf dem Pincio aus liegt einem Rom zu Füßen. Der Marketing- und Eventmanager Leo Caccetta wird 34 und hat zu einem Kostümball geladen. Punkt Mitternacht reitet er hoch zu Ross mit einer Schimmelparade vor - unter dem kreischenden Beifall seiner 1500 Gäste, Anwälte, Werbeleute, Filmproduzenten, aus Roms Aufsteigerszene wie der Gastgeber. Sie wandeln, als Scheich oder Sultan verkleidet, durch Säulengänge und Freskensäle, begleitet von halb nackten Frauen, die sie an Halsketten führen oder als großzügig dekolletierte Madame Pompadours im Arm halten. Eine 150.000-Euro- Orgie der Selbstinszenierung. Es ist Caccetta eine Genugtuung, Roms blasierter Oberschicht zu zeigen, wie man Business und Dolce Vita unter einen Hut kriegt. Genau das hat er auch an Silvio Berlusconi immer bewundert.
Viele haben wie er und seine Freunde den Selfmade-Milliardär gewählt - und waren dann enttäuscht: weil er Wunder versprochen und doch nur seine eigenen Interessen verfolgt hatte. "Eigentlich dürstet das Land nach einem echten Leader, einem, der unangreifbar ist", sagt Caccetta. Eitles Gelächter füllt die Luft. In den Gesichtern spiegelt sich das Licht der Fackeln. "Doch wo ist die Alternative zu Berlusconi?"