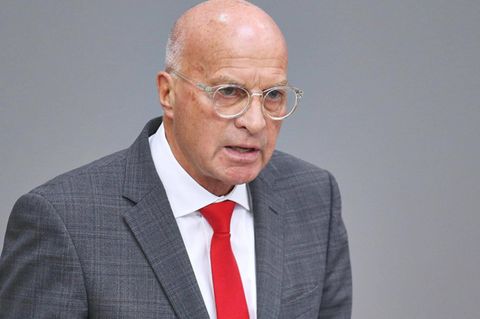Am Ende war sein erstes Mal ganz leicht. Stefan Grüll nahm die Europawahl genauso wichtig wie die deutschen Politiker selbst. Er verstand sie nicht als dramatische Abstimmung über das mächtige Parlament, "sondern bloß als taktisches Signal für die Bundestagswahl". Also hat Grüll am Sonntag sein Signal gesendet - und nicht gewählt. "Allein die Wahlkampagnen waren so niederschmetternd schlecht! Alle Parteien, die jetzt das Desinteresse an Europa beklagen, hatten damit doch ihr eigenes Desinteresse bekundet!" Sein Signal ist ernst gemeint: Auch den Bundestag wird er nicht wählen.
Ausgerechnet Grüll. Einer, der mal Feuer und Flamme war für die Politik, der ganz jung in die FDP eingetreten ist und es bis zum Vizechef der Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen brachte. Obwohl sein Stern mit dem seines Förderers Jürgen Möllemann sank, blieb Grüll süchtig nach Nachrichten aus den Parlamenten und Hinterzimmern. Der promovierte Jurist zog mit der Kanzlei nach Berlin, stritt, bloggte und litt, wenn die Politik die große Oper gab.
Aber er haderte auch immer mehr, bis zum vergangenen Jahr, bis er die schlechte Inszenierung nicht mehr ertrug: Grüll verließ die FDP und beschloss, seine Stimme gar keiner Partei mehr zu geben. Er erzählt das auch überall herum. Nicht zu wählen ist für den 47-Jährigen nicht Verweigerung, sondern Appell, Aufschrei, Anklage. Er sagt: "Politiker müssen sich Gedanken machen, warum sie Leute wie mich nicht mehr erreichen!"
Leute wie ihn: klug, tatkräftig, engagiert.
Der Demokratie kommen die Wähler abhanden
2009 ist ein "Superwahljahr". Europa, neue Landtage in Hessen, Sachsen, Thüringen, Brandenburg und im Saarland. Ende September der Bundestag. Dazu acht Kommunalwahlen. "Super" bezieht sich auf die Anzahl, die Aufregung der Parteien darüber und die Auswirkung auf das Machtgefüge. Auf die Wähler bezieht es sich nicht, denn die werden immer weniger.
Der Volksherrschaft kommt das Volk abhanden: Den Bundestag wählten 2005 mit 77,7 Prozent weniger Menschen denn je. Bei Landtagswahlen sank die Wahlbeteiligung seit der Wiedervereinigung im Durchschnitt aller Bundesländer um 13 Prozentpunkte; im Saarland und in Thüringen ging fast jeder Zweite nicht hin. Im Januar in Hessen war die Beteiligung so niedrig wie nie zuvor: 61 Prozent. Und für Europa mochte, wie schon 2004, nur eine Minderheit ihre Stimme geben: rund 43 Prozent.
Ex-Politiker Grüll kommentiert das bitterböse: "Wenn Abgeordnete, die keiner kennt, sich zur Wahl eines Parlamentes stellen, das niemanden interessiert - dann ist Europawahl."
Glaubt man Politikern und lässt man sich auf die Routineantworten von Parteienforschern ein, sind Nichtwähler entweder desinteressiert oder ungebildet oder zu bequem oder an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Oder alles zusammen. Die Doofen, die faulen Nutznießer, die mittellosen Underdogs sollen es also sein. Na dann ist ja alles halb so wild.
Die Nichtwähler sind unter uns
Warum aber steigt die Zahl der Nichtwähler? Warum trifft man unter Freunden und Kollegen, auf Konferenzen oder Partys Nichtwähler und Zögerliche, die klug sind und unbequem, die gute Jobs haben oder schaffen, die Politik sehr, sehr interessiert - die aber daran gleichzeitig verzweifeln? Zufall?
Keineswegs: Man weiß seit Mitte der 90er Jahre aus der Politikwissenschaft, dass sich der Zufluss an Nichtwählern auch aus einer anderen, viel heißeren Quelle speist: der Mitte der Gesellschaft, dem Wohlstandsfundament der Demokratie, aus jenem Segment also, das die Parteien so liebevoll umgarnen.
Umfragen zeigen, dass die Wahlverweigerer und Unentschiedenen ähnlich über die Schichten der Gesellschaft verteilt sind wie die Wähler. Sie sind unter uns. Es wählen nicht: Frauen wie die Hebamme Inka Mülstegen aus dem Münsterland oder Judith Kantz aus Bad Kreuznach, die ein Hörgeräte-Studio betreibt. Es wählen nicht: Kosmopoliten wie der Unternehmensberater Frank Gutbrod aus Frankfurt am Main oder frühere CDU-Mitglieder wie der Hotelier und Philosoph Werner Peters aus Köln.
Das sind keine Typen, die von der Couch aus bei Bier und Chips über "die Politiker" im Fernsehen zetern und dann aufs Wählen verzichten, weil gerade die Sonne so schön scheint. Das sind Menschen, die das Land prägen. Sie alle sagen, sie würden ja liebend gern wählen. Sie wüssten nur nicht mehr, wen. "Es traut sich keiner in keiner Partei mehr zu fragen: Welche Vision für eine moderne Gesellschaft wollen wir?", klagt Anwalt Grüll.
Eine Dimap-Umfrage für die überparteiliche "Initiative Pro-Dialog" ergab: Knapp 60 Prozent der Nichtwähler gehen arbeiten, 24 Prozent beziehen Rente, jeder zweite hat Realschulabschluss oder Abitur, jeder fünfte hat studiert. Man findet Nichtwähler unter hochrangigen Juristen und Bestsellerautoren, unter Chefärzten und Beamten des Bundeskanzleramts.
Der Polit-Zirkus ekelt an
Die Elite der Republik gesteht meist nur anonym: "Ich weiß, es ist demokratietheoretisch ein Fehler. Aber ich bin einfach nur noch angeekelt", sagt ein hoher deutscher EU-Beamter. Wenn er von Sozialdemokraten das Wort Solidarität höre, "kommt es mir hoch". Der Mann kennt sich aus: Er ist Genosse und arbeitete im Regierungsapparat.
Da erodiert etwas. "Die Mitte bleibt einfach weg, macht nicht mehr mit, wendet sich, gleichgültig fast, von der politischen Arena ab", schreibt der Göttinger Politikwissenschaftler Franz Walter. Die Mitte fühle sich abgestoßen von den "Entmündigungsstrategien" der "Allerweltsparteien".
Im Café einer schönen großen Stadt sitzt ein Leitender Oberstaatsanwalt. Der Name bleibt geheim: der Ruf, die Arbeit, man verstehe? Der Jurist stellt der Korruption in diesem Land nach. Er fängt die großen Fische. Und hat trotzdem dem Staat, in dessen Namen er ermittelt, die kalte Schulter gezeigt, bei der jüngsten Landtagswahl das erste Mal, mit 54: Er ging hin, nahm den Stimmzettel, machte ihn ungültig und warf ihn in die Urne. "Ich wollte wenigstens in die Statistik eingehen."
Er könne nicht mehr Politiker wählen, die ihn in seinen Ermittlungen zu beeinflussen versucht hatten; die Posten nach Parteibuch besetzten und ihre Augen gegenüber Bestechlichkeit verschlössen, wenn die Korrupten nur ausreichend großen Konzernen vorstehen. Seine drei Kinder, erwachsen schon, mahnen: Das kannst du nicht tun! Du stärkst die Neonazis! Und Linksaußen!
Das Argument ist nicht falsch, es verfängt bloß nicht mehr. Alle, mit denen der stern sprach, sagten: Ich will nicht bloß das kleinere Übel wählen, das reicht mir nicht mehr!
Politologen der Freien Universität Berlin haben die wachsende Wahlverweigerung zum Anlass genommen, um die Deutschen sorgfältig daraufhin abzuhorchen, ob ihr Herz zu weit links oder gar ganz rechts schlägt, ob sie womöglich undemokratische Sehnsüchte hegen. Etwas ganz anderes kam heraus: Die Mehrheit findet die Demokratie theoretisch toll, aber praktisch mies. Rund 94 Prozent sehen in ihr zwar die beste Staatsform. Aber nur noch 46 Prozent sind damit einverstanden, wie Demokratie in Deutschland praktiziert wird.
Die Politiker verlieren den Bezug zum Wähler
Es herrscht Frust, auch über die Anmaßung, die sich in Äußerungen verrät wie dieser von Hessens Ministerpräsident Roland Koch (CDU): "Politiker sind nicht eine Gefahr für die Demokratie, sondern ihre Grundlage." Dabei dachte man, das Grundgesetz und freie Wahlen wären die Grundlagen. Und SPD-Chef Franz Müntefering disqualifiziert - in einem Wahlaufruf - Nichtwähler als "Verweigerer" der Demokratie, die "teils arrogant, teils desinteressiert" auf die Abgabe ihrer Stimme verzichteten.
Eine Haltung, die Nichtwähler wütend macht. "Politiker stellen sich nicht der Frage, warum sich immer mehr enthalten", sagt Ex-Politiker Stefan Grüll. Es würde dann ja ans Eingemachte gehen: die Parteien. Der Anwalt hält sie zwar für unverzichtbar. "Die Frage ist nur: Wie füllt man die endlich wieder mit Leben?" Jedenfalls nicht mit Quoten oder Proporz, findet er.
"Was dabei herauskommt, haben wir heute: Listenparteien, die weder etwas mit den Regionen zu tun haben, die sie vertreten wollen, noch mit Kompetenz." Interne Bedürfnisse würden befriedigt, aber nicht mehr die der Wähler. "Auch darum haben wir die geklonten Jungpolitiker, die heute schon so aussehen wie die Parteifunktionäre, die sie morgen beerben wollen."
Die Verachtung für die Politikkaste ist unter Nichtwählern grandios, der Anspruch an sie gleichzeitig enorm. Politiker sollen moralisch überlegen und keine Lobbyisten sein, aber immer den Durchblick haben. Sie sollen versehen sein mit einem gewaltigen Rückgrat und großartigem Charisma, das sie natürlich zu glänzenden, volksnahen Rednern macht. Lauter Barack Obamas.
Die Spielregeln müssen sich ändern
Doch jenseits der Superman-Fantasien kristallisieren sich Forderungen heraus, die zu erfüllen wären - müssten Abgeordnete sich dabei nicht um kostbare Pfründe bringen: Kandidatenlisten sollen verstärkt geöffnet werden für Parteilose. Die Zahl der Jahre in Parlamenten und in Parteiämtern soll begrenzt sein, die Verschwendung von Steuergeld spürbar geahndet werden können. Viele Nichtwähler wollen Volksentscheide. Alle verlangen, dass Politiker halten, was sie versprechen. Oder wenigstens das Versprechen sein lassen.
Aber wie soll das gehen mit Parlamenten, in denen es den "Fraktionszwang" gibt? Dabei werden Abgeordnete von den eigenen Funktionären zum einstimmigen Votum gezwungen. "Diese Praxis hat mich entsetzt", sagt Charlotte Kopp. Die heute 72-Jährige war zu DDR-Zeiten Pfarrerin in Ost-Berlin, ständig unter Beobachtung der "Staatsorgane". Sie hat mit ihrer Familie die Demokratie herbeigesehnt.
Doch was sie seit 1990 erlebt, lässt sie verzweifeln. "Der Kapitalismus ist entfesselter denn je, trotz der enormen Regelungswut in diesem Land." Weil die Theologin bei keiner Partei Antworten in der Sinnkrise findet, gibt sie diesmal niemandem ihre Stimme, nur 19 Jahre nach ihrer ersten freien Wahl.
Ausgehöhlt wird die Basis der Demokratie in den Städten und Gemeinden. Hier bilden die Nichtwähler oft die einzige Volkspartei, mit albtraumhaften hohen Quoten. In Stuttgart oder Mainz ging am vorigen Sonntag nur etwa jeder Zweite zur Kommunalwahl, in Sachsen-Anhalt in manchen Regionen sogar nur jeder Dritte. Oder Frankfurt am Main, Stadt der Banker und Bücher: Dort wählten vor zwei Jahren vermeintlich 60,5 Prozent Petra Roth von der CDU wieder zur Oberbürgermeisterin. Tatsächlich aber hat sie nur jeder Fünfte bestätigt - denn gerade mal ein Drittel der 435.000 wahlberechtigten Frankfurter war überhaupt wählen gegangen.
Der Trend zeigt weiter abwärts
Wie niedrig darf die Beteiligung sein, bevor eine Wahl zur Farce wird? 30 Prozent, 20, 10? Gesetzlich gibt es keine Untergrenze, aber moralisch? "In Deutschland ist die Knautschzone erreicht", warnt der SPD-Vorsitzende Müntefering. Einige Verweigerer könne sich die Demokratie leisten, aber nicht so viele. "Sonst verliert die Demokratie an Stärke und Legitimation."
Was wiegt so schwer, dass schlaue, demokratisch gesinnte Menschen auf das hart errungene Recht, frei wählen zu können, verzichten? Nur 20 Jahre nach dem Mauerfall, nur 64 Jahre nach dem Ende des Naziterrors? Enttäuschung, Ärger, Wut: über hanebüchene Gesundheitsreformen, vom Parlament erpresste Afghanistan-Einsätze, nie aufgeklärte Parteispendenaffären. Und immer wieder: aus Machtgier gebrochene Wahlversprechen.
"Dass so etwas heute noch möglich ist, hätte ich nicht gedacht", sagt der Schauspieler Wotan Wilke Möhring. An Andrea Ypsilanti und ihrem Umgang mit kritischen SPD-Genossen in Hessen habe man sehen können, "wie das System in Deutschland degeneriert. Der Politikerwille hat sich komplett vom Wählerwillen entkoppelt".
Möhring ist 42. Mit 20 als Punk las er über Anarchie, studierte Kommunikationswissenschaften, heute dreht er mit Größen wie dem Regisseur Fatih Akin. Möhring, ein Offizierssohn, zweifelt am Parteiensystem. Selbst jene mit neuen Ansätzen, "wie es die Grünen mal waren oder die Linke sein will, fressen ihre Prinzipien auf, sobald sie Teil des Establishments geworden sind".
Nichtwähler helfen sich selbst
Aber können Nichtwähler überhaupt etwas ausrichten? Wie soll man sich stimmlos Gehör verschaffen? Zum Beispiel Maxie Zurmühlen, eine junge Frau von 24 Jahren. Zusammen mit anderen Aktivisten fährt sie von März bis November im "Omnibus für direkte Demokratie" quer durchs Land und wirbt für Volksentscheide auf Bundesebene. Sie sagt, "bevor es den nicht gibt, gehe ich auch nicht zur Wahl".
Sie bietet Verdrossenen eine Lösung an: Wer wählt, wird ermuntert, nur für Kandidaten zu stimmen, die sich für den Volksentscheid einsetzen. Wer nicht wählt, kann seine Wahlbenachrichtigung unterschrieben an den Omnibus schicken. Hunderttausende Unterschriften haben sie schon gesammelt. 2002 kam es auch dadurch im Bundestag zur Abstimmung über den Volksentscheid. Die notwendige Zweidrittelmehrheit wurde aber verfehlt.
Der Hotelier Werner Peters veranstaltet in Köln politische Salons und hat eine "Freiwilligen Agentur" gegründet, in der ehrenamtliche Helfer vermittelt werden. Judith Kantz, die in Bad Kreuznach Hörgeräte anfertigt, engagiert sich in Bürgerinitiativen und im Bund der Steuerzahler. Und Inka Mülstegen, die Hebamme aus Ascheberg, hat in ihrer Region ein Netzwerk geknüpft, das überforderten Müttern über die erste Zeit mit Kind hilft.
Sie holte dafür die Vizelandrätin ins Boot, ohne zu wissen, welcher Partei die angehört. Zusammen organisierten sie Mehrheiten und Geld. Das kam Mülstegens Vorstellung von Politik recht nahe: Probleme zu lösen "in gut moderierten Diskussionen" und ohne nach dem eigenen Vorteil zu gieren. Wird sie darum zur Kommunalwahl die Partei der Landrätin wählen? "Ich weiß es nicht", sagt sie. Und den Bundestag? "Mit Sicherheit nicht. Was dort passiert, hat sehr viel mit Macht zu tun, aber sehr wenig mit meinem Leben."