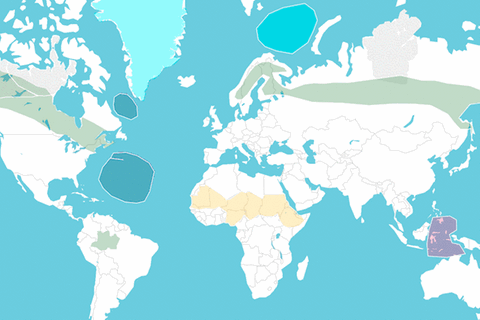Wenn man mit einem Wort aus der Psychologie den Zustand des deutschen Waldes beschreiben müsste, dann wäre es Burn-out. Nur noch 20 Prozent des Waldes sind "vital", heißt es im Waldzustandsbericht 2024. Der Rest ist mehr oder minder krank. Wie krank, lässt sich an der Kronenverlichtung ermitteln. Je ausgedünnter die Krone eines Baumes, desto schlechter sein Gesundheitszustand. Etwa die Hälfte der für den Bericht erfassten Bäume sind deutlich erkennbar geschädigt, 43 Prozent davon schwer. Vor allem Bäume jenseits der 60 Jahre leiden.
Bäume sind Menschen in einer Sache ähnlich: Sind sie gesundheitlich angeschlagen, haben andere Krankheiten ein leichteres Spiel. Schwachen Bäumen setzt die Dürre im Sommer ordentlich zu, die Fichte etwa wird für den Borkenkäfer zur leichten Beute. Aber auch Parasiten wie der Efeu oder die Mistel hat der geschwächte Baum wenige entgegenzusetzen.

Rund 600.000 Hektar sind den Kalamitäten zum Opfer gefallen. So nennen Fachleute Schäden durch Umwelteinflüsse. Die Gründe für den schlechten Zustand des Waldes sind vielfältig. Einer der Hauptgründe ist die Monokultur. Viele Wälder sind genau genommen keine, sie sind Produktionsflächen, auf denen Holz angebaut und geerntet wird. "Nach dem Krieg brauchte man sehr viel Holz für den Wiederaufbau, da bot sich die schnell wachsende Fichte an. Auf großen Flächen sind so die heutigen Monokulturen entstanden", sagt Marvin Schneider, Forstexperte beim Bundesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW).
Eine ökologische Trümmerlandschaft
Mit fatalen Folgen. Weite Teile des Harzes und des Thüringer Waldes sehen aus wie die Kulisse eines dystopischen Hollywoodfilms. Aber auch der Westerwald und das Sauerland sind betroffen. Graues Fichten-Totholz, soweit das Auge reicht, dazwischen zwei Meter hohe nackte Baumstümpfe wie mahnende Finger. Dürre und Borkenkäfer haben den Bestand hinweggerafft. Für Schneider durchaus ein Glücksfall. Wo der Laie Ödnis sieht, erkennt er Möglichkeiten: "Wir müssen den Wald klimaresistenter aufstellen. Wenn schädliche Monokulturen schneller als erwartet in sich zusammenfallen, kann man dort mit der Wiederbewaldung neuer Mischwälder viel früher beginnen."

Im besten Fall überlässt man das der Natur selbst. Sie wird schon über den ewigen Kreislauf der Besiedelung ihren Weg finden – von Pionierbäumen wie der Birke oder Pappel, die mit der Zeit von langlebigeren Baumarten ersetzt werden und schließlich zu einem dichten Wald mit alten Bäumen wie Buche und Eichen führen. Natürliche Verjüngung heißt das in der Fachsprache. Vorteil: Aus sich selbst heraus entstehende Wälder bieten durch ihren Strukturreichtum über die Entwicklungsphasen vielen Tierarten optimale Lebensräume.
Für Flächen mit Monokulturen über hunderte Hektar gilt das nicht. "Wenn es im weiten Umkreis keine Diversität mehr gab, woher sollten die neuen Arten kommen? Da muss man pflanzen und für eine Durchmischung sorgen", weiß Schneider. Das ist sein Job bei der SDW.
Das Ziel seien klimaresistente Mischwälder, bei denen nicht gleich der Ausfall einer Baumart das Aus für das gesamte System bedeute. Das schreibe auch das Waldgesetz so vor. Grundsätzlich würde die SDW heimische Arten mit großer Toleranz gegenüber Wärme und Trockenheit bevorzugen, wie etwa die Stieleiche, Rotbuche, Elsbeere oder den Feldahorn. Man sei aber auch offen für entsprechende Baumarten aus dem weiteren Europa. Allerdings, so Schneider, müsse man bei nicht heimischen Arten sehr genau schauen, ob sie sich tatsächlich ohne Komplikationen in die hiesigen Ökosysteme einfügten.
Welcher Baum passt in den deutschen Wald und welcher schadet?
Nicht heimische Bäume hätten sich eben nicht gemeinsam mit der in Deutschland vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. Viele Insekten und Tiere seien auf bestimmte Baumarten angepasst. Ob sie fremde Bäume – zum Beispiel aus dem Kaukasus oder Nordafrika – überhaupt als Lebensraum annähmen, müsse erforscht werden.
"Die Roteiche aus Nordamerika kommt gut mit Trockenheit zurecht, kann jedoch an bestimmten Standorten heimische Baumarten verdrängen, was Auswirkungen auf die Diversität der Insektenpopulation hat. Roteiche zieht Generalisten an, bedrohte Insektenarten hingegen profitieren von ihr nicht", weiß der Forstexperte. Auch die nordamerikanische Robinie käme großartig mit Trockenheit zurecht und würde gutes Holz liefern. Leider sei sie sehr invasiv. Er habe Waldflächen gesehen, auf denen sich die Robinie ausgebreitet hätte und kaum mehr wegzubekommen war. Nach dem Fällen würden Sprösslinge aus den Baumstümpfen schießen, und selbst wenn man den Stamm entferne, wachse aus jedem Ast des verzweigten Wurzelsystems eine Robinie nach. Am Ende habe man erneut eine Monokultur.
Bundesweit wird auf Versuchsgeländen mit nicht heimischen Baumarten experimentiert. Wie verträgt sich eine Libanon-Zeder mit der heimischen Flora und Fauna, wie eine Zerreiche oder Orientbuche? Diese Untersuchungen brauchen Jahre. Die Natur lässt sich nicht treiben.
Der Mischwald der Zukunft ist rechtlich kompliziert
Wiederbewaldung in Zeiten des Klimawandels ist kompliziert. Nicht nur, was die Bäume betrifft, sondern auch die Organisation des Waldes. Der deutsche Wald ist zersplittert. Ungefähr die Hälfte gehört den Ländern und Gemeinden, der kleinste Teil dem Bund. Die andere Hälfte ist Eigentum von rund zwei Millionen privaten Waldbesitzern, von denen wiederum jeder je nach Bundesland anderen Bestimmungen unterliegt. Für die privaten Wälder ist das Thema klimagerechter Wiederbewaldung vor allem eines: ein Geldthema.
Der Umbau der deutschen Wälder wird zu einem guten Teil von Sponsoren und staatlichen Fördermitteln getragen. Die SDW und zahlreiche andere Träger führen mit Sponsorengeldern Aufforstungen durch, nicht selten werden dabei bis zu einer Million Bäume für neue Mischwälder gepflanzt.
"Der günstigste Teil daran ist der Baum und das Einpflanzen. Teuer ist die Pflege der jungen Bäume in den Jahren danach. Wir berechnen hier sieben Euro pro Baum", so Schneider. Größter Gegner ist der Wildverbiss. Die jungen Triebe sind wie Leckerlis für das Wild. Daher werden Baumgruppen oder jeder einzelne Baum eingezäunt. Das sei sehr personalintensiv, die SDW würde laufend Freiwillige suchen.
Marvin Schneider bleibt optimistisch, selbst wenn er vollständig entwaldete Südhanglagen im Harz sieht, auf deren nur wenige Zentimeter hohem Erdreich kaum etwas kreucht und fleucht. "Irgendwas kommt da immer, und wenn es nur ein paar Birken und etwas Holunder ist. Wir trauen der Natur weniger zu, als sie tatsächlich kann", ist Marvin Schneider überzeugt und zitiert seinen Professor Andreas Roloff von der Universität Dresden. Es braucht eben seine Zeit.