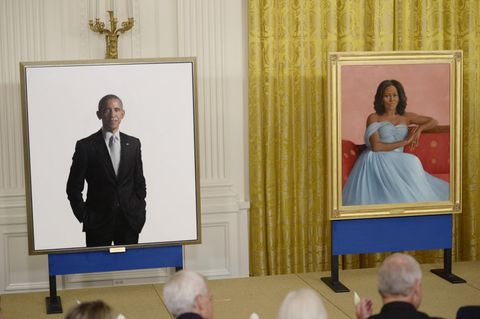Genau vor einem Jahr wurde Amerika neu geboren. Auf der Bühne im Grant Park stand Barack Obama im Scheinwerferlicht, unter ihm ein Meer von Menschen. "Hello Chicago", sagte der neu gewählte Präsident. "Wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der immer noch daran zweifelt, dass Amerika ein Ort ist, an dem alles möglich ist, der sich immer noch fragt, ob der Traum unserer Gründungsväter in unserer Zeit weiterlebt, der immer noch die Macht unserer Demokratie infrage stellt, heute hat er eine Antwort."
Die mehr als 200.000 Zuschauer, die den historischen Moment in Chicago live erlebten, jubelten, viele lagen sich weinend in den Armen. Auch in anderen Teilen des Landes wurden Partys gefeiert. Es gab Hupkonzerte, die Bars blieben bis in die Morgenstunden geöffnet.
In den USA ist der 4. November 2008 ein Tag, den niemand, der ihn erlebt hat, je vergessen wird. Es war der Tag eines Wunders und der Verwunderung darüber, dass Amerika einen Schwarzen zum Präsidenten gewählt hatte. Ein Tag der Erleichterung darüber, dass die Bush-Jahre endlich vorbei waren. Ein Tag der Erwartungen an den Neuen, der alles anders machen wollte. Der Irak-Krieg hatte das Land ausgeblutet. Die Wirtschaft lag am Boden, die Wall Street ebenso, Menschen verloren ihre Häuser, die Arbeitslosigkeit stieg rasant. Die strukturellen Probleme des mächtigsten Landes der Welt waren für alle sichtbar geworden: die überlasteten Sozialsysteme, das angeschlagene Erziehungswesen, die marode Infrastruktur - alles schien repariert werden zu müssen.
Obama stürzte sich mit Ehrgeiz auf den Problemberg
Es war ein Berg voller Probleme, die den neuen Präsidenten zu erdrücken schienen, und Obama stürzte sich mit großem Ehrgeiz darauf. Er pumpte mit einem riesigen Konjunkturprogramm Geld in die Wirtschaft. Er leitete ein Klimaschutzgesetz in die Wege. Und er machte sich an eine Gesundheitsreform, an der schon die Clinton-Regierung gescheitert war - und mit der er einen Kulturkampf auslöste. Obama wollte Amerika zudem moralisch auf den rechten Weg zurückführen: Und so versprach er die Schließung des Gefangenenlagers in Guantánamo binnen einem Jahr.
Gefunden in ...
... der aktuellen Ausgabe der "Financial Times Deutschland".
Es war viel, was Obama sich vorgenommen hat, zu viel vielleicht, auf jeden Fall zu viel für die Geduld der Bürger. Ein Jahr nach der Wahl ist keine der Aufgaben gelöst. Von rund 65 Prozent sind die Zustimmungswerte auf 52 Prozent gesunken. Noch ist die Mehrheit der Amerikaner bereit, dem Präsidenten mehr Zeit zuzugestehen. Doch die Stimmung könnte bald kippen.
Die großen Vorhaben Obamas erzählt die "Financial Times Deutschland" anhand von fünf Schicksalen. Fünf Amerikaner berichten, was sich durch den neuen Mann im Weißen Haus für sie verändert hat.
Lesen Sie auf der nächsten Seite über Ökounternehmer Gary Skulnik
Ökostrom für die Umwelt
Einer musste ja den Anfang machen, warum also nicht er? Gary Skulnik hatte für Greenpeace und für den Sierra Club gearbeitet. Dann dachte er, dass man mit Umweltschutz auch Geld verdienen könnte - und dabei trotzdem weiter den guten Zweck voranbringen. Mit einem Partner gründete er 2005 Clean Currents, um Unternehmen und Haushalte bei der Umstellung auf Ökostrom und bei der Steigerung ihrer Energieeffizienz zu beraten.
Im Bundesstaat Maryland, wo die Firma Clean Currents ihren Sitz hat, und in Washington können Verbraucher schon seit Jahren auf Wind- und Sonnenenergie ausweichen - doch wären viele von allein nie auf die Idee gekommen. "Niemand wusste früher, worum es ging", erzählt Skulnik, ein bärtiger 40-Jähriger, der zum schwarzen Sakko eine simple Jeans trägt. Er setzte auf persönliche Kommunikation als beste Marketingmethode. Unermüdlich zog er durch die Region und warb für das neue Konzept, etwa bei einer Sitzung der Washingtoner Gemeindeinitiative "Think Local First". "Er hat uns nach fünf Minuten überzeugt", sagt Nizam Ben Ali, der Manager von Ben's Chili Bowl, der mit mehreren anderen Restaurants in der US-Hauptstadt auf Windstrom umgestellt hat.
Wie könnte Ben's Chili Bowl nicht dabei sein, wenn es darum geht, Tabus zu brechen? Das 1958 gegründete Fast-Food-Restaurant ist eine Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Als die U Street, in der Jazzmusiker wie Duke Ellington berühmt wurden, bei den 1968er-Rassenunruhen verwüstet wurde, flüchteten die meisten Geschäftsbesitzer. Ben's Chili Bowl blieb - und trug später zum Revival des Viertels bei, das heute eine beliebte Ausgehmeile ist. Der Fernsehstar Bill Cosby zählt zu den Stammgästen - und am 10. Januar, wenige Tage vor seiner Amtseinführung, schob sich Barack Obama mit seinem Tross an die Theke und bestellte die Spezialität des Hauses: eine halb geräucherte Wurst mit scharfer Chilisauce.
"Grünes Bewusstsein ist mittlerweile Mainstream"
In einem Amerika, in dem ein Schwarzer Präsident werden kann, müssten doch auch grüne Ideen eine Chance haben, findet Skulnik. "Grünes Bewusstsein ist mittlerweile Mainstream", sagt er. Mehr als 400 Unternehmen hat Clean Currents bereits mit Ökostrom versorgt, und seit Obama das Thema auf seine Agenda genommen hat, ist die Zahl der Anträge deutlich gestiegen. Der Umsatz von Clean Currents ist zwar immer noch bescheiden, aber in diesem Jahr hat er sich vervierfacht, berichtet Skulnik. "Die Gegner sauberer Energien wirken heute wie Dinosaurier."
Doch er macht sich keine Illusionen, dass die Dinosaurierfraktion im US-Kongress ihren Widerstand gegen neue Umweltauflagen schnell aufgibt. Die Öl- und Kohleindustrie hat eine starke Lobby, die gegen strenge Klimaschutzziele oder die Einführung eines Emissionshandels ist. Die Gesetze, die das Repräsentantenhaus in diesem Sommer verabschiedet hat, gehen vielen Umweltschützern nicht weit genug. Und der Senat hat sich bislang nicht einmal auf einen Entwurf geeinigt.
Ist Obamas Wille stark genug?
Skulnik hat Verständnis dafür, wenn der Durchbruch im ersten Jahr der Obama-Regierung noch nicht gelingt, aber er wünscht sich, dass der politische Wille des Präsidenten stark genug sein wird, um die Blockade aufzubrechen. Das sei gar nicht so viel anders als beim Kampf für die Gleichberechtigung der Rassen, findet er. Wenn man über den Civil Rights Act, mit dem Präsident Lyndon B. Johnson 1964 die Rassentrennung in der Öffentlichkeit beendete, ein Referendum abgehalten hätte, wäre das Gesetz nie verabschiedet worden, glaubt er. "Manche Dinge muss man trotzdem tun."
Lesen Sie auf der nächsten Seite über die Soldatenmutter und Friedensaktivistin Anna Berlinrut
Frieden für Soldatenfamilien
Anna Berlinrut kommen sofort die Tränen, als sie davon erzählt, wie der beste Jugendfreund ihres Sohnes ums Leben kam. Es war Sommer 2005, die Armee brauchte Reservisten, um die Engpässe im Irak zu überbrücken. Fast hätte ihr Sohn sich auch gemeldet, wenn er nicht bereits die Gebühr für einen IT-Sommerkurs bezahlt hätte. Im August ging in der irakischen Stadt Haditha ein Sprengsatz hoch, die Einheit der amerikanischen Marineinfanteristen erlitt schwere Verluste. "Wenn mein Sohn dabei gewesen wäre, wäre er auch getötet worden", schluchzt die Mutter.
18 Jahre alt war er, als er sich 2001 bei der Armee als Reservist meldete, "ein patriotischer Junge", wie seine Mutter ihn beschreibt. Sie hatte ihn immer wieder gewarnt: "Ich traue unserem Präsidenten nicht." Der Sohn wehrte ab: "Mom, er wird nichts Dummes tun." Seither war er viermal im Krieg, erst im Kosovo, später im Irak: Nassirija und Falludscha. Im Mai 2008 schloss der junge Mann sein Studium ab, doch zwei Tage nach der Diplomfeier kam der nächste Marschbefehl, wieder in den Irak. Als er zurückkam, steckte das Land in der Wirtschaftskrise, ein Job war nicht zu finden. Der Ausweg war die Offiziersausbildung an der Militärakademie in Quantico. Anna Berlinrut fürchtet, dass danach der nächste Albtraum für ihren Sohn beginnt: Afghanistan.
Berlinrut will von einer Aufstockung nichts hören
Ihre Erleichterung darüber, dass Barack Obama die Truppen aus dem Irak zurückholen wollte, hielt sich von Anfang an in Grenzen. Sie wusste ja, dass er dafür den Kampf gegen die Taliban am Hindukusch ausdehnen wollte. 21.000 Soldaten erhielten im März von Obama den Marschbefehl, über die Forderung seiner Generäle, bis zu 40.000 weitere zu schicken, will er in diesen Tagen entscheiden. Berlinrut will von einer Aufstockung nichts hören: Die Jungs hätten dort nichts verloren. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 konnte sie den Sinn der Mission noch verstehen. "Es ging darum, Bin Laden und al Kaida zu bekämpfen. Aber Bin Laden ist umgezogen und hat keine Nachsendeadresse hinterlassen."
Sie ist nicht die Einzige, die so denkt. Dieser Oktober war der bisher verlustreichste Monat für US-Soldaten in Afghanistan mit 53 Gefallenen, mehr als 900 waren es seit Kriegsbeginn. Afghanistan ist für viele Amerikaner lange der gute Krieg gewesen, doch diese Zeiten sind vorbei. Berichte über die zweifelhafte Wiederwahl des afghanischen Präsidenten Hamid Karsai und über die Verwicklung seines Bruders in den Drogenhandel lassen das Vertrauen rapide schwinden.
Aktivistin der Organisation "Military Families Speak Out"
Berlinrut sorgt dafür, dass interessierte Bürger in einem Newsletter über die aktuellen Entwicklungen in dem fernen Land informiert werden. Als Aktivistin der Organisation "Military Families Speak Out" hält sie seit drei Jahren jeden Mittwochabend eine Kerzenmahnwache im Spiotta Park in South Orange, New Jersey.
Mehr kann sie nicht tun für ihren Sohn und ihren fast einjährigen Enkelsohn, der einen Vater haben soll. "Die Jungs sind nicht dieselben, wenn sie aus dem Einsatz kommen", sagt sie. Sie erinnert sich noch an die Zeit, als ihr Sohn nach der Rückkehr aus dem Irak nur mit einem Messer unter dem Kopfkissen schlief - und das war noch harmlos verglichen mit den anderen Veteranen, die mit geladenen Gewehren hantierten, auf Menschen schossen oder sich das Leben nahmen. "Mein Sohn ist in einer viel besseren Verfassung heimgekommen als viele anderen", dafür ist seine Mutter dankbar. Sie hofft, dass Obama das Schicksal ihrer Familie nicht mehr aufs Spiel setzen wird.
Lesen Sie auf der nächsten Seite über ein Opfer der Finanzkrise, den Bauarbeiter Curtis Thurston
Arbeitsplätze für Krisenopfer
Curtis Thurston hat sein ganzes Leben auf dem Bau verbracht, hat Tunnel gegraben und Straßen geteert. Es war ein sicheres Einkommen, bis Ende vergangenen Jahres die Wirtschaftskrise über das Land rollte und auch ihn traf. Im Januar, im selben Monat, in dem die USA die Amtseinführung von Barack Obama zum Präsidenten feierten, verlor Thurston seinen Job. "Es war, als ob die Welt zu Ende geht", erinnert sich der 38-jährige Afroamerikaner.
Thurston ist ein muskulöser Mann, der nicht aussieht, als ob ihn etwas umwerfen könnte. Doch wenn er von den zurückliegenden schwierigen Monaten spricht, blitzen Spuren der ausgestandenen Ängste in seinen dunklen Augen auf. Er ist alleinerziehender Vater von drei Söhnen im Alter zwischen 11 und 17, die sechsjährige Tochter lebt bei seiner Ex-Frau. Der Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet in den USA auch den Verlust der Krankenversicherung. Die Miete für das Einfamilienhaus in Charlottesville in Virginia konnte Thurston kaum noch berappen. Eines Tages stellten sie ihm erst den Strom ab, dann das Wasser, nachdem er mit der Zahlung der Rechnungen in Verzug gekommen war.
Thurston wurde wieder gebraucht
Der erlösende Anruf kam am 1. August. Das Verkehrsministerium von Virginia hatte entschieden, dass die Verlängerung des Fairfax Parkway mit 60 Millionen Dollar mit Mitteln aus dem 787 Milliarden Dollar schweren Konjunkturprogramm der Regierung fortgesetzt werden kann. Ein lokales Bauunternehmen bekam den Auftrag - und Thurston wurde wieder gebraucht. Er strahlt, wenn die Kumpels winken, dass er den Bagger in Gang setzen soll. Aus der Führerkabine blickt er über ein weites Schlammfeld, das an einem Ende steil zu einem Fluss hin abfällt. Am Ufer haben die Bauarbeiter einen Wald von kupferroten Stahlstelen in die Erde gerammt, darauf soll die Brücke ruhen, die das Industriegebiet Fullerton mit dem militärischen Forschungsgebiet verbinden soll - und mit dem Highway I 95, der nach Washington führt.
Das Weiße Haus gibt an, dass das Konjunkturprogramm mehr als 640.000 Arbeitsplätze gerettet oder neu geschaffen hat, davon rund 80.000 in der Bauindustrie. Vizepräsident Joe Biden sprach sogar von mehr als einer Million Stellen - wenn man indirekte Beschäftigungszuwächse einrechne. Kritiker wenden ein, dass im gleichen Zeitraum drei Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen seien. Und sie warnen vor den langfristigen Folgen der Ausgabensause, die das Haushaltsdefizit in ungekannte Höhen treibt.
Erstmals wächst die Wirtschaft wieder
Die Konjunkturzahlen für das dritte Quartal schienen den Optimisten recht zu geben: Erstmals war die Wirtschaft wieder gewachsen, und dann gleich um 3,5 Prozent. Die Neuanträge auf Arbeitslosigkeit sanken, Importe und Exporte zogen wieder an. Doch warnen viele Beobachter, dass die Lage noch nicht stabil sei. Viele Programme zur Ankurbelung des Konsums sind ausgelaufen oder stehen kurz davor, darunter die Abwrackprämie und Steuervergünstigungen für Immobilienkäufer. Und die Arbeitslosenquote liegt bei knapp zehn Prozent, dem höchsten Stand seit mehr als 25 Jahren.
Noch sind die Stimulusmilliarden aber nicht ausgegeben. In Virginia steckt die Regierung das Geld in "Projekte, die unsere regionale und globale Wettbewerbsfähigkeit verbessern", wie es Verkehrsminister Pierce Homer ausdrückt. Dazu gehört etwa die Anbindung des Flughafens Dulles an das Metronetz von Washington. Ein Mann wie Thurston dürfte also auch im nächsten Jahr gebraucht werden. Aber er sichert sich lieber nach mehreren Seiten ab. An den Wochenenden hilft er bei seiner Schwester aus, die das Sleep Inn Motel in Charlottesville leitet. Ein zweites Standbein kann nicht schaden.
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Warum sich die Kunstlehrerin Regina Holliday für eine gesetzliche Krankenkasse einsetzt
Krankenversicherung für alle
Andere gehen auf den Friedhof, um sich an einen Verstorbenen zu erinnern. Regina Holliday setzt ihren dreijährigen Sohn Isaac in den Kinderwagen, nimmt ihren älteren Sohn Freddie an die Hand und macht einen Spaziergang zur Autowerkstatt auf der Connecticut Avenue im Nordwesten von Washington. Auf deren Rückwand, gut sichtbar gegenüber dem Eingang der Filiale der Drogeriekette CVS, ist die Tragödie ihrer Familie festgehalten. "Das ist Dad", sagt sie und zeigt auf den Mann im Krankenbett im Zentrum des Gemäldes. "Und das bist du", sagt sie zu Isaac und zeigt auf den kleinen Jungen, der auf dem Boden vor dem Bett sitzt.
Regina Holliday hat lange blonde Haare und ein ansteckendes Lächeln. Auch wenn sie vor der Wand steht, weint sie nicht, sondern trägt das doppelte Gesicht, das sie ihrem Selbstbildnis gegeben hat: eine lachende Maske, die die Verzweiflung vor ihrem Mann und ihren Kindern verbirgt - und vor den weiteren Figuren auf dem Bild: Eine Krankenschwester sitzt vor einem ausgeschalteten Computer. Eine Ärztin ist mit rotem Klebstreifen gefesselt - "red tape" steht im Englischen für überflüssige Bürokratie. 17 Personen sind auf der Wand zu sehen, denn Fred Holliday ist am 17. Juni 2009 im Alter von 39 Jahren gestorben. Am 23. Juni fing seine Frau an zu malen. Alle Welt sollte sehen können, dass ihr Mann zum Opfer des amerikanischen Gesundheitssystems wurde.
Das Jahr hatte für Fred gut begonnen, bis auf die Schmerzen in Brust und Rücken. Ende 2008 hatte er eine feste Stelle an der Universität ergattert. Der Arbeitgeber bot ihm eine Krankenversicherung, die er sich zuvor nicht hatte leisten können. Als er vor vier Jahren wegen einer Harnwegsverengung behandelt werden musste, hatte er die Kosten in Raten abgestottert, Folgeuntersuchungen waren nicht drin. Wäre er versichert gewesen, hätte man vielleicht damals herausgefunden, dass die Erkrankung ein Hinweis auf Nierenkrebs war. Als die Geschwulst am 27. März entdeckt wurde, hatte sie schon Metastasen gebildet.
Obamas Plan droht zermalmt zu werden
Vielleicht wäre das nicht passiert, wenn Barack Obama früher Präsident geworden wäre. Er will sicherstellen, dass alle Amerikaner in den Genuss einer Krankenversicherung kommen. "Schließlich ist seine Mutter an Krebs gestorben", sagt Holliday. An der Reform des Gesundheitswesens ist schon Bill Clinton gescheitert. Nun droht auch Obamas Plan im Kongress zermalmt zu werden.
In der Diagnose sind sich die Experten einig: Die Kosten des Systems sind zu hoch, die Effizienz ist zu niedrig. 16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts fließen in den Gesundheitssektor, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Dabei sind 46 Millionen Bürger ohne Versicherungsschutz, und die Qualität der Versorgung liegt vielfach unter dem internationalen Durchschnitt. Viele Demokraten - darunter der Präsident - plädieren für ein öffentliches System, das nicht auf Profit ausgerichtet ist und den privaten Kassen Konkurrenz macht. Marktliberale lehnen das Modell als zu kostspielig ab. Auch an der Frage, ob es eine Versicherungspflicht geben soll, scheiden sich die Geister.
"Wünsche mir verzweifelt, dass die Reform durchkommt"
Der Ausgang dieses Streits könnte im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden. "Ich wünsche mir verzweifelt, dass diese Reform durchkommt", sagt Holliday. Ihre Söhne hat sie bereits versichert. Sie selbst sucht noch nach einem Tarif, den sie sich als frei schaffende Kunstlehrerin leisten kann. Nächstes Jahr will sie den Beruf wechseln, um zu helfen, dass sich etwas ändert: Im Januar beginnt sie eine Ausbildung zur Krankenschwester.
Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie sich der Uigure Omer Kanat für seinen Landsleute in Guantanamo einsetzt
Freiheit für Terrorhäftlinge
Omer Kanat hatte alles vorbereitet für den Gast, der nicht kam. Rote Rosen zieren den Überwurf des Doppelbetts und die Gardinen, die sich im Windzug bauschen. Aus dem Fenster hätte der Besucher die beruhigende Monotonie einer amerikanischen Vorstadtsiedlung gesehen, weiße Holzhäuser, geparkte Autos, am Ende der Straßenbucht Wiesen und Wald. Im Wohnzimmer hätte er mit der vierjährigen Tochter des Gastgebers spielen können. In der Küche hätte ihn Kanats Mutter mit ihrem Kopftuch und ihrem fröhlichen Lachen gefragt, ob er noch eine Tasse Tee wolle. Auch ein Gebetsteppich lag für ihn bereit.
Der Gast hätte sich im Paradies gewähnt, hier in diesem Haus in Gainesville, Virginia. Die letzten acht Jahre hat er im Gefangenenlager Guantánamo verbracht, die meiste Zeit davon auf einer Metallpritsche in einer engen Zelle. Im Oktober 2008 verfügte ein US-Gericht, dass er und 16 andere Uiguren freigelassen werden müssten, weil ihnen keine Straftat nachzuweisen sei. Und am 22. Januar, dem Tag nach seiner Amtseinführung, versprach der neue Präsident Barack Obama, das berüchtigte Lager binnen Jahresfrist zu schließen . "Wir waren so aufgeregt", erinnert sich Kanat. "Wir dachten, sie könnten jede Woche kommen."
Gainesville hätte ihre neue Heimat werden sollen
Orte wie Gainesville hätten ihre neue Heimat werden sollen, da den Muslimen in der chinesischen Provinz Xinjiang, aus der sie stammen, politische Verfolgung droht. Kanat, ein enger Vertrauter der uigurischen Exilführerin Rabiya Kadir, war einer von denen, die ihren Landsleuten den Start in den Vereinigten Staaten erleichtern wollten.
Die evangelische Kirche stellte Willkommenspakete mit Zahnbürsten zusammen. Die Vorbereitungen seien in "sehr ernsthaften Treffen" mit Vertretern der Obama-Regierung getroffen worden, erzählt Kanat. "Sie sagten, wir sollten uns bereithalten." Doch Obama hatte den Widerstand offenbar unterschätzt. Erst Ende Oktober erlaubte der US-Kongress, dass den Häftlingen, die weiter als Terrorverdächtige gelten, auf amerikanischem Boden der Prozess gemacht wird. Und niemand möchte freigelassene Insassen in seinem Bundesstaat sehen.
"Afghanistan ist unser natürlicher Fluchtort"
Kanat ist enttäuscht, dass die Politiker so feige sind. Den Nachbarn in Gainesville hätte er schon erklärt, warum ein Uigure, der in einer Koranschule in Afghanistan geschnappt wurde, deshalb noch lange kein Terrorist sei. "Afghanistan ist unser Nachbarland und damit unser natürlicher Fluchtort", sagt er. Die Koranschulen köderten die mittellosen Flüchtlinge, indem sie ihnen Kost und Logis anböten.
Kanat selbst war neun Jahre alt, als sein Vater, ein politischer Aktivist, mit der Familie nach Afghanistan floh. Acht Jahre lebten die Kanats in Kabul, doch als 1979 die Russen einmarschierten, zogen sie weiter in die Türkei. Nach dem Studium arbeitete Kanat beim Radio Free Europe in München, wo seine erste Frau und seine drei älteren Kinder bis heute leben. Mit ihrer großen uigurischen Gemeinde wäre auch die bayerische Hauptstadt eine logische Anlaufstelle für die entlassenen Häftlinge. Doch als US-Vertreter in Berlin anfragten, holten sie sich eine Abfuhr. "Die Deutschen wollen sich darauf nur einlassen, wenn die USA auch ein paar Uiguren nehmen", sagt Kanat.
Niemand will es sich mit China verderben
Auch will es sich niemand mit China verderben, das die Auslieferung der Männer fordert. Die Obama-Regierung fand überraschende Auswege: Die Bermuda-Inseln, ein britisches Überseegebiet, nahmen vier Uiguren auf. Palau, ein isoliertes Inselkönigreich im Pazifik, bot sich als Heimat für zwölf weitere Staatenlose an. Kanat ist empört: "Da sind sie in einem offenen Gefängnis.", sagt er. Nach langem Zögern nahmen sechs Männer die Einladung nach Palau letzte Woche an. Die Zukunft der sieben verbleibenden Landsleute im Übergangslager Camp Iguana bleibt ungewiss. In Gainesville stünde immer noch ein Bett bereit.