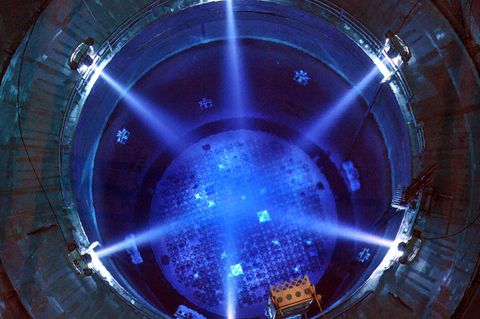Ein neuer Betrugsfall erschüttert die Europäische Kommission: Strafanzeige gegen den Leiter des EU-Büros in Paris. Neues auch im Fall Eurostat: EU-Beamte profitierten persönlich von Schwarzgeld-Konten
Für ihre Sitzung am heutigen Abend in Straßburg haben die Betrugsexperten des Europaparlaments eigentlich schon genug Zündstoff auf der Tagesordnung: Die Abgeordneten des sogenannten Haushaltskontrollausschuß wollen sich erneut den Skandal um Eurostat vornehmen und außerdem den überraschenden Rücktritt von EU-Chefrevisor Jules Muis erörtern. Doch wenn die Parlamentarier ab 19 Uhr im Winston-Churchill-Gebäude nahe der Ill mit Franz-Hermann Brüner, dem Chef der EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf, zusammenkommen, können sie ihm gleich Fragen zu einem neuen Betrugsfall stellen. Die Spur führt nach Paris. Bereits am 7.Mai stellte Brüner dort, beim »Procureur de la République« Strafanzeige gegen den Chef der Pariser Kommissionsvertretung, Jean-Louis Giraudy. Ebenfalls betroffen: sein Stellvertreter Frédéric Magloire. Das Aktenzeichen: OF/2002/0513. Der Vorwurf: »Betrügerische Machenschaften« zu Lasten des EU-Budgets.
Giraudy, so der Vorwurf, soll zu Unrecht Spesen in Höhe von 1.700 Euro für Restaurantbesuche kassiert haben. Vize Magloire wiederum soll sein Passwort für das Intranet der Kommission unzulässigerweise weitergegeben haben - und selbst seinen eigenen Internet-Anschluß »für private Zwecke« missbraucht haben. Die Kommission hat darum nun auch Disziplinarverfahren gegen die zwei Funktionäre eröffnet; Olaf hatte die EU-Exekutive bereits am 6.Mai von der bevorstehenden Anzeige in Paris informiert.
Misstrauen vergrößert
Fast noch interessanter ist freilich ein anderer Sachverhalt, der ebenfalls in dem Olaf-Schreiben an den Pariser Staatsanwalt enthüllt wird: Brüsseler Kommissionsbeamten, die dem damaligen Kommissions-Chefsprecher Jonathan Faull unterstanden, verstrickten sich in Manöver, die Giraudy und Magloire in ein schlechtes Licht rückten. Ein Beamter der Faull unterstellten Generaldirektion Presse verheimlichte den beiden in Paris arbeitenden Beamten einen Vermerk, in dem Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit eines Subventionsempfänger formuliert waren. »Die Tatsache«, dass das EU-Hauptquartier den beiden Pariser Kollegen diese Note nicht zusandte, »hat indirekt dazu beigetragen, das Misstrauen von Olaf gegenüber den Herren Giraudy und Magloire zu vergrößern«, schreiben die Ermittler.
Jonathan Faull hatte von Anfang an ein dubioses Verwirrspiel um die zwei Franzosen veranstaltet. Der Chefsprecher selbst mobilisierte die Betrugsbekämpfer mit einer Verdachtsmeldung gegen Giraudy und Magloire. Beide ließ er am 18.November 2002 provisorisch nach Brüssel versetzen. Einen Monat später verkündete der Sprecher, die zwei könnten an ihre Posten zurückkehren.
Giraudy und Magloire seien nun »reingewaschen«, triumphierte damals die französische Zeitung »Libération«. Doch offenbar kehrten Giraudy und Magloire nie wirklich an ihre alten Posten zurück. Offiziell sind heute beide krankgeschrieben.
Scheinbar falsche Angaben
Zweite Merkwürdigkeit: Faull und Olaf hatten ursprünglich behauptet, die Affäre betreffe Zahlungen für ein EU-Informationsbüro in einer französischen Stadt. Gemeint war offenbar die Stadt Avignon. Doch diese Zahlungen liefen gar nicht über das Pariser Büro, sondern wurden in Brüssel autorisiert.
Von diesen Vorwürfen ist offenkundig wenig übriggeblieben - statt dessen müssen sich Giraudy und Magloire nun wegen »minderer Vergehen« verantworten, so stellten es bereits am 5.März Mitarbeiter des Olaf-Überwachungsausschusses in einer internen Note fest. Sie erhoben eine bange Frage: Liege hier vielleicht ein Fall der »Instrumentalisierung« von Olaf durch die Kommission vor? Habe man, so fragte zuvor bereits »Libération«, Giraudy und Magloire loswerden wollen, um ihre beiden gutdotierten Stellen neu besetzen zu können? Etwa mit Vertrauten der amtierenden Kommissare Michel Barnier und Pascal Lamy? Wollte man, fragen Brüsseler Insider, Missetäter in der Kommissionszentrale decken, indem man den Scheinwerfer auf Giraudy und Magloire richtete?
Milde gegen Eurostat
Während die Kommission so gegen ihre beiden Pariser Vertreter mit aller Schärfe vorgeht, läßt sie im Millionenskandal um das Statistikamt Eurostat weiter erstaunliche Milde walten. Bis heute hält sie die Fiktion aufrecht, es gebe keine persönlichen Vorwürfe gegen den inzwischen versetzten Ex-Chef des EU-Statistikamtes, Yves Franchet - sowie gegen den ebenfalls kaltgestellten Ex-Direktor Daniel Byk.
Interne Dokumente, die stern.de zugespielt wurden, erschüttern diese Behauptung. Tatsächlichen erhoben die Olaf-Ermittler in ihrer Anzeige bei der Pariser Staatsanwaltschaft am 19.März sehr wohl persönliche Vorwürfe gegen Byk. Der Eurostat-Direktor persönlich habe von Zahlungen aus einer von ihm mitangelegten »schwarzen Kasse« profitiert, schrieben die Ermittler in ihrer Anzeige an die Pariser Justiz. Byk habe sich für »Reisespesen, Restaurant- und Hotelrechnungen« bedient. Byk selbst autorisierte offenbar auch das Abzweigen von fast 922.500 Euro für die schwarze Kasse. Das Geld stammte aus Verkäufen von Eurostat-Datenmaterial in den von der Firma Planistat betriebenen sogenannten Data-Shops. »Zwischen 50 und 55 Prozent« der Erlöse, notierten die Ermittler, seien in die schwarze Kasse geflossen. Aus der bediente sich neben Byk dann auch die Firma Planistat selbst. Die Olaf-Ermittler sprachen darum von einer »groß angelegten Plünderung des Gemeinschaftshaushaltes«.
Byk bestreitet die Vorwürfe bis heute. Und Kommission (die die Anschuldigungen seit Mitte Mai kennt) versprach ihm und seinem Ex-Chef Franchet trotzdem »Unterstützung« gegen angeblich verleumderische Presseartikel. Man habe nicht die Möglichkeit »irgendwelche Konsequenzen« für Franchet und Byk zu ziehen, hielten die Kommissare noch am 21.Mai in ihrem Sitzungsprotokoll fest, auch dies offenbar in Kenntnis der Vorwürfe gegen Byk.
Witerhin Zahlungen aus dem EU-Haushalt
Ebenfalls merkwürdig, dass die des massiven Betrugs verdächtige Firma Planistat bis heute Zahlungen aus dem EU-Haushalt erhält. Auch Olaf habe ja nicht um einen Abbruch der Überweisungen gebeten, verteidigte sich Währungskommissar Pedro Solbes am 17.Juni im Haushaltskontrollauschuß.
Insider bei Eurostat sprechen freilich von ganz handfesten Gründen für diese großzügige Haltung gegenüber potentiellen Betrügern. Würde Eurostat wirklich Planistat vor die Tür setzen, bräche der Betrieb in dem Statistikamt in weiten Bereichen zusammen. Im offiziellen Organigramm des Eurostat-Referats B5, das sich mit der EU-Zahlungsbilanz beschäftigt, stehen so neben 15 Namen von Kommissionsbediensteten auch 15 Namen von Planistat-Mitarbeitern. Die verrichten ihren Job großenteils gegenüber dem Eurostat-Sitz in Luxemburg. Dort, auf der anderen Straßenseite, hat Planistat einige Etagen angemietet.
Pressearbeit ausgelagert
Auch Journalisten, die an Feiertagen die Eurostat-Pressestelle kontaktieren, bekommen schon mal einen Rückruf von Planistat. Unter Direktor Byk wurde selbst die Pressearbeit in Teilen an das dubiose französische Unternehmen ausgelagert. Byk und Franchet machten das EU-Statistikamt damit offenkundig abhängig von zweifelhaften privaten Dienstleistern. Obwohl sich interne Prüfer bereits im September 1999 über die schwarze Kasse beschwert hatten, blieb Planistat in den Jahren 2000 und 2001 der größte Profiteur von Eurostat-Zahlungen. Insgesamt überwies die Kommission in den vergangenen zehn Jahren 49 Millionen Euro an die Firma.
Das ist nicht der einzige Widerspruch, in den sich die Kommission jetzt verwickelt. Ängstlich versuchen Prodi und seine Kollegen vor allem den Eindruck zu verwischen, sie hätten schon viel früher gegen die Missstände bei Eurostat einschreiten können. Als »völligen Blödsinn« wies Prodis Sprecher Reijo Kemppinen einen Bericht der »Financial Times« zurück, indem Franchet mit belastenden Aussagen zitiert wurde. Quintessenz: Prodi und die anderen Kommissare hätten ihn stets unterstützt. Und man habe über die Probleme bei Eurostat »oft gesprochen«.
In einer Note an Kinnock (»Lieber Neil«) versuchte Franchet jetzt die »bedauerlichen Missverständnisse« aus der Welt zu räumen. Nie habe er interne Auditberichte an die Kommissare weitergegeben; nie habe er über die Prüfberichte »mit irgendeinem Kommissar« reden können. »Niemals« habe er vor allem Haushaltskommissarin Michaele Schreyer getroffen oder mit ihr gesprochen.
Das Franchet-Schreiben wird von der Kommission aktiv verbreitet - es soll die Kommissare entlasten. Tatsächlich wirft es vor allem neue Fragen auf. Kann es wirklich sein, dass keiner der Kommissare nie das Gespräch mit Franchet suchte, während die Medien immer wieder über die Betrugsermittlungen bei Eurostat berichteten?
Mehrere Untersuchungen bei Eurostat
Immerhin ist seit Februar 2002 öffentlich bekannt, dass Olaf bei Eurostat gleich mehrere Untersuchungen führt. Der stern hatte darüber als erste Zeitung berichtet; andere Medien in ganz Europa griffen die Neuigkeit rasch auf. Im Laufe des vergangenen Jahres machten stern und andere immer weitere Vorwürfe gegen Eurostat bekannt - vom Verdacht der Bestechung eines Beamten bis zum Mobbing einer Eurostat-Mitarbeiterin, die überhöhte Zahlungen an die offenbar betrügerische Firma Eurogramme verhindern wollte.
Über den Eurogramme-Fall berichtete stern.de bereits Ende Mai 2002. Schreyer behauptet trotzdem, Olaf habe das Generalsekretariat der Kommission über diese Untersuchung erstmals am 5.Juli 2002 notifiziert. Schreyer zu den Abgeordneten des Haushaltskontrollausschusses: »Andere Dienste wußten nichts von der Eurogramme-Untersuchung.«
Alle Artikel eigens übersetzt
Lesen Brüssels hochbezahlte Kommissare und Beamte keine Zeitung? Natürlich tun sie es. Sie ließen selbst alle Eurostat-Artikel von stern.de ins Englische übersetzen. Kinnocks Sprecher Eric Mamer und (ab Juni 2002) Prodis Sprecher Faull beantworteten persönlich mehrere Anfragen zu den Eurostat-Betrugsfällen - meist freilich mit der brüsken Weigerung, Stellung zu nehmen, solange die Olaf-Untersuchungen liefen. Noch im April 2002 ließ Kinnock durch seinen Sprecher Eric Mamer Eurostat-Chef Yves Franchet dafür preisen, dass der das Prinzip des »total quality management« eingeführt habe.
Kommissionspräsident Romano Prodi selbst wurde am 27.Mai 2002 von mehreren Journalisten bei einer Pressekonferenz im Brüsseler Breydel-Gebäude auf die Betrugsermittlungen angesprochen. Es gebe »keinerlei Betrug« bei Eurostat, nuschelte er zunächst, ließ sich dann eines besseren belehren und muß in den folgenden Monaten alles wieder vergessen haben. Wird Prodi heute auf dieses Briefing angesprochen, gerät er ins Stottern.
Standardentschuldigung der Kommissare
Kein Wunder, denn entweder war Prodi in abenteuerlicher Weise desinteressiert, oder er muß mehr gewußt haben. Olaf-Chef Brüner informierte bereits am 12. Juni 2002 Prodis Generalsekretär David O’Sullivan über den Verdacht der »Korruption« bei Eurostat. Doch noch zehn Monate später, im April 2003, ließ der Präsident seinen Sprecher Reijo Kemppinen den Eurostat-Chef Franchet als »sehr proaktiv« handelnden Reformer preisen. Was Prodi und seinen Kollegen fehlte, war folglich nicht die Information, sondern der Wille zu handeln. Über ein Jahr lang versuchten Kinnock, Prodi und Co. die Vorwürfe zu ignorieren oder herunterzuspielen. Die Kommissare nutzten eine Standardentschuldigung: Solange Olaf ermittelte, seien ihre Hände gebunden. Solange die Ermittler ihre Arbeit nicht abgeschlossen hätten, habe er Franchet auch gar nicht suspendieren können, verkündete Kinnock am 17.Mai im Haushaltskontrollausschuß. Der Waliser kann von Glück sagen, dass die Abgeordneten vergesslich sind. Denn noch im August 1999 (und damit unmittelbar vor seiner Ernennung zum Kommissar) versprach Kinnock den Abgeordneten schriftlich das genaue Gegenteil: »Ganz allgemein werde ich vorschlagen, dass Personen, die Gegenstand von Olaf-Untersuchungen sind, von ihren Posten entfernt werden, falls ein Mindestmaß an Beweisen vorliegt und die offensichtliche Gefahr besteht, dass eine Untätigkeit die Untersuchung gefährden könnte.«
Das war damals. Heute ist Kinnock im Amt gut etabliert und will von seinem Versprechen nichts mehr wissen. Seit September 2001 kannte der Kommissiar auch das Dossier des EU-Beamten Paul Van Buitenen. Schon Van Buitenen erwähnte, dass der Behörde von Haushaltskommissarin Michaele Schreyer Prüfberichte vorlägen, die auf »Schwarzgeld« bei Eurostat hinwiesen. Offenbar wies Kinnock seine deutsche Kollegin nie auf diese Tatsache hin. Sie will den Prüfbericht über die schwarzen Kassen bei Planistat jedenfalls erst im Mai 2003 gelesen haben.
Kommission sieht keinen Handlungsbedarf
Auch die Haushaltskommissarin fällt nun durch allerlei widersprüchliche Ausreden auf. Noch Ende April ließ sie erklären, dass die den Schreyer-Beamten vorliegenden Eurostat-Prüfberichte ihr völlig zu Recht nicht vorgelegt worden seien. Es habe sich ja nicht um so genannte »Systemaudits« gehandelt. Inzwischen räumt die Kommissarin ein, dass ihr Mitte 2000 auch ein »Systemaudit« zu Eurostat vorenthalten wurde. Es gebe »keine Spur«, die darauf hindeute, dass die verantwortlichen Kommissare informiert wurden, teilte Schreyer dem Haushaltskontrollausschuß mit. Werden die verantwortlichen Beamten nun bestraft? Nein, dafür sieht die Kommission keinen Anlaß.
Statt zu handeln, jammert Schreyer nun lieber öffentlich: Es sei nicht zumutbar, dass interne Prüfberichte nie den Weg auf ihren Schreibtisch fanden. Aber warum hat sie dann bei Amtsantritt im September 1999 nicht auf voller Information bestanden? Warum ließ sie es zu, dass ihr anders als ihrer Amtsvorgängerin Anita Gradin diese Prüfberichte vorenthalten wurden? Warum erteilte sie nicht der ehemaligen Finanzkontrolleurin Isabella Ventura entsprechende Weisung? Grund dazu hätte sie bereits gehabt, nachdem der stern im Januar 2000 enthüllt hatte, dass Ventura einen Auditbericht über die Gemeinsame Forschungsstelle (GFS) einfach in ihrer Schublade gebunkert und nicht weiter geleitet hatte.
Ziel verfehlt?
Eigentlich war die amtierende Kommission angetreten, die politische Kontrolle über den unter Prodis Vorgänger Jacques Santer aus dem Ruder gelaufenen Kommissionsmoloch wiederherzustellen. Offenbar taten Schreyer und Co. das Gegenteil: Die mit monatlich um die 18.000 Euro hochbezahlten Behördenchefs wissen weniger denn je, was im eigenen Apparat so alles passiert.
Auch der Sündenbock ist schon gefunden: Olaf habe die Kommissare nicht informiert, bemängelt Präsident Prodi. Für die Kommissare könne »insofern keine Verantwortlichkeit entstehen« als es sich um Vorgänge handelte, »die sie nicht wissen konnten«.
Verhaltensfehler und Schuldabweisungen
Da kommt es der Kommission wie gerufen, dass sich auch Olaf-Chef Brüner im Fall Eurostat Verfahrensfehler vorwerfen lassen muß. Er vergaß, die beiden Eurostat-Manager Franchet und Byk anzuhören, bevor er die Pariser Justiz gegen sie mobilisierte. Das kann den beiden Männern nun helfen, Disziplinarverfahren abzuwenden. Und es liefert der Kommission Vorwände, eher gegen Olaf vorzugehen, statt gegen die Versager in den eigenen Reihen.
Die Kommission überlegt nun sogar, das Betrugsbekämpfungsamt in die »völlige Unabhängigkeit« zu entlassen. »Jetzt schicken sie uns nach Turku oder auf den Mond«, sorgt sich ein Ermittler. Schreyer und Co. indes bleiben sich treu: Sie suchen die Schuld bei anderen, nicht bei sich selbst.