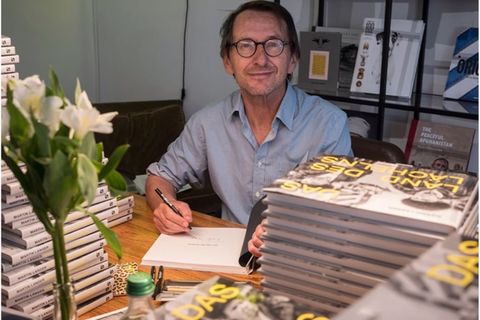Die Meldung klang alarmierend: Bis zu einer Million Kubikmeter Salzlauge würden das geplante Atommüllendlager Gorleben bedrohen, warnte Greenpeace am Dienstag. Die Umweltschutzorganisation hatte Tausende von Behördendokumenten gesichtet und einen Hinweis darauf entdeckt, dass Behörden die Entdeckung eines Laugen-Sees in 840 Metern Tiefe verschwiegen hatten. "Wenn dieses Reservoir sich auf einen Schlag öffnet, säuft dieser Erkundungsbereich Eins fünfmal ab", warnte daraufhin der Kieler Geologe Ulrich Schneider.
Ein Laugeneinbruch in einem geplanten Endlager für hochradioaktive Abfälle - das wäre für die Befürworter von Gorleben der GAU. Möglicherweise aber sind die Umweltschützer nun mit ihrer Warnung übers Ziel geschossen: Das niedersächsische Umweltministerium teilte inzwischen mit, bei den Wassereinlagerungen in Gorleben handele es sich um Laugen fossiler Art und nicht um eindringendes Grundwasser. Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), das seit 2009 Betreiber des Gorleben-Erkundungsbergwerk ist und als atomkritisch gilt, relativierte die Greenpeace-Meldung: Es handele sich um "maximal 1500 Kubikmeter" Lauge, die hunderte Meter vom geplanten Endlager-Bereich entfernt lägen. Die Strahlenschützer des BfS sind daher sicher: "Die Lauge stellt kein Risiko für ein mögliches Endlager-Bergwerk dar."
Die Vorläufer von Gorleben
Laut einem Gutachten aus den siebziger Jahren kamen mehrere Standorte in Betracht, um sie als mögliches Atommüll-Endlager zu erkunden:
Fehmarn, Friedrichskoog, Lütau, Börger, Uchte, Ahlden, Becklinger Holz, Fassberg, Malloh, Daxelberg, Ulmen, Oberwesel, Rhaunenwald, Schinderskopf, Alzey, Mettlach, Butzbach, Tauberbischofsheim, Sindringen, Dürmentinger Wald, Mahlberg, Sohlhöhe, Pegnitz und Oberntief
Standorte in ganz West-Deutschland im Gespräch
Doch aus der Schusslinie ist das geplante Endlager Gorleben damit noch lange nicht. Denn die aufgetauchten Dokumente zeigen, wie wenig die Öffentlichkeit bislang über die Probleme der Endlagersuche informiert worden ist. 33 Jahre nach den ersten Arbeiten in Gorleben werfen sie erneut die Frage auf: Nach welchen Kriterien wurde Gorleben eigentlich als Standort für Deutschlands gefährlichsten Müll ausgewählt?
Wie die bislang veröffentlichten Unterlagen zeigen, war der Salzstock nahe der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze ursprünglich gar nicht als unterirdische Deponie im Gespräch. Stattdessen wurde der Ortsname erst nachträglich handschriftlich in eine Akte eingetragen.
Tatsächlich hatten die Gutachter der damals zuständigen Kernbrennstoff-Wiederaufarbeitungsgesellschaft in den siebziger Jahren gleich eine ganze Reihe von möglichen Standorten in Betracht gezogen. Im Gespräch waren nach Angaben von Mathias Edler, Atomexperte bei Greenpeace, Standorte in ganz West-Deutschland, beispielsweise in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Aus dieser Liste empfahlen die Gutachter Wager und Lüttig schließlich den Salzstock Börger im Emsland, Weesen-Lutterloh bei Celle und Ahlden bei Nienburg, ebenfalls in Niedersachsen. Alle drei Standorte sind Salzstöcke. Eine Studie des TÜV Hannover empfahl zudem Nieby in Schleswig-Holstein.
"Niemand kann das heute nachvollziehen"
Die beiden Behörden, die heute auf die Frage nach der Standortauswahl am besten Antwort geben könnten, das Bundesamt für Strahlenschutz sowie die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, geben sich wortkarg: Derzeit beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss des Bundestags mit Gorleben. Er soll klären, wieso sich die Politik damals so früh auf Gorleben festlegte, auch Mitarbeiter der beiden Behörden werden als Zeugen aussagen müssen. Doch ein Mitarbeiter räumt ein: "Das Auswahlverfahren damals war intransparent. Niemand kann heute nachvollziehen, wie Gorleben damals in die Auswahl gekommen ist."
Dennoch setzt die Bundesregierung noch immer alles auf die Karte Gorleben. Erst im März hatte Bundesumweltminister Norbert Röttgen bekannt gegeben, dass er den im Jahr 2000 von der rot-grünen Regierung beschlossenen Erkundungsstopp des Salzstocks aufheben wolle. Nun sollen internationale Forscher die bislang gesammelten Daten auswerten, während parallel dazu die Erkundungsarbeiten unter Tage wieder aufgenommen werden.
In sechs Jahren könne man mit der Erkundung fertig sein, sagte Gerald Hennenhöfer, der Leiter der für Atomfragen zuständigen Abteilung im Bundesumweltministerium, im Umweltausschuss des Landtages in Hannover. Doch bis Gorleben im Falle einer Eignung komplett ausgebaut ist, werden weitere Jahre ins Land gehen. Noch länger würde es dauern, sollte Gorleben als ungeeignet befunden werden. Es sind gefährliche Jahre, denn bis zur Fertigstellung eines Endlagers wird stark strahlender Atommüll in Deutschland zwischengelagert - und zwar oberirdisch.
Endlager-Sucher müssten quasi bei Null anfangen
Die Bundesregierung könnte das Verfahren abkürzen und parallel zu Gorleben weitere Standorte erkunden. Das fordern Umweltschützer, aber auch Klaus-Jürgen Röhlig, Professor am Institut für Endlagerforschung in Clausthal-Zellerfeld: "Aus wissenschaftlicher Sicht sollte man die bereits weit fortgeschrittene Gorleben-Erkundung fortführen, aber aber man sollte sich für den Fall negativer Befunde oder eines politischen Scheiterns des Projekts auch nach Alternativen umsehen." Der Plan von Umweltminister Röttgen sieht dagegen vor, andere Standorte erst dann zu prüfen, wenn Gorleben sich als ungeeignet herausstellt.
Doch bei diesem Vorgehen geht viel Zeit verloren, denn die Endlager-Sucher müssten quasi bei Null anfangen: Zwar gibt es inzwischen ausführliche Karten zur Geologie Deutschlands, doch auf die alten Standortlisten könnten sich die Experten nicht mehr stützen: Längst haben sich die Sicherheitsanforderungen an ein Endlager verändert, außerdem hatte man in den siebziger Jahren keine Standorte in Ostdeutschland untersucht.
Atomexperte Edler von Greenpeace wünscht sich zudem eine wesentlich offenere Standortsuche: "Wir müssen weg von der Fokussierung auf Salzstöcke." Auch Wolfgang Ehmke von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow Dannenberg fordert: "Es müssen zwei oder drei Standorte mit unterschiedlichen Gesteinsformationen in die engere Wahl gezogen werden."
Salz, Granit oder Ton - was ist besser geeignet?
Ob Salz als Gestein für ein Endlager geeignet ist, darüber wird in Europa schon lange diskutiert. Frankreich und die Schweiz haben sich für Ton entschieden. Diese geologische Formation gilt als sehr wasserundurchlässig. Finnland und Schweden setzen dagegen auf stabilen Granit. Doch laut Endlagerforscher Röhlig weist jedes Gestein auch Nachteile auf: Ton sei instabiler und halte weniger Hitze aus, daher brauche man mehr Raum für den heißen Müll. Granit wiederum sei meist zerklüftet und daher wasserdurchlässig, was besondere Anforderungen an die Atommüllbehälter stelle.
Die deutsche Regierung glaubt dagegen, mit Salz bereits den Stein der Weisen gefunden zu haben. Dass sie diese Annahme nicht durch eine vergleichende Standortsuche untermauert, dürfte die Akzeptanz eines künftigen Endlagers nicht gerader fördern. Zumindest in puncto Transparenz könnten die Deutschen jedoch von ihren europäischen Nachbarn lernen. Das Schweizer Bundesamt für Energie beispielsweise stellt alle Dokumente zur Endlager-Suche ins Internet. Und wer Fragen hat, wählt einfach die dort angegebene Nummer des zuständigen Beamten.