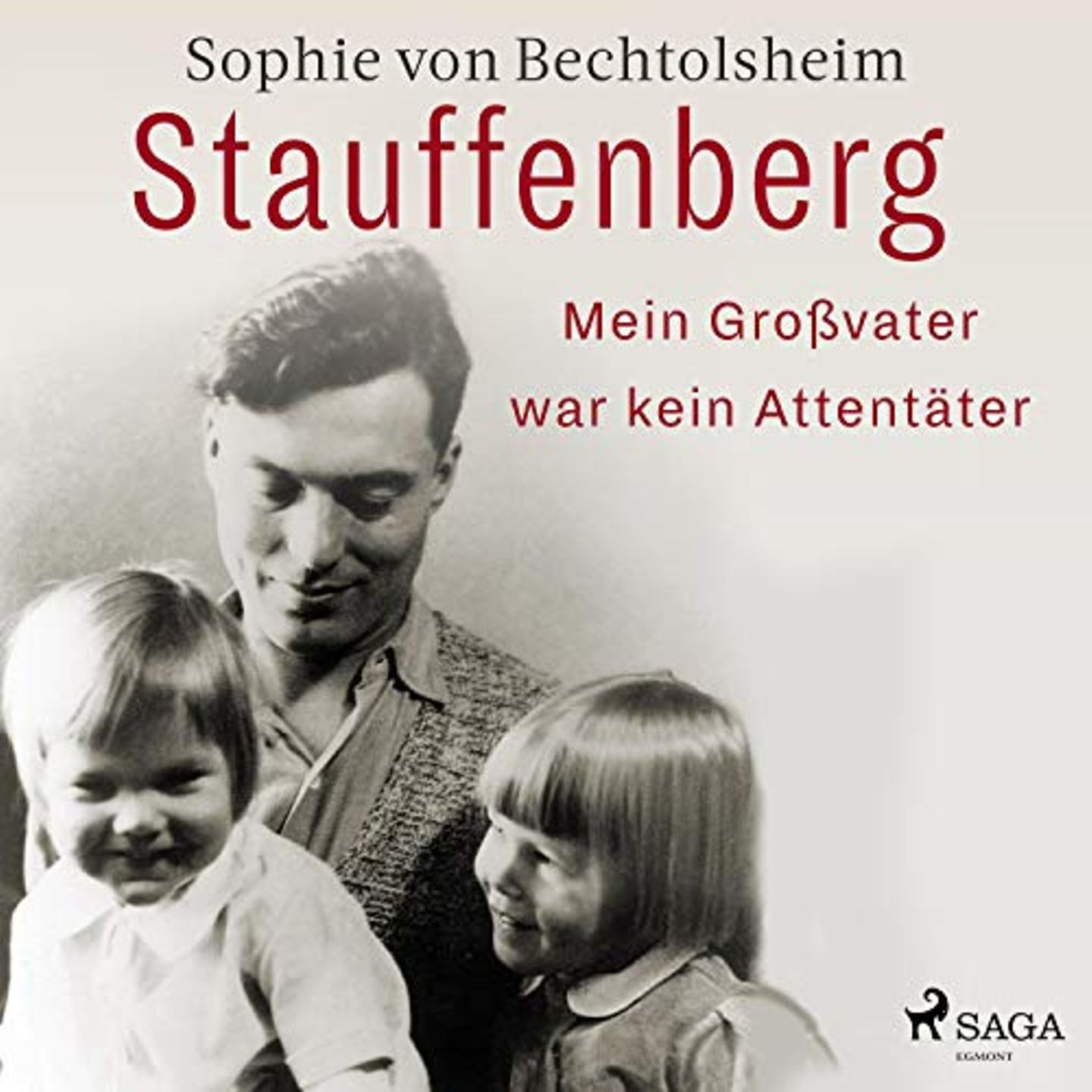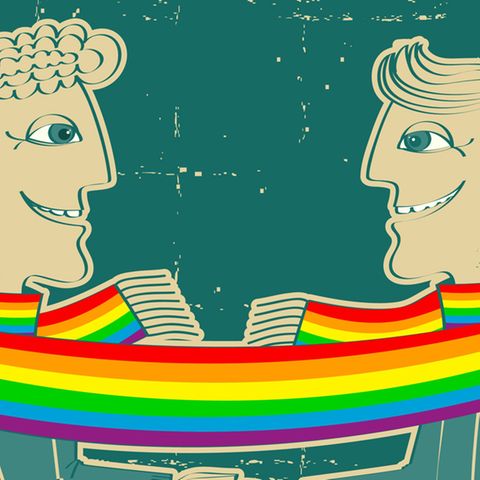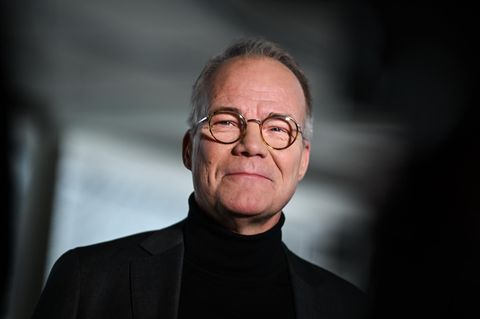In Deutschland ist der 27. Januar Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. An diesem Tag im Jahr 1945 hatten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz im besetzten Polen befreit. Mehr als eine Million Menschen wurden ermordet, zumeist Juden.
Seit 1996 ist dieser Tag in Deutschland ein Gedenktag.
In diesem Jahr gedenkt der Bundestag erstmals der Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung von Angehörigen sexueller Minderheiten. Schwule Männer, aber auch lesbische Frauen und Transsexuelle wurden im Zuchthaus und in Konzentrationslagern gequält. Der Strafrechtsparagraf 175 diente den Nazis als Legitimation, später verschärften sie ihn drastisch.
Die Geschichte der queeren NS-Opfer wurde lange in der Forschung, der Aufarbeitung und der Erinnerung missachtet. "Sie galten nicht als 'würdige' Opfer, noch nicht einmal als Opfer", erklärte dazu der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne). "Die Gedenkstunde im Bundestag beendet eine schmerzhafte, viel zu lange Ignoranz von erlittenem Leid und holt die queeren Opfer in das kollektive Gedächtnis."
Paragraf 175 stammt aus der Kaiserzeit
Der Paragraf 175 wurde am 15. Mai 1871 eingerichtet, noch zu Zeiten des Kaiserreichs. Er verbot "widernatürliche Unzucht" zwischen Männern, bestraft wurde sie mit Gefängnis. Auch die "bürgerlichen Ehrenrechte" konnte entzogen werden.
In den Jahren darauf gab es Bemühungen, den Paragrafen zu entschärfen und sogar ganz zu streichen. Im Oktober 1921 – in der Weimarer Republik – wollte der SPD-Politiker und Reichsjustizminister Gustav Radebruch die "einfache Homosexualität" straffrei halten. Sein Vorstoß wurde von der Regierung jedoch nicht bearbeitet.
Dabei war die Zeit der Weimarer Republik, die Zeit zwischen den Weltkriegen, eine vergleichsweise offenere. Die Hauptstadt Berlin galt als Magnet für queere Menschen, da man sich dort anonymer bewegen konnte. Auch schon vor dem Ersten Weltkrieg soll es dort Lokale für Homosexuelle gegeben haben. Beliebt war etwa das "Eldorado".

In der "Hauptstadt der Homosexuellen" befand sich seit dem 19. Jahrhundert auch die weltweit erste Schwulenorganisation, das "Wissenschaftlich-humanitäre Komitee" des jüdischen Arztes und Sexualforschers Magnus Hirschfeld. Er setzte sich gegen die Stigmatisierung queerer Menschen ein und verbreitete die Ansicht, dass diese nicht krank seien.
Dennoch gab es Angriffe auf queere Menschen; viele von ihnen versteckten ihre Identität in der Öffentlichkeit.
Nationalsozialismus: Homosexuelle verfolgt und in KZs deportiert
Im Oktober 1929 empfahl der Strafrechts-Ausschuss des Reichstages mit knapper Mehrheit eine Straffreiheit der "einfachen Homosexualität" unter Erwachsenen. Die Krise Anfang der 1930er-Jahre und das Erstarken der Nationalsozialisten verhinderten aber deren Umsetzung.
Mit der Machtergreifung der Nazis 1933 verschlechterte sich die Situation queerer Menschen dann massiv. Im Februar desselben Jahres ordnete NSDAP-Innenminister Hermann Göring an, Lokale zu schließen, "die den Kreisen, die der widernatürlichen Unzucht huldigen, als Verkehrslokale dienen". Es kam zu Razzien, Zeitschriften und Bücher wurden verboten und Verlage geschlossen. Wenige Wochen später wurden die ersten homosexuellen Männer in Konzentrationslager (KZ) deportiert.
Das Ziel der Nationalsozialisten: Die "Schwächung der allgemeinen Volkskraft", also der Bevölkerungszahl, verhindern.
Es wurden Listen "sämtlicher Personen, die sich irgendwie homosexuell betätigt haben", angefertigt. Es kam zu weiteren Razzien und Verhaftungen Homosexueller, die als "entartet" oder "Volksschädlinge" beschimpft wurden. Wenn queere Menschen zudem jüdischen Glaubens waren, war eine Verfolgung noch wahrscheinlicher.
Im Jahr 1935 wurde mit der deutlichen Verschärfung des Paragrafen 175 die Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung gegründet. Nicht nur schwuler Sex war von nun an strafbar. Selbst ein Brief, ein Blick oder Lächeln konnten als "wollüstige Absicht des Täters" gedeutet und bestraft werden. Während der Nazi-Zeit wurden etwa 50.000 Urteile wegen "Unzucht" unter Männern gefällt.
Todesrate der homosexuellen KZ-Häftlinge lag bei 60 Prozent
Schwulen wurde aber die "freiwillige" Kastration ermöglicht. Viele Homosexuelle sahen darin die einzige Möglichkeit, Haft und Konzentrationslager zu entkommen. Von Freiwilligkeit konnte also nur schwer die Rede sein. Ab 1942 wurde die Zwangskastration in den KZs erlaubt.
1940 ordnete Heinrich Himmler, Reichsführer SS, an, dass alle unter Paragraf 175 verurteilten in "polizeiliche Vorbeugehaft" genommen werden sollen. Im Klartext bedeutet das: Konzentrationslager. Die dort hin verschleppten Männer mussten den "rosa Winkel" tragen, ein Erkennungszeichen. Ab 1941 konnte sogar die Todesstrafe für homosexuelle Männer verhängt werden.
Es wird geschätzt, dass zwischen 10.000 und 15.000 Männer wegen ihrer Homosexualität in Konzentrationslagern gefangen gehalten wurden. Schwerstarbeit, Schikanen der Wachleute und medizinische Experimente waren dort Alltag. Die Todesrate der homosexuellen KZ-Häftlinge lag bei 60 Prozent.
Homosexuelle Frauen wurden weniger verfolgt als schwule Männer. In den Augen der Nationalsozialisten waren sie weniger bedrohlich. Weibliche Homosexualität war nur im später "angeschlossenen" Österreich strafbar. Doch auch wenn straffrei: Lesbische Frauen waren Repressionen ausgesetzt, besonders, wenn sie im Konflikt mit dem NS-Regime standen.

2002 wurden homosexuelle Opfer des NS-Regimes rehabilitiert
Noch heute ist die Lage der queeren Frauen in der NS-Zeit wenig untersucht, da es für lesbische KZ-Gefangene keine eigene Häftlingskategorie gab. Forschende diskutieren auch, ob Paragraf 175 nur für Männer oder auch Frauen galt. Einige Fälle von Frauen sollen aber belegen, dass bei "deren Konzentrationslagerhaft das Lesbischsein eine ursächliche Rolle gespielt haben könnte".
Lange wurden die homosexuellen Opfer des NS-Regimes nicht beachtet oder gar anerkannt. Erst 2002 wurden sie vom Bundestag rehabilitiert.
Dieses Unrecht war in der Aufarbeitung über Jahrzehnte hinweg allenfalls ein tabubehaftetes Nischenthema. Erst in den vergangenen Jahren hat sich die historische Forschung des Themas angenommen und schwule, lesbische und andere queere Menschen eindeutig als Opfergruppe des nationalsozialistischen Unrechts identifiziert.
Nach Ende der Nazi-Zeit ging die Verfolgung weiter
Schon seit 2018 lag dem Bundestag eine Petition mit der Forderung nach einer Würdigung für die queeren Opfer des Nationalsozialismus vor. Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) wollte die Anregung nicht aufgreifen. Dies änderte sich mit seiner Nachfolgerin Bärbel Bas (SPD).
"Es ist mir sehr wichtig, dass wir heute der Menschen gedenken, die wegen ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität verfolgt wurden", sagte sie in ihrer Gedenkrede im Bundestag. Bas erinnerte an "die vielen Tausend Frauen und Männer, die aufgrund ihrer Sexualität – teils unter Vorwänden – in Konzentrationslager deportiert wurden".
Sie sprach in ihrer Rede aber auch die Fortsetzung des Unrechts und der Diskriminierung nach dem Ende des Nationalsozialismus an.
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Nazi-Herrschaft endete zwar der Terror gegen Homosexuelle. Doch der Paragraf 175 blieb weiter in Kraft, sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR. Manche der befreiten homosexuellen KZ-Insassen mussten sogar ihre Reststrafe im normalen Vollzug zu Ende verbüßen.
Paragraf 175 wird erst 1994 gestrichen
In der neu gegründeten Bundesrepublik wurden sogenannte "rosa Listen" mit den Namen Homosexueller weitergeführt; Verurteilungen aus der NS-Zeit waren in den Anfangsjahren der Republik noch immer rechtens. 1950 kam es in der Bundesrepublik sogar zur "Aktion gegen Homosexuelle", bei der etwa 100 Personen verhaftet und 75 Anklagen erhoben wurden. 45.000 Menschen wurden in den ersten 15 Jahren der Bundesrepublik wegen Verstoßes gegen Paragraf 175 verurteilt.
Erst 1969 tat sich in Westdeutschland etwas – eine Folge der 68er-Bewegung, der Zeit der sexuellen Revolution. Homosexualität unter erwachsenen Männern über 21 war von diesem Zeitpunkt an straffrei. Vier Jahre später wurde das Alter auf 18 Jahre herabgesetzt; das sogenannte Schutzalter bei heterosexuellen Handlungen betrug hingegen 14 Jahre. Bis in die 1990er-Jahre wurde in der Bundesrepublik der Paragraf 175 aber noch angewendet.
Auch in der DDR kam es zur Verfolgung von Homosexuellen, wenn auch in geringerem Maße als in Westdeutschland. Paragraf 175 bestand bis 1968, der dann durch Paragraf 151 ersetzt wurde. Dieser erlaubte Homosexualität unter Männern und Frauen. Sexuelle Handlungen von homosexuellen Männern und Frauen mit Minderjährigen blieben strafbar. 1988 wurde Paragraf 151 ganz gestrichen, das Schutzalter angeglichen. Dennoch waren Bespitzelung und Repressalien in der DDR Alltag für Homosexuelle.
Mit der Wiedervereinigung und dem Zusammenführen der Rechtssysteme der beiden deutschen Staaten wird Paragraf 175 im März 1994 endgültig gestrichen.
Heute erinnern in Deutschland Denkmäler an die Verfolgung Homosexueller. Etwa der "Frankfurter Engel" oder das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin.
Quellen: Bundeszentrale für politische Bildung (1), Bundeszentrale für politische Bildung (2), Bundeszentrale für politische Bildung (3), Bundeszentrale für politische Bildung (4), "Frankfurter Engel", Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Lebendiges Museum online, Antidiskriminierungsstelle des Bundes, LSVD, Arolsen Archives, osqar.de