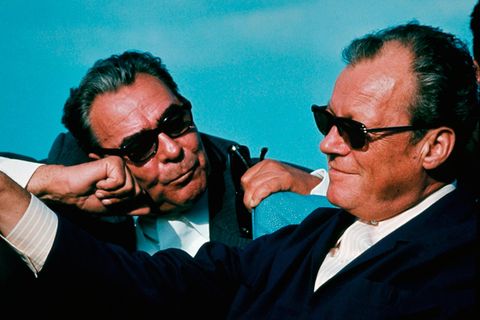Nach dreißig Jahren immer noch dieses Bild: Willy Brandt im Fraktionssaal der SPD am 7. Mai 1974, die Hände, wie nicht dazugehörig, parallel auf dem Tisch, das Gesicht versteinert. Gerade hat Herbert Wehner dem scheidenden Kanzler einen mächtigen Strauß roter Rosen in Zellophan überreicht und seine Stimme hat sich dabei fast überschlagen: "Wir alle lieben ihn!" Egon Bahr war in Tränen ausgebrochen - über diese "Gemeinheit und die Heuchelei", wie er später schreibt. Willy Brandt scheint nichts vom Aufruhr der Genossen um ihn herum wahrzunehmen, die Augen gehen ins Leere. In den Falten um seinen Mund liegen tiefe Schatten.
Ein unmissverständlicher Hinweis
"Judas!" haben wir uns empört damals über "Onkel Herbert", und immer noch, wenn ich an den Rücktritt Willy Brandts denke, sehe ich dieses Bild vor mir, höre ich die Stimme Herbert Wehners, der den Kanzler ein paar Tage zuvor auf einer Klausurtagung in Münstereifel scheinheilig seiner "uneingeschränkten Treue für jede denkbare Entwicklung" versichert hat. Aber er tat nichts, um Brandt im Amt zu halten - für den Kanzler der unmissverständliche Hinweis, dass der allmächtige Fraktionschef seinen Rücktritt für unumgänglich hielt.
Im Nachhinein ist das ja gar nicht verkehrt gewesen: Für die kommenden Jahre, zunehmend dominiert von der Auseinandersetzung um die RAF, war Helmut Schmidt mit Sicherheit der bessere Kanzler. Für Brandt selbst bedeutete dieses Ende den Beginn einer glanzvollen internationalen Karriere als Präsident der Sozialistischen Internationale, als Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission, als begehrter Ratgeber von Regierungschefs in aller Welt. Aber für uns, für den sozialdemokratischen Teil des Wahlvolks, war der Rücktritt der Beleg für die Ranküne in der Politik, für Verrat und Machtversessenheit.
Wibke Bruhns
Die Journalistin begegnete Willy Brandt als TV-Moderatorin und stern-Autorin und verbrachte mit ihrer und der Kanzlerfamilie Ferien in Norwegen. Ihr Fazit: In Gefühlsdingen war der Kanzler sprachlos. Bruhns' kürzlich erschienenes Buch "Meines Vaters Land" wurde ein Bestseller.
Dass die DDR dem Kanzler der Bundesrepublik, dem Architekten der Entspannungspolitik, eine Laus in den Pelz gesetzt hatte in Gestalt des Spions Günter Guillaume, war schlimm genug. Schlimmer war die hanebüchene Inkompetenz des Verfassungsschutzes in diesem Fall, das Lavieren der verantwortlichen Mitarbeiter von Innenminister Genscher bis zu Kanzleramtschef Horst Grabert. Am schlimmsten war die Demontage des Mannes, der angetreten war, "mehr Demokratie zu wagen".
Mobilisierung quer durch alle Schichten
Denn das hatte er unter die Menschen getragen. Nie zuvor und seither niemals wieder haben sich Bürger in der alten Bundesrepublik mit einer solchen Leidenschaft für ihren Staat, seine Politik und deren Protagonisten engagiert. Die Mobilisierung ging quer durch alle sozialen Schichten, Abertausende Menschen waren aktiv und kreativ, von Dichterfürsten wie Heinrich Böll und Siegfried Lenz bis zur bayerischen Bäckersfrau, Menschen, die bisher Politik immer anderen überlassen hatten. Alles kristallisierte sich um die sozialliberale Regierung, knäuelte sich fest am Kanzler, an Willy Brandt.
Das war anderthalb Jahre vor seinem Rücktritt, ich rede vom Wahljahr 1972, die Zeit, in der ich Willy Brandt begegnet bin. Weder der Kniefall in Warschau noch der Friedensnobelpreis, auch nicht die weltweite Anerkennung der neuen Ostpolitik hatten dem Regierungschef im eigenen Land zu einem Konsens verhelfen können. In einer beispiellosen Kampagne versuchte die Union, den Verlust der Macht von 1969 noch vor Ende der Legislaturperiode rückgängig zu machen. Willy Brandt sollte ein Übergangskanzler bleiben, ein Irrtum der Geschichte, der von den Christdemokraten schleunigst bereinigt werden würde.
Durch Überläufer war die ohnehin knappe Mehrheit der Regierung Brandt/ Scheel im Bundestag geschmolzen. Rainer Barzel versuchte am 27. April sein konstruktives Misstrauensvotum. Er scheiterte, zwei Stimmen fehlten. Draußen im Land hatten sich überall Menschentrauben vor den Fernsehgeschäften versammelt, es herrschte eine stumme, gespannte Erwartung. Dann das Ergebnis.
Wildfremde Leute umarmten sich, das Fernsehen zeigte jubelnde Bergleute und Automonteure. Wie versteinert ging der Kanzler durch die völlig aus dem Häuschen geratenen Fraktionskollegen, nicht die Andeutung eines Lächelns stand im Gesicht. Er und Rainer Barzel drückten sich stumm die Hand.
50 000 Mark für ein Votum gegen Barzel
Damals kannte ich Willy Brandt noch nicht. Aber ich war Teil dieser wütenden Empörung, die durchs Land zog, weil das Misstrauensvotum nicht als eine demokratische Spielart des Machtwechsels angesehen wurde. Stattdessen vermuteten wir wüste Verschwörungen, wo Stimmenkauf Parlamentarier dazu brachte, die Seiten zu wechseln. So war es ja auch, wie wir heute wissen. Zusätzlich mischte die Stasi mit, die den CDU-Abgeordneten Julius Steiner mit 50 000 Mark zum Votum gegen Barzel veranlasste.
Im darauf folgenden Sommer, im Garten des Brandtschen Ferienhauses im norwegischen Vangsasen bei Hamar, erhielt ich von Brandt eine politische Nachhilfestunde über die Nachtseiten des Machterhalts. Zwar sprach er nicht expressis verbis davon, die SPD habe es dem politischen Gegner gleichgetan. Aber in seinen langen, von Konjunktiven durchflochtenen Sätzen näherte er sich umschweifig der Überlegung, dass Anstand angesichts offenkundiger Schweinereien auf der anderen Seite der eigenen Sache nicht nur nicht nützen, sondern vermutlich eher schaden würde.
Damals war ich ziemlich fassungslos. Wir hatten einen fulminanten Wahlkampf hinter uns, in dem Gut und Böse klar definiert, Politik so einfach gewesen war. Das Gute waren die Ostpolitik und die zahlreichen innenpolitischen Reformen, das Gute war dieser Kanzler, der eine makellose politische Biografie vorzuweisen und damit vielen erstmals eine Identifikation mit der Politik ermöglicht hatte. Das Böse war ebenso leicht auszumachen gewesen. Es kam völlig unmaskiert daher, über zwei Jahrzehnte vorbereitet durch die Kampagnen wegen Brandts unehelicher Geburt, seines "Agentennamens" (Brandt alias Frahm), gegen den "Vaterlandsverräter", weil er Hitler-Deutschland verlassen und eine norwegische Uniform getragen hatte.
Jetzt war die Bundesrepublik überflutet worden von millionenschweren Anzeigen mit dubiosen Deckadressen ("Wählerinitiative Patriotische Mitte" oder "Gesellschaft für konstruktive Politik"), in denen es hieß: "Wer Brandt wählt, wählt Bolschewismus" oder - zum Aussuchen - "Bandenterror", "Hurerei", "Mord an ungeborenen Kindern". Eine "Aktion Nüchterne Bürger" hatte mit dem Bild einer Schnapsflasche inseriert: "Lieber Rainer Barzel als reiner Korn Brandt".
Transporteur sozialdemokratischer Tugenden
Vor so viel Dreck war Willy Brandt zur Lichtgestalt geworden, und damit konnte er, konnten aber auch seine politischen Freunde schlecht umgehen. Dass ich mich dann später in meinem hehren Demokratieverständnis verraten fühlte, weil der Kanzler Stimmenkauf als politisches Mittel nicht grundsätzlich ausschloss, hatte etwas mit meiner Naivität zu tun und war allenfalls mein Problem. Aber der Wahlkampf und die Selbstdarstellung von Partei und Regierung waren überwiegend auf die Person Willy Brandts als Transporteur sozialdemokratischer Tugenden abgestellt gewesen. Das schürte nicht nur die Rivalität in den eigenen Reihen, etwa bei Schmidt und Wehner. Es führte auch zu Enttäuschung bei Weggefährten im weiteren Umfeld, Journalisten etwa oder Wahlhelfern wie Günter Grass, wenn der Mensch Brandt dem Bild Brandts nicht entsprach. Und das tat er nicht. Er war nicht schlechter, was immer das heißen mag, er war anders, als die Leute ihn sich gestrickt hatten. Ich war 1973 sechs Sommerwochen lang viel mit ihm zusammen in Norwegen, weil ich für den stern ein Porträt zu seinem 60. Geburtstag recherchierte. Rut Brandt hatte für meine Familie und mich ein Ferienhaus in ihrer Nähe besorgt.
stern-Spezial Biografie
Willy Brandts Weg vom Lübecker Arbeiterkind zum Kanzler und Friedens- nobelpreisträger beschreibt stern-Autor Andreas Hoidn-Borchers in der neuen Ausgabe des stern-Spezials Biografie.
In derselben Ausgabe erzählt die Brandt-Vertraute und Bestsellerautorin Wibke Bruhns über die Zeit mit "Willy", eine Zeit, in der Politik für viele zum sinnlichen Erlebnis wurde.
Es war der Guillaume-Sommer, der Anfang von Brandts Ende als Kanzler. Der DDR-Spion Günter Guillaume, Brandts persönlicher Referent, war als dienstliche Urlaubsbegleitung des Kanzlers mit von der Partie.
Ein Porträt über den Privatmann Willy Brandt zu schreiben, erwies sich als außerordentlich schwierig. Man kam an die Person nicht ran, nicht nur ich nicht, niemand. Wenn ich heute nachlese, was über Brandt "Menschliches" geschrieben wurde zu der Zeit, so ist das wenig, und es ist viel Projektion dabei - da wurde jemand skizziert, der sich als Vorlage verweigerte. Selbst Rut Brandt hat später mal gesagt: "Er sprach nicht."
Dabei redete er viel. Aber es waren immer die großen Weltentwürfe für ein freies, friedliches Mit- einander, und der lange Weg der kleinen Schritte bis zum Ziel. Vor mir hatte ich einen der Baumeister der Helsinki-Konferenz KSZE, die - wer konnte das damals schon wissen? - zur Erosion des östlichen Machtblocks führte und damit zur Wiedervereinigung Deutschlands. Willy Brandt dachte "über den Tag hinaus", und ich war fasziniert von der präzisen gedanklichen Detailarbeit dabei, von der großen Geduld, die dennoch keinen Zweifel ließ an seiner Beharrlichkeit. Dahinter aber verschwand das Private. Selbst in seinen Tagebüchern ist seitenlang zu lesen, was er in welcher Situation zu wem warum gesagt hat, aber fast nie, was er dabei empfunden hat. Egon Bahr hat mir mal auf die Frage, ob er den Menschen Brandt erlebt habe, sinngemäß geantwortet: Politiker sind wie Traber, getrimmt auf Höchstleistung in einer widernatürlichen Gangart, von Scheuklappen gehindert, die warme Welt zu sehen. Emotionale Krüppel seien sie - "das ist der Preis".
"Er war emotional nicht da"
Willy Brandt schien er nicht zu hoch zu sein. "Ich habe mich nicht nur an diese Art von Einsamkeit gewöhnt", steht als eine seiner wenigen persönlichen Anmerkungen in meinem Notizbuch. "Ich fühle mich insgesamt in ihr ganz wohl." Die Defizite lagen bei anderen. Brandts Sohn Peter erzählte mir in Norwegen, was früher in den Zeitungen teils bewundernd, teils harsch als des Kanzlers antiautoritäre Erziehung diskutiert wurde, sei in Wahrheit keine Erziehung gewesen: "Er war emotional nicht da." Peter Brandt argwöhnte zu der Zeit, vermutlich zu Recht, die vorgebliche Toleranz seines Vaters ergebe sich aus seiner Distanz. Er sei schlicht nicht interessiert.
Woran er interessiert war, außer dem Zustand der Welt und wie er zu verbessern sei, war nicht herauszubekommen. Vielleicht gab es ja tatsächlich nichts anderes. Wer abschweifen wollte auf Sport, Literatur, Musik, Kochrezepte, das Wetter, sah in ein leeres Gesicht, das sich derlei Konversation verbat. Ich wusste nach Wochen noch nicht einmal, was er gern isst. Meine kleine Tochter half in dem Fall, indem sie mir verriet: "Der Bundeskanzler isst keine Kartoffeln." Das hatte er ihr bei einem Abendessen erzählt.
Mitteilungen über sich selbst fanden nicht statt. Es gab noch nicht mal Abwehr bei ihm in diesem Punkt - Willy Brandt hat mir ja durchaus Zugang gewährt. Ich glaube, so wie viele Männer nicht über ihr Innenleben reden können, weil sie es weder kennen noch zulassen, wusste er schlicht nicht, was ich von ihm wollte. Und ich war immerhin eine geübte 68erin, trainiert im Durchbuchstabieren seelischer Befindlichkeiten. Aber bei allem Erstaunen über meine Unverfrorenheit, mit der ich damals zu Werke ging, haben mir meine vergeblichen Versuche zweierlei deutlich gemacht: Diese Kriegsgeneration war in Gefühlsdingen sprachlos, und Willy Brandt war ein besonders verschlossenes Exemplar.
Biografie als Abfolge chronologischer Daten
Selbst die Beschreibung seiner Kindheit in Lübeck - "unbehaust" hat er sie genannt -, seiner frühen Erfahrung mit den Nazis, der Reise im Fischkutter über die Ostsee in die Emigration, der Rückkehr in das zerstörte Deutschland nach dem Krieg geriet bei ihm zu einer Abfolge chronologischer Daten. Wo er seinen Bedarf an Wärme erfüllte, wie er mit Angst umging, Glücksmomenten, Phasen der Trauer oder Selbstzweifeln, nichts davon war von ihm zu erfahren, auch nicht "unter drei", dem journalistischen Kürzel für Hintergrundinformationen, die nicht veröffentlicht werden dürfen.
In meinem Brandt-Porträt damals bin ich ausgewichen auf einen Satz von ihm aus dem Jahr 1960, den ich in einem seiner frühen Bücher gefunden hatte. "Ich war beliebt, sogar populär im Kreise der Schulkameraden und Jugendgenossen", schreibt er da. "Aber soweit ich in Frage kam, blieben diese Beziehungen meist äußerlich. Es gab kein starkes Gefühl, dem ich mich rückhaltlos ausliefern konnte."
Heute nennen Wissenschaftler eine solche psychische Beschaffenheit "Gefühlsblindheit", und das trifft es bei Willy Brandt ziemlich genau. Zahlreiche Weggefährten hat er verprellt - Herbert Wehner, Helmut Schmidt, auch Günter Grass - weil er Nähe nicht zulassen konnte, zu Freundschaften nicht fähig war. Ihre Wutausbrüche und Illoyalitäten aus enttäuschter Liebe haben Brandt schwer beschädigt. Egon Bahr, der Freund, ist die einzige Ausnahme, von der ich weiß, und der hat Brandts "Fernsein" immer akzeptiert.
Vergnügliche Abendessen im norwegischen Garten
Sich auf einzelne Menschen einzulassen war Brandts Sache nicht. Er mochte Leute um sich haben, am liebsten in Gruppen, wo die Gefahr nicht bestand, dass ihn jemand mit Persönlichem belästigte. Dann war er witzig, schlagfertig, entspannt - wir haben mit anderen Gästen vergnügliche Abendessen in seinem norwegischen Garten erlebt, wo die hinreißende Rut Brandt mit ihrer Wärme und ihrer Selbstverständlichkeit jedem das Gefühl vermittelte, er sei besonders willkommen.
In solchen Situationen erzählte Brandt auch keine Witze. Diese Übung war für Genossen-Abende und Journalistenrunden reserviert - die auf Insiderinformationen hungrige Meute zum Lachen zu bringen, Anekdoten preiszugeben, scheinbar zugewandt und mitteilsam zu sein und nichts, aber auch gar nichts zu erzählen. Brandt hat viele Stunden im Kanzlerzug mit derlei Exerzitien zugebracht.
Überhaupt, die Genossen. Ich hatte mir damals notiert: "Brandt hat ein großes Herz für kleine Leute. Aber er will sie um Gottes willen nicht um sich haben." Das verlangt im Ernst auch keiner vom Kanzler dieser Republik. Aber bei den Sozialdemokraten spielen - zu jener Zeit noch mehr als heute - der Stallgeruch, das Zusammenrücken, das distanzlose Du eine größere Rolle als in anderen Parteien. Willy Brandt hat sich damit schwer getan. Sein Terrain war die Weltpolitik, nicht der Ortsverein. Aber dort hat man Brandt geliebt. Er verkörperte die ganze Latte sozialdemokratischer Schinderei: kleiner Leute Kind, einer von uns, der nach Jahren gröbster Anfeindungen und hinterhältiger Machenschaften des Großkapitals endlich der Gesellschaft das neue Gesicht verleiht. Versöhnung nach außen, Gerechtigkeit nach innen, es gibt viel zu tun, wer denn, wenn nicht er, soll es anpacken.
Buch-Tipps
Gregor Schöllgen: Willy Brandt. Die Biographie. Propyläen. 320 Seiten. 25 Euro. Kurz und gut. Für alle, die wenig Zeit haben und das Wesentliche über Brandt wissen wollen.
Peter Merseburger:
Willy Brandt. Visionär und Realist. DVA. 927 Seiten. 32 Euro. Dick und detailverliebt. Für alle, die viel Zeit und Interesse auch an Nebensächlichkeiten haben.
Arnulf Baring:
Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel. DVA. 831 Seiten. 25 Euro. Für Spezialisten, die wirklich alles über Aufstieg und Fall des Kanzlers Brandt wissen wollen.
Hermann Schreiber:
Kanzlersturz. Warum Willy Brandt zurücktrat. Econ. 271 Seiten. 22 Euro. Für Überflieger, denen ein flott geschriebener Überblick über die Affäre Guillaume genügt.
Mit diesem Elan scharten sich die Parteitruppen hinter Willy Brandt, aber nicht nur sie. Neuwahlen wurden nach dem gescheiterten Misstrauensvotum festgesetzt für den 19. November 1972, und draußen krempelten die Menschen die Ärmel hoch. Denn bei aller Distanz, die Willy Brandt für sich beanspruchte, was er erzeugte im Wahlvolk war Nähe - Nähe zu ihm, vor allem jedoch Nähe der Menschen untereinander.
Farbe bekennen war das Leitmotiv
Eine Million "Willy wählen"-Buttons waren im Umlauf, mindestens noch einmal so viele Buttons der Sozialdemokratischen Wählerinitiative "Bürger für Brandt". Die Leute trugen sie am Mantel, bepflasterten ihre Autos und Fahrräder mit Wahlslogans - an Ampeln lachten sich wildfremde Gleichgesinnte an, überall in Zügen und Straßenbahnen, auf der Straße gab es spontane Gespräche. Farbe bekennen war das Leitmotiv dieser Wahlkampfwochen. In der Kartei der Sozialdemokratischen Wählerinitiative waren die Namen von rund 70 000 ehrenamtlichen Wahlhelfern registriert, die Mehrzahl keine Parteimitglieder. Die "Bürger für Brandt" mobilisierten die schweigende Mehrheit für ihre Straßenfeste, Kunstauktionen, Informationsabende.
Sie schalteten Kleinanzeigen, holten Popstars, Sportler, Wissenschaftler auf ihre Podien. Es war harte, hochpolitische Kleinarbeit. Aber es war wie ein großes Fest. Es gab das gemeinsame Ziel, "mehr Demokratie" zu wagen, und immer mehr Menschen begriffen: Auf dich kommt es an.
Die Kundgebungen mit Willy Brandt hatten gigantische Besucherzahlen - 35 000 in Essen, 20 000 in Hannover, 17 000 in Köln. Ich hatte ihn kennen gelernt auf der Schlussveranstaltung in der Bonner Beethoven-Halle, die ich zwei Tage vor der Wahl moderierte. Zum ersten Mal erlebte ich, mit welcher Intensität er einen Saal füllen konnte. Er sprach frei, schien immer wieder nachzudenken, wie er seine Sache am besten erklären könne. Die zögerliche Sprechweise suggerierte in ihrer Eindringlichkeit jedem Einzelnen da unten, er sei gemeint, er sei wichtig, gerade bei ihm komme es Brandt darauf an, verstanden zu werden. Das war auch so - aus der Ferne war Willy Brandt sehr zugewandt. Und er war von Grund auf glaubwürdig. Ich erinnere mich, dass ich die Veranstaltung schloss mit der Feststellung, ich würde Willy Brandt wählen, "nicht um seinetwillen, sondern aus purem Egoismus". Auch das war so.
Zwischen Triumph und innenpolitischen Turbulenzen
Der Triumph der gewonnenen Wahl wurde zerschlissen in innenpolitischen Turbulenzen - Ölkrise, Fluglotsenstreik, härteste Auseinandersetzungen um überhöhte Lohnforderungen der ÖTV. Der Kanzler war gesundheitlich angeschlagen, eine Stimmbandoperation und allgemeine Erschöpfung setzten ihn längere Zeit außer Gefecht. Seine fehlende Durchsetzungskraft wurde immer öfter Gegenstand öffentlicher Kritik. Sie gipfelte in Herbert Wehners Ausfällen gegen Brandt während einer Moskaureise im Herbst 1973: "Der Herr badet gern lau" und "der Regierung fehlt ein Kopf".
Wehner blieb ungestraft, der Parteivorstand stellte sich mit zwölf gegen elf Stimmen hinter ihn. Die Guillaume-Affäre danach war nur noch der letzte Anstoß für das Ende.
Am 1. Mai 1974, eine Woche nach der Verhaftung des DDR-Spions, war Willy Brandt auf seiner letzten Reise als Kanzler unterwegs, ein lang geplanter Ausflug nach Helgoland. Kurz zuvor hatte er durch Innenminister Genschers Büroleiter Klaus Kinkel in Hamburg eine Liste präsentiert bekommen, in der die Aussagen seiner Leibwächter über angebliche Treffen mit Damen verzeichnet waren, die ihm Guillaume "zugeführt" haben soll. Brandt ahnte wohl, dass er dies nicht durchstehen könne, dass nach den jahrzehntelangen Diffamierungskampagnen der rechten Massenblätter ihn jetzt die Kombination von Sex und Spionagethriller zur Strecke bringen werde.
Wir, die mitreisenden Journalisten, ahnten von dieser Liste nichts. Es war trostloses Wetter, Willy Brandt verschanzt hinter seinem steinernen Gesicht. Wir trauten uns nicht, ihn anzusprechen, schon gar nicht auf Guillaume. Am Anleger war außer ein paar Genossen und dem Bürgermeister niemand zum Empfang erschienen. Die Insel schien zu dieser späten Nachmittagsstunde wie ausgestorben. Die Tagesgäste waren abgereist, die Helgoländer hockten in ihren warmen Stuben und sahen Fußball. "Mit Günter wäre das nicht passiert", wurde flüsternd unter den Kollegen herumgereicht - Guillaume hätte den Kanzler mitten ins Gewühl der Butterschiffe geschickt und die Fußballzeiten im Kopf gehabt.
"Scheißleben!"
Es wurde ein Schunkelabend mit viel Alkohol und "Herrn Pastor sin Kau-jau-jau". Die tapferen Genossen hauten dem großen Vorsitzenden aufmunternd auf die Schulter - "wi mok dat schon!" Brandt, der solche Abende ohnehin schwer aushielt, griff zum bewährten Abwehrmittel: Er erzählte Witze. Mitten im trunkenen Trubel starrte er plötzlich auf seine Hände. "Scheißleben!", murmelte er.
Am nächsten Morgen hatte Brandt einen Kater und erschien mit einer Anzugjacke, die nicht zur Hose gehörte. Der Ersatzreferent, ein unerfahrenes Kerlchen, ließ den Kanzler und alle anderen warten, weil er nicht rechtzeitig aus dem Bett gekommen war. Es wurde eine ungemütliche Rückfahrt über raue See.
Vier Tage später, am 6. Mai 1974, trat Willy Brandt zurück.