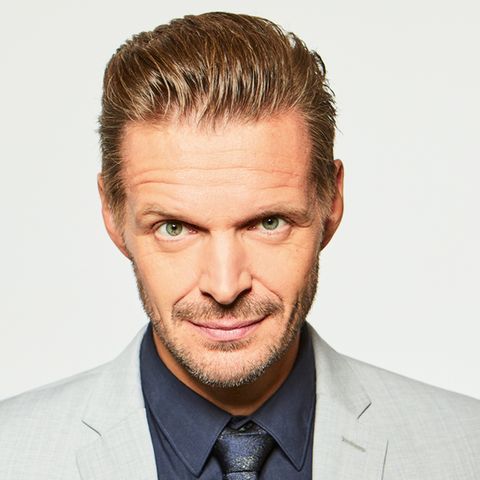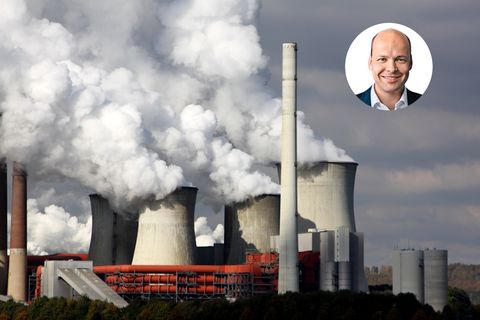In Wahlkämpfen, heißt es oft, will man über die Zukunft und Ideen reden und streiten – aber es ist die harte und brutale Gegenwart und Wirklichkeit, die uns seit Wochen beschäftigt und den Atem raubt: Afghanistan, Hochwasser, Pandemie. Die Kandidaten und die Kandidatin versuchen zwar, aus dem Schrecken und den Reaktionen Lehren für die Zukunft zu destillieren, Formeln wie: "Das zeigt doch, dass wir künftig XY machen müssen."

Aber 2030 oder 2045 sind wieder weit weg und abstrakt, wenn wir evakuieren, retten, Menschen sterben, Menschen um ihr Leben fürchten, oder in einer Flut alles verlieren. Unser Gehirn kann sich Kipppunkte in einigen Jahrzehnten ohnehin schwer ausmalen – das kennen wir von der Inflation, von Renditen und Renten. In Tagen wie diesen interessieren Wegmarken wie 2030 kaum.
Afghanistan entscheidet keine Wahl, weil die Bilder zwar entsetzen, aber den Alltag der Wähler unmittelbar nicht betreffen. Wie auch diese Woche, in Afghanistan geht es um Schicksale, nicht das "Schicksalsjahrzehnt". Zu Recht, weil der blutige Anschlag am Kabuler Flughafen die angekündigte Katastrophe in der Katastrophe war. Der letzte Flieger der Bundeswehr hat Kabul verlassen, die Evakuierung ist beendet, ohne abgeschlossen zu sein – doch die beteiligten Soldaten haben in dieser kurzen Zeit in diesem Chaos Großes geleistet.
Dunkle Stunde statt Sternstunde
Es gab diese Woche eine historische Sondersitzung des Deutschen Bundestages: Ursprünglich sollte nur ein Hilfspaket für die Hochwasserkatastrophe beschlossen werden. Doch natürlich drängte Afghanistan auf die Agenda und die Pandemie – drei Großthemen, die als Hintergrundwucht diesen Wahlkampf prägen. Und alle drei kreuzten sich diese Woche noch einmal im Parlament, in einer Sitzung. Dunkle Stunde statt Sternstunde.
Um mit dem Hochwasser anzufangen – weil das Urteil hier noch am einfachsten fällt: Der Wiederaufbaufonds in Höhe von 30 Milliarden Euro ist natürlich richtig und notwendig. Er ist auch ein interessantes Symptom dafür, in welchem Tempo unser Staat inzwischen in den Krisenmodus gehen und solche Pakete schnüren kann. Bei der Prävention empfinden wir ihn oft als zu schwach, hinterher kommen Bazooka und Wumms. Auch wenn man ein Jahrhunderthochwasser nie verhindern kann: Es wäre gut, wenn wir künftig vielleicht mehr Geld vorher investieren, als immer nur hinterher Schäden zu beheben.
Ums Hinterher ging es auch bei der Regierungserklärung von Angela Merkel zu Afghanistan. Die Kanzlerin gab sich etwas achselzuckend, ihre Kernbotschaft: "Hinterher ist man immer klüger." Das stimmt, denn alle, die sich empören – inklusive uns Medien – müssen auch bekennen, die Lage "offensichtlich unterschätzt" zu haben. Sonst hätte man im Sommer mehr Ressourcen in die Recherchen über Ortskräfte als über Plagiate gesteckt.
Und doch passte dieser Satz zur Kanzlerin, und es ist eine bittere Ironie, dass er einer der letzten ist, den sie im Bundestag gesprochen hat. Er passt, weil sie immer im Hinterher und Danach agierte, als Krisenkanzlerin in großen Krisen. Das machte sie gut und verlässlich, hierfür wurde sie geschätzt und verehrt, hier wuchs sie, formte ihre Größe und ihr politisches Kapital. Ihre Pläne kamen zu selten aus einem Impuls für die Zukunft, die Kraft wurde eingesetzt für Fehler oder Versäumnisse der Vergangenheit. Ihre größten Pakete kamen immer danach, als Hilfe und Rettung.
Mehr "Tanz" als "Hammer"
Bleibt die Pandemie als drittes Megathema im Bundestag: Die Verlängerung der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" mit all ihren Sonderbefugnissen für Corona-Maßnahmen war unangemessen – was nicht heißt, dass die Pandemie vorbei ist. Es sind zu grobe und große Befugnisse, die man sich mit Bazooka-Energie nimmt. Zu Recht mahnte die Opposition, dass für solche Dimensionen des möglichen Eingriffs die rechtliche Grundlage fehlt. Das würden im Zweifel auch Gerichte so sehen.
Im besten Fall bleibt der Beschluss auf dem Papier und die Waffenkammer zu – denn gewichtige Stimmen in der Hauptstadt senden eine andere Botschaft: Es wird keinen klassischen Lockdown mehr geben, sondern ein Leben zwischen "2G" und "3G", mehr "Tanz" als "Hammer". Es ist richtig, dass der Inzidenzwert, auf den wir seit 18 Monaten jeden Tag starren, nach hinten rückt und andere Werte wie die Krankenhausbelegung entscheiden.
Wir werden bis zum Ende des Jahres das tun müssen, was wir seit Januar tun: impfen. Die Ressourcen sind da, der Wille nicht überall. Aber das bleibt essenziell, wichtiger als die inzwischen sakrale Lockdownarchitektur der Schutzmaßnahmen. Anders gesagt: Ein "Beherbergungsverbot" – die bizarre Schöpfung aus der Not des vergangenen Herbstes – wird es wohl nicht mehr geben.
Es ist schwer auszumachen, wie und ob diese drei Großthemen auch die Wahl bestimmen – zumal die anderen wichtigen Themen, die Menschen bei Umfragen nennen, ja nicht verschwinden: Migration, Altersvorsorge, Demografie, Digitalisierung. Aber die Ereignisse haben Bilder produziert, mit und ohne Kandidaten, die in den Köpfen spuken.