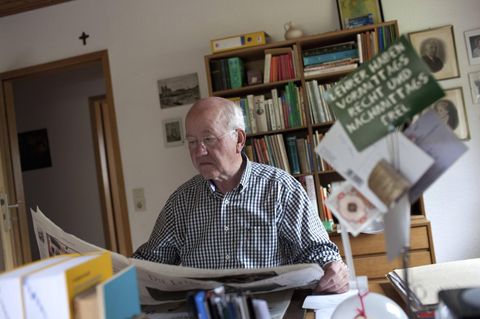Am Anfang war das Schwein. Erst danach kam das Wort: "Eberle". Das pinselten die Bauern der Sau auf die Flanke und trieben sie durchs Dorf. Und weil's so schön war, eine zweite hinterher. Auf der stand "Filbinger". Hans Filbinger war damals Ministerpräsident in Baden-Württemberg und Rudolf Eberle sein Wirtschaftsminister. 1973 hatten sie beschlossen, im Dörfchen Wyhl am Kaiserstuhl ein Atomkraftwerk zu bauen. Die Winzer fürchteten, die Nebelschwaden aus den Kühltürmen könnten ihrem Wein schaden. Da ließen sie die Sau raus. In den Geschichtsbüchern wird einmal stehen: Die Schweinsjagd von Wyhl war die allererste Protestaktion gegen ein Atomkraftwerk in Deutschland. Sie markiert den Beginn einer Bewegung, die 37 Jahre später noch immer Zehntausende auf die Straße treibt, die nun schon die zweite Protestgeneration hervorbringt. Womöglich wird die Demonstration vom Wochenende einmal als der Auftakt zur Anti-AKW-Bewegung, zweiter Teil, in die Geschichte eingehen.
Schon wenige Wochen nach dem Spaß der Wyhler Bauern wurde es ernst: Am 23. Februar 1975 besetzten Kernkraftgegner den Bauplatz, auf dem das Kraftwerk entstehen sollte. Zum ersten Mal Randale am Bauzaun und Demonstranten, die ein Hüttendorf bauten. Die Auseinandersetzung um die zivile Nutzung der Atomkraft hat die Bundesrepublik so nachhaltig verändert wie außer ihr nur das Wirtschaftswunder, die Studentenunruhen und die Wiedervereinigung. Sie spaltete Parteien, Familien, die gesamte Gesellschaft und war der eigentliche Grund für die Gründung der Grünen. Ganze Generationen wurden politisiert im Schein der roten Sonne auf gelbem Grund. Brave Bürgersöhne gingen am Wochenende Steine werfen. Ihre Schwestern trugen den gelben Friesennerz, zum Schutz gegen den harten Strahl des Wasserwerfers, in den die Staatsmacht stets einen Anteil Tränengas mixte. Brokdorf, Kalkar, Wackersdorf sind die Namen der Schlachtfelder der neuen deutschen Geschichte. Die Fotos von brennenden Mannschaftswagen der Polizei, von tieffliegenden Hubschraubern über Demonstrantenmassen, von prügelnden Ordnungshütern und von Demonstranten, die mit dem Spaten auf einen Polizisten eindreschen, sie gehören zum kollektiven Gedächtnis der Nation. Sieben Menschen starben in diesem 25-jährigen Krieg.
Am 14. Juni 2000 einigten sich die ehemaligen Demonstranten Jürgen Trittin und Gerhard Schröder mit den Vorständen der vier Atommächte RWE, Eon, Vattenfall und EnBW auf den Atomkonsens. Die Kernkraftgegner mussten zwar noch unerträglich lange auf den Ausstieg warten, doch das Ende war nun festgeschrieben. Die Energiekonzerne mussten zwar auf den Atomstrom verzichten, aber der Ausstiegsplan brachte ihnen endlich Planungssicherheit. Die Unversöhnlichen versöhnten sich. Endlich Frieden.
"Der Konflikt wird nun auf die Straße getragen", ruft die junge Frau auf der Bühne ins Mikro. Sie kämpft um ihre Stimme. "Wir werden uns von nun an nicht mehr an eure Gesetze halten." Die Frau heißt Luise Neumann- Cosel und ist Mitglied bei "x-tausendmal- quer". Zehntausende jubeln ihr zu.
Wir schreiben das Jahr 2010. Großdemo im Regierungsviertel, junge Frauen, deren Stimmen sich beim Kampfappell fast überschlagen - das klingt nach Bonner Hofgarten, nach Helmut Kohl. Den Älteren brummt fast schon seine Stimme im Ohr: "Wir werdn uns dem Druck der Straße nicht beugn." Fehlt nur noch, dass die Revoluzzer-Band Bots auftaucht und "Aufstehn!" spielt. Und tatsächlich: Sie sind da. Sie spielen es. "Was, die gibt's noch?", wundern sich selbst Jürgen Trittin und Renate Künast, die bekannten Gesichter der neuen deutschen Volkspartei Die Grünen.
"Ich dachte, ich könnte mich nach dem Ausstiegsbeschluss von Rot-Grün als Protestierer zur Ruhe setzen", sagt Franz Furkert, 59, ein Veteran der Bewegung. Seine Erinnerungen an die Schlachten von Brokdorf sind noch frisch. Heute ist Furkert Biologieprofessor. "Jetzt scheint es noch mal richtig heiß zu werden", sagt er. "Das Wendland ruft!"
Doch es hat sich etwas verändert seit den 80er Jahren: In Bonn und vor den Bauzäunen demonstrierte vor allem ein Milieu und eine Generation gegen die Pläne des Establishments. In Berlin jedoch schiebt sich der Querschnitt der Gesellschaft über die Brücken der Spree. Es demonstrieren Junge, Alte, Familien mit Kinderwagen, Handwerker aus dem Ruhrgebiet und Bildungsbürger aus Charlottenburg. "Der Protest ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und breiter verankert als in den 70er und 80er Jahren", sagt Dieter Rucht. Er ist Professor für Soziologie am Wissenschaftszentrum Berlin und gilt als führender Experte für soziale Bewegungen in Deutschland. "Wer dachte, die Atompolitik sei eine geschlagene Schlacht, wacht gerade wieder auf."
Mit ihrer Entscheidung, die Laufzeit der Atommeiler um bis zu 14 Jahre zu verlängern, hat die Bundesregierung den Frieden vom Juni 2000 aufgekündigt. Beste Startbedingungen für eine neue Anti-Atomkraft-Bewegung: Die Veteranen mit ihrem Know-how und die alten Strukturen sind noch da. Dazu kommen die Jungen mit ihrem Enthusiasmus. Und alle wissen, die Bewegung hat schon viele Siege errungen: Sie hat das Kernkraftwerk in Wyhl verhindert. Das AKW Mülheim- Kärlich war nur wenige Monate in Betrieb. Sie hat erreicht, dass aus dem schnellen Brüter in Kalkar ein Freizeitpark wurde und die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf nie gebaut wurde. Diesmal sind die Voraussetzungen für den Widerstand deutlich besser. Diesmal steht die Mehrheit der Gesellschaft hinter denen, die der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg (CDU) früher "reine Terroristen, ja sogar Verbrecher" genannt hatte.
Wer ein so hohes politisches Risiko eingeht, muss gute Gründe haben. Und genau die hat die schwarz-gelbe Regierung nicht.
Die Lücken-Lüge
Sie behauptet, eine Verlängerung der Laufzeiten der Reaktoren sei notwendig, weil ansonsten eine Versorgungslücke bevorstehe. Das gute, alte "Lichter-aus-Argument". Damit drohte schon Hans Filbinger für den Fall, dass das AKW Wyhl nicht gebaut werde. Wenige Jahre später, 1983, verzichtete sein Nachfolger Lothar Späth (CDU) auf den Bau. Das Kraftwerk, stellte er fest, werde erst mal nicht gebraucht. Bei Licht betrachtet, ist die Lage heute ähnlich: Deutschland hat keine Stromlücke, sondern exportiert Strom ins Ausland.
Energiepolitik ist besonders langfristig angelegt. Man kann sie nicht jedes Jahr ändern. Beim Ausstiegsbeschluss gab es daher einen Plan, wie sich die Kapazitäten aus Wind-, Sonnen-, Wasser-, Biogas- und Erdwärmeanlagen entwickeln sollen. 1999 erwartete die Regierung Schröder, dass im Jahr 2010 bereits 12,5 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden sollte. Knapp daneben. Tatsächlich hat grüner Strom heute einen Anteil von 17,9 Prozent - also 40 Prozent besser als geplant. "Die Bundesregierung unterschätzt nach wie vor die Ausbaugeschwindigkeit der erneuerbaren Energie", sagt Hermann Albers, Präsident des Bundesverbands Windenergie. Die Geschichte von der Versorgungslücke ist also unwahr. Würde es nach der Stromkapazität gehen, könnten die Meiler nicht später vom Netz, sondern früher.
Dabei hat das Wachstum der grünen Energie gerade erst begonnen. In Nord- und Ostsee sind bereits Windpark-Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 25 000 Megawatt genehmigt oder kurz davor. Das entspricht etwa der Leistung von 20 Atomkraftwerken. Etwa 20 Jahre soll es dauern, bis die riesigen Windräder alle am Netz sind - falls sich die Windenergie-Branche nicht wieder schneller macht als geplant. Hinzu kommt die Sonnenenergie, die ebenfalls rasch wächst. Jährlich werden derzeit Solaranlagen mit einer Leistung von 3000 Megawatt zusätzlich installiert.
Die Brücken-Lüge
Das klingt gut. Doch es könnte noch viel besser sein. Schuld ist der Atomstrom. Der verstopft die Netze. Die regenerative Energie schwankt. Mal scheint die Sonne, mal bläst der Wind. Und manchmal beides nicht. So schwankt beispielsweise das Windkraftaufkommen im Netz von Vattenfall zwischen 400 und 8000 Megawatt. Will man so viel sauberen Windstrom wie möglich einspeisen, müssten sich die Atommeiler an den Wind anpassen. Doch Meiler passen sich nicht an. Kernkraftwerke sind entweder einoder ausgeschaltet. Es dauert ein, zwei Tage, bis so eine Anlage runter- und wieder raufgefahren ist. Also läuft sie weiter und weiter. Auch bei Wind.
Stattdessen werden bei Stromüberschuss immer wieder die Rotorblätter der Windanlagen so gedreht, dass sie keinen Antrieb mehr erzeugen. Jetzt, im windigen Herbst, kann man auf langen Autofahrten wieder viele Windräder beobachten, die sich nicht drehen. Je heftiger der Wind weht, desto häufiger heißt es: Alle Räder stehen still, weil der Atomstrom es so will.
"Im Netz gibt es den Systemkonflikt", sagt Hermann Albers vom Bundesverband Windenergie. Die Netzfrage ist längst keine technische Angelegenheit mehr. Es ist eine Machtfrage. Nach wem richtet sich das Netz? Nach den technischen Erfordernissen eines Atomkraftwerks oder nach denen der erneuerbaren Energien? Die Atommächte sind Oligopolisten. Sie produzieren etwa 80 Prozent des Stroms und kontrollieren das Leitungsnetz. Zu ihnen passt eine zentralisierte Stromversorgung mit wenigen, großen Kraftwerken. Erneuerbare Energie ist hingegen dezentral. Unzählige kleine Anlagen liefern den Menschen den Strom, ähnlich wie unzählige Bauern und Einzelhändler den Menschen die Nahrung liefern.
Um die Schwankungen der Wind- und Sonnenstrom-Erzeuger auszugleichen, sind Atomkraftwerke also ungeeignet. Auch große Kohlekraftwerke sind ungefähr so wendig wie ein Tanker. Sehr flexibel sind hingegen kleine Gaskraftwerke. Mit der Technologie der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) produzieren sie gleichzeitig Strom und Heizwärme - und dadurch vergleichsweise weniger CO2. In Deutschland gibt es lange nicht genug davon. Doch viele Stadtwerke haben den Bau solcher Anlagen geplant. Sie hatten ihn geplant. Die Verlängerung der Atomlaufzeiten ändert plötzlich ihre Geschäftsgrundlage. Längere Laufzeiten bedeuten länger verstopfte Netze. Das stellt die Wirtschaftlichkeit der schnellen Gaskraftwerke infrage. Insgesamt zwölf Milliarden Euro wollten deutsche Stadtwerke in KWKAnlagen investieren. "Unter den neuen Bedingungen sind die Bremsspuren schon heute zu sehen", sagt Stephan Weil, Oberbürgermeister von Hannover und Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmer. Und weil die Gaskraftwerke als Ergänzung zu den Wind- und Sonnenanlagen dringend gebraucht werden, bremst der Investitionsstau dort auch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Von wegen Brücke.
Die Brückenthese ist mit dem Kopf eines Stromoligopolisten gedacht. Sie geht davon aus, dass regenerative Energien den Atomstrom schlicht eins zu eins ersetzen werden. Sonst muss sich nichts ändern. Ein gewaltiger Irrtum. Das Umsteuern in der Energieversorgung auf erneuerbare Quellen ist keine kleine Kurskorrektur. Es muss massiv ins Steuer eingegriffen werden: Gigantische Windparks werden im Meer entstehen. Neue Leitungen müssen den Strom aus dem Norden in den Süden transportieren. Das gesamte Netz muss umgebaut und den neuen Erfordernissen angepasst werden. Die entscheidende Veränderung des neuen Stromsystems jedoch ist eine politische: Die Dezentralisierung der Stromversorgung kostet die vier zentralistischen Oligopolunternehmen ihre Macht.
Die Preis-Lüge
Die Verbraucher kostet der Umbau Geld. Viel Geld. Exakt - sagen wir auf zehn Milliarden genau - kann heute niemand den Investitionsbedarf schätzen. Doch der Preis des Ausstiegs wird kein kleiner sein. Hohe Milliardenbeträge können Verbraucher und Bürger erschrecken - für Energie- Unternehmen sind solche Größenordnungen normal. So war das bei Kohlekraftwerken, so war es bei Atomkraftwerken, so wird es auch bei Wind- und Sonnenkraftwerken sein.
Die Bundesregierung und die Energiekonzerne erklären, die Verlängerung der Laufzeiten sei notwendig, um den Verbrauchern bezahlbaren Strom garantieren zu können. Verschiedene Institute haben jedoch berechnet, dass längere Laufzeiten den Strompreis in Zukunft bestenfalls um knapp fünf Prozent reduzieren. Ein Großteil des Strompreises resultiert aus verschiedenen Steuern, die der Staat erhebt. Die Politik sitzt also selbst an der Strompreisschraube. Wenn sie den Preis wirklich senken will - niemand kann sie hindern.
Auch die Stromkonzerne könnten den Preis schon morgen drastisch reduzieren. Seit 1992 haben sich die Umsätze der Strombranche in Deutschland verdreifacht. Gut für den Gewinn. Von den 46 Milliarden Euro, die beispielsweise RWE im vergangenen Jahr eingenommen hat, behielt der Konzern vor Steuern 5,6 Milliarden Euro als Gewinn. Eine Umsatzrendite von rund 12 Prozent. Ein Industrieunternehmen ist damit schon weit im Gier-Bereich. Wäre RWE ungefähr so gierig wie Siemens oder BASF gewesen, dann hätte sich der Stromkonzern mit rund der Hälfte begnügt. Bei dieser Rechnung könnte man den Strompreis ordentlich senken. Das, und nicht die längere Laufzeit von Reaktoren, würde bezahlbaren Strom auf Jahre hinaus sichern.
Im alten Denken der zentralwirtschaftlich gelenkten Stromkonzerne ist der Umbau der Energie- Infrastruktur ein Kostenfaktor. Tatsächlich liegt darin eine der größten Chancen für die deutsche Wirtschaft. Im Know-how und im Anlagenbau für Wind- und Solarstrom gehört Deutschland weltweit zur Spitzengruppe. US-Präsident Obama will die "clean energy economy" zu einem zentralen Wirtschaftszweig ausbauen. Sein Vorbild dabei sind deutsche Unternehmen. Im April besuchte er eine Windräderfertigung von Siemens in Iowa. "Unglaublich eindrucksvolle Technologie!", schwärmte Mr President. Yes, we can! Endlich mal ein ökonomischer Megatrend, den Deutschland nicht verschläft, sondern bei dem es vorn, ganz vorn dabei ist.
Oder nur dabei war? Die Laufzeitverlängerung des Atomstroms nimmt Forschung, Entwicklung und Investitionen in alternative Energien einen Großteil ihrer Attraktivität. Die befürchtete Vollbremsung in dieser Schlüsseltechnologie wäre ein GAU für die deutsche Volkswirtschaft.
Die Modernitäts-Lüge
Für die Gegner der Atomkraft bedeutet jedes weitere Jahr Laufzeit ein weiteres Jahr GAU-Risiko. Die Bundesregierung beruhigt das Volk mit dem Märchen von den modernsten und sichersten Reaktoren der Welt, die in Deutschland stehen. Tatsache ist: Der deutsche Atomkraftwerkspark ist der drittälteste in der Welt. Nur in den USA und Großbritannien sind die Mühlen älter. Neckarwestheim 2, das jüngste AKW, ging vor 21 Jahren ans Netz. Biblis A, der älteste noch aktive Reaktor, hat bereits 36 Jahre auf dem Buckel. Betriebszeiten von bis zu 50 Jahren und mehr, wie sie nach den neuen Plänen der Bundesregierung vorgesehen sind, wurden bisher noch nirgendwo ausprobiert. In Deutschland wird also der Feldversuch stattfinden, um herauszufinden: Wie lange hält ein Atomkraftwerk?
Eines weiß man schon jetzt: Je älter, desto störanfälliger wird eine Atomanlage. Deutschland lag darum in den vergangenen drei Jahren auf dem drittschlechtesten Platz, was die "ungeplante Abschaltung von Reaktoren" angeht. Schlechter waren nur Großbritannien und Schweden. In Schweden betreibt der berüchtigte Vattenfall-Konzern die Kernkraftwerke. Der Betreiber von Krümmel und Brunsbüttel gilt auch hierzulande als so unzuverlässig, dass selbst die Bundeskanzlerin vergangenes Jahr öffentlich darüber nachdachte, ihm die Betriebserlaubnis zu entziehen.
Unsere ollen Meiler sind nicht nur wenig zuverlässig, ihnen fehlt auch die neueste Sicherheitstechnologie. Die angeblich modernsten und sichersten Atomkraftwerke der Welt ähneln in Wahrheit altersschwachen Autos, ohne ABS, Airbag und ESP. Würden sie heute so noch einmal gebaut, der TÜV dürfte sie nicht zulassen. So ist beispielsweise keines der 17 Kernkraftwerke ausreichend gegen den Absturz eines großen Passagierflugzeugs gesichert. Und viele sind nicht mit den neuesten, sichersten Rohrleitungen ausgerüstet.
Ein Super-Deal für die Konzerne
Eigentlich hätten die Anlagen längst nachgerüstet werden müssen. Doch im Atomkompromiss von 2000 wurden den Konzernen die teuren Investitionen erlassen. Das war ein Preis für den Frieden. Man dachte ja, es wäre nur für kurze Zeit. In den Vereinbarungen mit der schwarz-gelben Regierung wird weiterhin auf die notwendigen Nachrüstungen verzichtet. Längere Laufzeiten bei gleichzeitigem Verzicht auf die neuste Sicherheitstechnik - ein Super-Deal für die Konzerne. Dass die Bundesregierung überhaupt mit den vier Konzernchefs verhandelt, hält Ulrich Müller, Energieexperte vom Kölner Verein Lobbycontrol, für "ein Beispiel, wie Politik nicht sein darf". Demokratie war anders gedacht: Die Bundesregierung macht Gesetzesvorschläge. Das Parlament stimmt darüber ab. Nächtliche Verhandlungen mit Bossen sind schlicht nicht vorgesehen.
Die Spitzen aller anderen Parteien haben bereits angekündigt, dass sie die Laufzeiten nach der nächsten Bundestagswahl 2013 wieder verkürzen wollen. Atompolitik wird also künftig so aussehen wie Tarifverhandlungen: Alle paar Jahre wird ein neuer Deal ausgehandelt.
Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) kennt all die Argumente. Natürlich ist ihm bewusst, dass es bis heute auf der Welt kein Endlager für Atommüll gibt. Dass die Mehrheit der Deutschen gegen eine Laufzeitverlängerung ist. Dass die Atompolitik zu einer echten Gefahr für seine Regierung werden kann. Noch im Februar empfahl er seiner Partei daher per Interview in der "Süddeutschen Zeitung", sie solle sich "gut überlegen, ob sie gerade die Kernenergie zu einem Alleinstellungsmerkmal machen will". Und auf die Frage, wo er die Grenze der Laufzeitverlängerung ziehe, antwortete Röttgen: "Ganz einfach: Die Kernkraftwerke sind auf 40 Jahre ausgelegt. Nicht auf 60, sondern auf 40 Jahre." Doch nun muss er Laufzeiten von 50 Jahren und mehr akzeptieren.
Norbert Röttgen ist der zuständige Minister. Und er ist ein wichtiger Mann in der CDU. Manche halten ihn für einen denkbaren Nachfolger von Angela Merkel. Warum hat seine Partei und warum hat die Bundesregierung nicht auf ihn gehört?
So wie die Ablehnung der Atomkraft zum genetischen Code der Grünen gehört, so ist es Teil der DNA von CDU, CSU und FDP, für diese Energie zu kämpfen. Franz Josef Strauß selbst war es, der 1956 als Bundesminister für Atomfragen das erste Atomprogramm vorstellte. Brokdorf, Wackersdorf, Kalkar und Gorleben sind auch Bestandteil der Unionsgeschichte. Auch die Union wurde geprägt von Jahrzehnten Kampf am Bauzaun - nur auf der anderen Seite.
Wären sie ihrem Umweltminister gefolgt, hätten viele Politiker der Union das als Verrat an ihrer Geschichte und ihren alten Werten empfunden. Und das zu einer Zeit, in der sich viele fragen, was denn noch konservativ ist an CDU und CSU. Für Atomkraft zu sein ist konservativ. Seit dem Ausstieg Roland Kochs gelten CDU-Fraktionschef Volker Kauder und der neue Ministerpräsident von Baden- Württemberg, Stefan Mappus, als die Frontmänner der Konservativen in der CDU. Sie wurden zu den gefährlichsten Feinden ihres Parteifreunds Röttgen. Mappus forderte den Rücktritt des Ministers, und Kauder tat hinter den Berliner Kulissen alles für Röttgens Scheitern. Am Ende durfte Röttgen bei den entscheidenden Verhandlungen um den Atom-Deal nicht mal mehr am Tisch sitzen.
Auch der zweite, entscheidende Grund für die Verlängerung der Atomlaufzeiten hat wenig mit der Sache zu tun, aber viel mit dem Zustand der Regierung. Bereits im Wahlkampf hatten FDP und Union für längere Atomkraftwerks- Laufzeiten geworben. Genauso, wie sie stets für Steuersenkungen eingetreten sind. Nach der Wahl wollten sie ihre Linie unbedingt durchziehen. Obwohl die Vorzeichen sich inzwischen geändert hatten. Die Parallelen zur Steuerpolitik sind augenfällig. Die Finanzkrise hat die Geschäftsgrundlage für Steuersenkungen ins Gegenteil verkehrt. Und der dramatisch schnellere Ausbau der regenerativen Energien verschiebt die Ausgangslage für die künftige Stromversorgung um noch ein weiteres, entscheidendes Stück - zulasten des Atomstroms.
Bei der Energiepolitik steht also nicht die Versorgungssicherheit, der Strompreis, die Sicherheit der Reaktoren oder eine Brücke zu den erneuerbaren Energien im Zentrum des Interesses. Natürlich geht es, wie immer in der Politik, um Macht. Also ein Heimspiel für Angela Merkel, die Großmeisterin des politischen Taktierens. Sollte man meinen.
Vielleicht aber ist die Atomenergie eines der sehr wenigen Themen, bei dem man merkt, dass Angela Merkel nicht in der alten Bundesrepublik aufgewachsen ist. Für die Physikerin, so scheint es, ist Atompolitik ein ganz normales politisches Thema wie andere auch. Für alle Westdeutschen über 35 Jahre ist es genau das nicht.
Nach der Wende wurde viele Jahre über "Befindlichkeiten" der Ostdeutschen diskutiert. Zu Recht verlangten die Deutschen Ost von den Deutschen West Respekt vor ihren Biografien.
Die mitunter übermäßige Empfindlichkeit beim Thema Atomstrom ist vermutlich eine der "Befindlichkeiten" der Deutschen aus den alten Ländern. In keinem anderen Land ist die Auseinandersetzung um die Kernenergie ähnlich emotional geführt worden wie in der alten Bundesrepublik. Westdeutsche in Merkels Alter zogen vom Kinderzimmer bei den Eltern direkt in WGs, in denen jede Klotür, jeder Gebrauchsgegenstand mit "Atomkraft? Nein danke!" beklebt waren. Auf der ersten Ente, dem ersten VW-Bulli lachte die Sonne. Das vergisst man nicht. Im Bücherregal standen Klassiker wie der "Atomstaat" von Robert Jungk. BAP, Grönemeyer oder Udo Lindenberg spielten auf dem legendären Konzert in Wackersdorf. Ihre Platten standen in sämtlichen Regalen und sind inzwischen längst auf die iPods der heute Mitte-50-Jährigen importiert worden.
Angela Merkel hat das alles nicht miterlebt. Ein halbes Jahr vor dem Mauerfall wurde beschlossen, die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf nicht fertigzustellen. Seitdem sind in Deutschland keine neuen Atomanlagen mehr gebaut worden. Die Polizei holte die Wasserwerfer und die Hubschrauber nur noch selten aus dem Depot.
Trotz der Befriedung bleibt die Kernenergie für die meisten Westdeutschen weit mehr als lediglich eine Methode, Strom zu erzeugen. Für viele ist der Widerstand nicht nur Teil ihrer Biografie, sondern Teil ihrer Identität.
Mit dem Verstand hat Angela Merkel die westdeutsche Atombefindlichkeit längst durchschaut. Sie weiß es. Aber sie spürt es nicht.
Mitarbeit: Andreas Hoidn-Borchers, Andreas Hoffmann, Jens König, Rolf-Herbert Peters, Jan Rosenkranz, Kester Schlenz, Jan Boris Wintzenburg