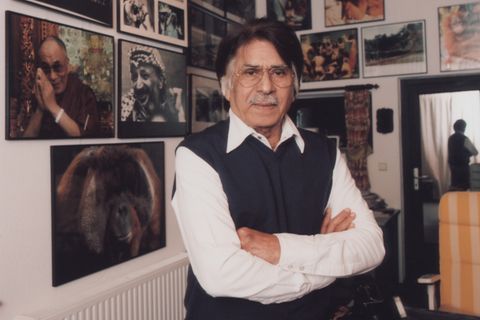Jassir Arafat lebte im Exil, lebenslänglich. Er war ein Vertriebener und Getriebener; er kam nie an. Im Jahrhundert der Flüchtlinge, dem 20., war er der Flüchtling schlechthin - ein kleiner Mann in Khaki-uniform mit Hautproblemen, Bartstoppeln und Bauch, den Kopf immer mit einem Palästinensertuch bedeckt, dem Kefije, den er allmorgendlich faltete in Form seiner verlorenen Heimat Palästina. Er war nicht schön, wirr war seine Rede, sein Pathos wirkte häufig hohl. Und doch war er eine Ikone, dieser Mann, der im Provisorium und in der Zweideutigkeit zu Hause gewesen ist. Man wird sich an ihn erinnern, wenn man all die anderen schon längst vergessen hat, die neun amerikanischen und neun israelischen Regierungschefs, die er als Chairman überlebte, und auch die beiden, unter deren Herrschaft seine Ära endete: George W. Bush und Ariel Sharon, seinen ewigen Widersacher.
Arafat, das Chamäleon, der Terrorist, der Friedensnobelpreisträger, der palästinensische Papst, Hirte eines Volkes ohne Land, der Mann, der die Wandlung vom Guerillachef zum Verwalter des Unverwaltbaren nie geschafft hat, der sich nie entscheiden konnte zwischen der Pistole an der Hüfte und dem Olivenzweig in der Hand.
Fast vier Dekaden
stand er weltweit im Mittelpunkt des Interesses, er gehörte zum Inventar der "Tagesschau". Arafat hat vermutlich mehr Interviews gegeben als jeder andere Politiker; mehr als ein Dutzend Biografien über ihn sind auf dem Markt. Dennoch entglitt er auch seinen Chronisten wie ein Stück Seife; dafür hat er gesorgt. Den Umständen entsprechend erfand er sich ständig neu, mal als Marxisten, mal als Moslembruder, mal als Terror-Chairman, mal als Friedenstaube, mal als gütigen Landesvater, mal als listigen Handelsreisenden für sein Volk. "Für Palästina bin ich immer bereit zu lügen", sagte Arafat einmal.
Stets behauptet er, er sei in Al Quds geboren, in der Heiligen Stadt Jerusalem. Über die Herkunft seiner Familie kursieren verschiedene Versionen. Arafat sorgt nie für Klärung. So macht er seine Abstammung "zur Metapher für alle Palästinenser", wie seine Biografen John und Janet Wallach schreiben. "Er ist der vaterlose Vater, der mutterlose Sohn, der heimatlose Herrscher über eine Nation ohne Land, ein Symbol ohne Existenz für ein Volk ohne Identität."
Tatsächlich wird Arafat als sechstes von sieben Kindern in Kairo geboren, am 24. August 1929. Damals heißt er noch Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al Qudua al Husseini. Später wird er sich den Kriegsnamen Abu Ammar geben, nach Ammar bin Jasir, einem Gefährten des Propheten. Und irgendwann wird er Jassir Arafat - weil sich das alle merken können, insbesondere ausländische Journalisten von CBS über BBC bis hin zu "Kol Israel". Sein Vater, ein Textilhändler, stammt aus Gaza, seine Mutter Zahwa aus Jerusalem. Nach ihrem Tod schickt ihn sein Vater in die Heilige Stadt; Arafat ist fünf Jahre alt.
Der Junge hat Jerusalem geliebt,
ein Leben lang wird er wehmütig von der Atmosphäre in der Altstadt sprechen. Doch als er neun ist, holt ihn sein Vater zurück nach Kairo, ein strenger und zutiefst frommer Mann, der seine sieben Kinder mit Schlägen zum Koranstudium treibt und ansonsten sein ganzes Leben einer hoffnungslosen Sache widmet: Verbissen und vergebens klagt er sich in Ägypten durch sämtliche Instanzen, um Ländereien seiner Familie mütterlicherseits zurückzuerhalten, als deren Erbe er sich wähnt.
Jassirs Verhältnis zum prügelnden Vater ist distanziert. Regelmäßig flieht er vor ihm auf die Straße, wo er Nachbarsjungen herumkommandiert und sich schon damals aufführt wie der Chef. Als der Vater 1952 in Chan Junis in Gaza beerdigt wird, erscheint Arafat nicht. Dagegen weint er, als dort 1999 seine älteste Schwester Inam zu Grabe getragen wird - sie war seine Ersatzmutter und vermutlich der Mensch, der ihm am nächsten stand.
1947 immatrikuliert sich Arafat an der Universität von Kairo, um Ingenieur zu werden. Ein Jahr später bricht der israelische Unabhängigkeitskrieg aus. Der Student, der große Teile des Korans auswendig kann und bis zu seinem Tod ein Gläubiger bleibt, schließt sich den ägyptischen Muslimbrüdern an und kämpft gegen die Zionisten - nicht in Jerusalem, wie er später immer wieder behaupten wird, sondern in Gaza.
Nach der "Nakba", der Katastrophe, wie die Palästinenser die Gründung des Staates Israel und den Verlust eines Großteils ihrer Heimat nennen, fühlt sich Arafat verraten von den arabischen Nationen. "Sie haben nicht gekämpft, sie haben nur so getan", sagt er. Nie wird er das vergessen. Die Befreiung Palästinas wird seine Obsession.
Nach dem Studium
zieht er nach Kuwait und arbeitet für eine Baufirma. "Fast wäre ich Millionär geworden", erzählt er später. "Ich hatte vier Autos - zwei Chevrolets, einen Thunderbird und einen VW. Ich habe sie alle weggegeben, als ich mich dem Kampf anschloss, alle bis auf den VW."
Gern braust er mit Höchstgeschwindigkeit durch die Straßen. Ansonsten ist er jeglichem Genuss abhold. Er raucht und trinkt nicht, Essen ist für ihn reine Nahrungsaufnahme, die er häufig im Stehen hinter sich bringt; am liebsten verschlingt er Honig auf Toast oder Cornflakes mit Tee. Schlafen kann er überall, auch auf dem Fußboden. Literatur und Musik lassen ihn kalt. Stattdessen ist er süchtig nach Zeitungen, später kommen Fernsehnachrichten hinzu.
Für Frauen hat er keine Zeit.
"Meine Braut ist Palästina", sagt er. Seine späte Ehe mit Suha Tawil, einer 30 Jahre jüngeren Christin aus dem Westjordanland, die er Anfang der 90er Jahre heiratet, endet nach wenigen Jahren in Entfremdung. Arafat hat kein Talent zum Familienleben. Als einmal ein Kleinkind in seinen Arbeitsräumen ist, fragt Arafat empört, was es da zu suchen habe. Das Kind ist seine heute neunjährige Tochter Zahwa.
1959 lässt er sein sesshaftes Leben für immer hinter sich: Mit seinen Gefährten Abu Jihad und Abu Iyad, die beide später unter ungeklärten Umständen ermordet werden, gründet er die Guerillatruppe Al Fatah. Deren Kämpfer nennen sich Feda- yin - "die sich für das Vaterland opfern". Es sind junge Männer aus den elenden Flüchtlingslagern. Die Fedayin bombardieren israelische Einrichtungen - Arafat bombardiert Zeitungen mit konfusen "Kommuniqués" über die Heldentaten der Fatah. Meist werden sie nicht gedruckt. Die arabischen Staatschefs finden, dass die Palästina-Frage warten kann. Der unschöne kleine Mann nervt sie, ebenso wie die Fatah-Parole: "Die arabische Einheit wird nur durch die Befreiung Palästinas gelingen."
Zwar wird 1964 auf Wunsch des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser mit großem Tamtam die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO gegründet, ausgerüstet mit einer schaurigen Charta, in der geschrieben steht: "Es ist die Pflicht der Araber, den Zionismus in Palästina auszutilgen", die Juden seien "kein Volk", der Zionismus "fanatisch und rassistisch". Die Unabhängigkeit Palästinas wird indes mit keinem Wort erwähnt, denn Nassers Ziel ist keineswegs die Befreiung der Palästinenser, sondern deren Überwachung. Darum legt er die Leitung der Organisation in die inkompetenten Hände des Anwalts Ahmed Shukeiri. Der tönt, er werde die Juden ins Meer treiben und seine Tränen "in ihrem Blut waschen". Doch folgen den Wortgeschwadern keine Taten.
Arafats Aufstieg beginnt mit dem Debakel des Sechstagekrieges von 1967, als Is- rael die arabischen Armeen vernichtend schlägt und fortan über ganz Palästina und über eine Million Araber in Gaza und im Westjordanland herrscht. Die Potentaten der Region sind diskreditiert, Arafats Aufruf zum Widerstand ist "das Einzige, was zwischen den Arabern und dem Selbsthass steht", so sein palästinensischer Biograf Said Aburish. Er wird "Mister Palestine", nach Israel ist er der zweite große Sieger des Krieges. Todesmutig versucht er, die Bevölkerung im Westjordanland zum bewaffneten Aufstand anzustacheln.
1969 wird Arafat neuer Chef der PLO und die 71-jährige Golda Meir Ministerpräsidentin Israels. Über die Palästinenser sagt die starrsinnige Großmutter kurz und knapp: "Es gibt sie nicht."
Arafat beweist ihr das Gegenteil.
Er nistet sich mit der Fatah und 30 weiteren bewaffneten Gruppen zunächst in Jordanien, später in Beirut ein. Keiner versteht es wie er, alle Fraktionen zusammenzuhalten, von den Marxisten bis zu den Muslimen, vom reaktionären Saudi-Arabien bis zum revolutionären Libyen. Unter Arafat, der sich nie vereinnahmen lässt, wird die PLO zur unabhängigen Organisation und die Sache der Palästinenser zum heiligen Kampf der ganzen Dritten Welt. Er teilt und herrscht, er bezaubert und lässt beseitigen. Ideologien und Visionen kann er sich bei seinem Balanceakt in der byzantinischen Welt arabischer Politik nicht leisten; was er sagt, ist nie eindeutig. Das ist seine Stärke als Revolutionsführer und wird ihm als Staatsmann zum Verhängnis.
Zunächst führt er den Krieg der Armen und wird Terroristenchef. In neun Jahren entführen seine Männer und Frauen 29 Flugzeuge. Sie sind die Ersten, die Passagiermaschinen voller Zivilisten per Zeitbombe in die Luft jagen; sie sind die Ersten, die beim Check-in auf Fluggäste schießen; sie sind die Ersten, die Lebensmittel vergiften - israelische Orangen, bestimmt für den europäischen Markt. Sie sind die Ersten, die bei Olympischen Spielen einen Terroranschlag verüben - 1972 in München. Sie sind auch die Ersten, die deutschen Terror-Söldnern die Gelegenheit geben, das grausige Erbe Josef Mengeles anzutreten und 1976 bei der Entführung einer Air-France-Maschine nach Entebbe in Uganda eine "Selektion" zwischen jüdischen und nichtjüdischen Passagieren durchzuführen. Sie sind die bisher Letzten, die das Blut eines ihrer Opfer vom Bürgersteig ablecken, so geschehen 1971 beim Mord am jordanischen Ministerpräsidenten Wasfi Tell in Kairo. Auch in Israel schlagen sie zu. Sie ermorden Schulkinder, Babys, Großmütter, Soldaten, Siedler.
Bald weiß die ganze Welt,
dass es die Palästinenser gibt, auch weil sie, anders als Kurden oder Tibeter, einen faszinierenden Gegner haben. Gebannt verfolgt die Welt das einzigartige Experiment des jüdischen Staates. Für die Israelis wird Arafat zum hässlichen Anderen, zum unheimlichen Schatten, der sie überallhin begleitet.
Für die Millionen staatenloser Palästinenser, die in den Lagern zu einem Leben als Mündel internationaler Wohltätigkeit verdammt sind, ist Arafat ein Idol. Sie, die Unsichtbaren, verurteilt zu einer Existenz auf der Müllhalde der Geschichte, haben einen weithin sichtbaren Chairman, der mit Mao diniert und dafür sorgt, dass die palästinensische Flagge weht und die Salutschüsse knallen. Gefangen "in einer Gegenwart außerhalb der Zeit, in einer Gegenwart, der man den Ort vorenthalten hat", wie der palästinensische Dichter Mahmoud Darwisch schreibt, wird der Mann aus Ägypten ihr Moses, er führt sie "aus der Wüste der Vergessenheit in das Land der Hauptsendezeit", so Thomas Friedman, Journalist bei der "New York Times".
Doch führt er sie nie zurück in ihr Sehnsuchtsland, nach Palästina. Denn Arafat steht jahrzehntelang vor der Wahl zwischen einem Krieg, den er nicht gewinnen kann - gegen Israel -, und einer Entscheidung, die er nicht zu treffen wagt - der Anerkennung des jüdischen Staates in den Grenzen von 1967. Denn das ist die Heimat der Flüchtlinge, die er vertritt.
Aus dem Dilemma flieht er in die Illusion; immer wieder verwechselt der manische Globetrotter die Macht mit ihren Attrappen. Statt sich der Befreiung Palästinas zu widmen, ruft er in Jordanien, seinem ersten Exil, zum Sturz König Husseins auf, worauf der im schwarzen September 1970 seine Beduinentruppen auf die Fedayin loslässt und die Überlebenden in den Libanon verjagt. Dort vertreibt sich die Guerilla die Zeit mit Banküberfällen und in Nachtclubs und gibt dem vom Bürgerkrieg geschwächten Land den Rest.
Als die Isrealis 1982 auf Geheiß des damaligen Verteidigungsministers Ariel Sharon einmarschieren, prophezeit Arafat erst krakeelend ein "Stalingrad", um dann, die Hand zum Siegeszeichen erhoben, das nächstbeste Schiff nach Tunis, seinem dritten Exil, zu besteigen. Damals melden selbst PLO-Funktionäre Zweifel an seinen Führungsqualitäten an: "Wenn das so weitergeht, sitzen wir demnächst auf den Fidschi-Inseln." Doch Arafat mit seinem pittoresken Realitätsverhältnis erklärt das Debakel von Beirut zum "ruhmreichen Sieg".
Er überwindet diese wie auch andere Katastrophen. Er überlebt sämtliche Mordversuche der Israelis, ebenso einen Flugzeugabsturz 1992 in der Wüste Libyens. Der "Phoenix im Battledress" ("L'Express") hat die "Baraka", die göttliche Protektion. Erst als er 1994 zum Präsidenten wird, mit Briefmarken, aber ohne Land, beginnt der lange Herbst des Patriarchen.
Im Jahr zuvor hat Arafat
ohne Rücksprache mit den Menschen aus den besetzten Gebieten die Verträge von Oslo unterschrieben. Er, der immer nein gesagt hatte - nein zur Anerkennung Israels, nein zum Frieden mit Israel, nein zu Verhandlungen mit Israel, nein zur UN-Resolution 242, nein zum Abkommen von Camp David. Nun wird er zum "Rais" von Israels Gnaden in neun voneinander abgeschnittenen Enklaven im Westjordanland und in Gaza. Damit hat er sich aus der Bedeutungslosigkeit im fernen Tunis gerettet. Sein Volk, das in der ersten Intifada mehr als 1000 Menschen geopfert hat, fühlt sich bald entmündigt und verraten.
Fortan ist Arafat zwar zu Hause, aber mehr denn je im Exil. Nie findet er Zugang zu den Menschen, die mit ihrem Aufstand für sein Comeback gesorgt haben. Stattdessen umgibt er sich mit korrupten Claqueuren aus den Jahren in Beirut und Tunis. "Ich will, dass die Palästinenser so sind wie andere Völker und keinen Arafat mehr brauchen", hat er einmal gesagt, Jetzt hindert er sie daran. Er gibt ihnen keinen Staat, dafür aber einen Polizeistaat, und spielt Ali Baba und die 40 Räuber: Millionen Dollar aus aller Welt versickern auf Konten in aller Welt. Aus Angst vor einem Bürgerkrieg distanziert er sich nicht wirklich von den mordenden Fundamentalisten der Hamas. Nie hat er sich von irgendetwas distanziert, nach seinem ewigen Motto: "Ich bin ihr Führer, ich muss ihnen folgen."
Die übervölkerten Slums, über die er herrscht, werden stranguliert von immer mehr jüdischen Siedlungen. Die Hoffnung auf Frieden wird zunichte gemacht im entwürdigenden Alltag. Statt sich um Steuern oder Kanalisation zu kümmern, droht er: "Millionen Märtyrer stürmen gen Jerusalem"; am liebsten lebt er auf Messers Schneide.
Drei Jahre bevor er ins Koma fällt, bekommt "unser eigener Papa Doc", wie der verstorbene palästinensische Literaturprofessor Edward Said ihn nennt, das beste Angebot seines Lebens. Der damalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak offeriert ihm mehr als 95 Prozent der besetzten Gebiete. Doch weil er nicht der Palästinenser sein will, der die Souveränität über den Tempelberg mit Felsendom und Al-Aksa- Moschee aufgegeben hat, lehnt Arafat ab und flieht in die Ferne: In 19 Tagen bereist er 23 Länder.
Anschließend unterstützt er die zweite Intifada, die nun keine Bewegung des zivilen Ungehorsams mehr ist, sondern geprägt von Terror und Gewalt. So sorgt er dafür, dass sein ewiger Feind, der Rechtsaußen Ariel Sharon, zum Regierungschef gewählt wird. Endlich ist Arafat wieder dort, wo er sich am liebsten aufhält: am Rande eines Abgrunds. Was folgt, ist absehbar. Selbstmordattentate der Palästinenser. Gezielte Morde, Angriffe, Abriegelungen, Belagerungen, Bombardements der Israelis und Hausarrest für Arafat, drei Jahre lang. Die Höchststrafe für den Rastlosen, über den es einst hieß, er verbringe mehr Zeit in der Luft als auf dem Boden.
Er, der immer alles wollte
und zum Schluss nichts bekam, ist nur noch der gespenstische Präsident eines toten Traums. Ein trauriger Patriarch mit Pudelmütze und im blauen Patientenoverall, so reiste er am Freitag, dem 29. Oktober, nach Paris - der Mann, der immer zugleich die Lösung und das Problem war und der sich nie entscheiden konnte zwischen Mythos und Realität, zwischen ganz oder halb Palästina.
Am meisten wird ihn vielleicht Ariel Sharon vermissen, der auf dem Buhmann von Ramallah seine politische Karriere aufgebaut hat. Als Talleyrand 1838 starb, bemerkte sein Erzfeind, der österreichische Außenminister Metternich: "Ich frage mich, was er jetzt plant."