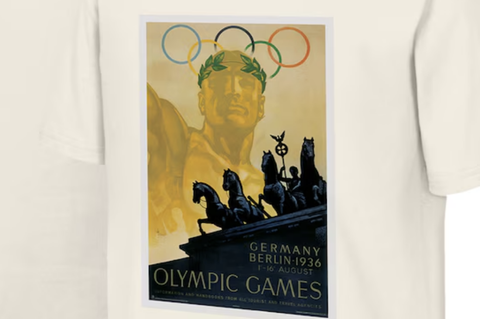2. Januar 1961: Der Flüchtlingsstrom von Ost nach West hält an. 1960 sind knapp 200.000 Menschen aus der DDR in den Westen geflohen. Ernst Lemmer (CDU), Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, beklagt in der "Tagesschau", dass der Flüchtlingsstrom, der schon fast 16 Jahre andauert, die "menschliche Ausblutung des mitteldeutschen Gebiets" zur Folge habe. Die meisten Flüchtlinge sind junge Menschen unter 25 Jahren. Viele Arbeiter sind darunter, aber auch Ärzte und andere Akademiker verlassen die Ostzone. Zeitungen berichten, dass allein im Jahr 1960 über 1.000 Techniker und Ingenieure in den Westen geflohen sind.
11. Januar:
Die DDR-Regierung verbietet den für Sommer geplanten gesamtdeutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin. Die SED fürchtet, laut Presseamt des Ministerpräsidenten der DDR, "dass eine der letzten und wichtigsten Klammern, die die Menschen in den getrennten Teilen Deutschlands zusammenhält, nämlich die Einheit der Evangelischen Kirche, der von der SED bewusst herbeigeführten Spaltung des Vaterlandes, geistig entgegenwirkt". Die "Welt" meldet, dass 1960 allein 4.000 SED-Mitglieder gezählt wurden, die nach West-Berlin geflohen sind.
19. Januar:
SED-Chef Walter Ulbricht bittet Kreml-Chef Nikita Chruschtschow um einen Kredit von 800 Millionen DM. Grund: Die SED wird ihr Ziel, die Bundesrepublik 1961 wirtschaftlich einzuholen, nicht erreichen und braucht Geld, um den wirtschaftlichen Aufbau in der DDR weiter voranzutreiben.
21. Januar:
Das DDR-Verteidigungsministerium befasst sich mit Plänen zur "Sicherung der Staatsgrenze". SED-Chef Walter Ulbricht fragt bei den Sowjets an, inwieweit die DDR im Krisenfall mit der Unterstützung der Roten Armee rechnen kann.
25. Januar:
Chruschtschow droht laut "Prawda" damit, einen separaten Friedensvertrag mit der DDR abzuschließen, um "den Splitter" des Besatzungsregimes in West-Berlin "aus dem Herzen Europas zu entfernen".
17. Februar:
Der Presse- und Informationsdienst der Bundesregierung gibt bekannt, dass von 1945 bis 1960 knapp drei Millionen Menschen aus der Ostzone geflohen sind. Allein im Februar fliehen wieder 13.576 Menschen von Ost nach West.
9. März:
Der amerikanische Botschafter Llewellyn Thompson ahnt Böses: "Falls wir davon ausgehen, dass die Sowjets die Berlinkrise nicht weiter verschärfen, dann müssen wir zumindest damit rechnen, dass die Ostdeutschen die Sektorengrenze abriegeln, um den für sie unerträglichen Flüchtlingsstrom durch Berlin zu stoppen", schreibt er nach einem Gespräch mit Kreml-Chef Chruschtschow an US-Präsident Kennedy.
13. März:
Berlins Regierender Bürgermeister Willy Brandt reist in die USA. US-Präsident Kennedy versichert ihm, dass die Freiheit West-Berlins um jeden Preis erhalten bleiben solle, bis Deutschland in Frieden und Freiheit wiedervereinigt sei.
16. März:
Das SED-Zentralkomitee setzt die anhaltende Massenflucht auf die Tagesordnung. Hinter verschlossenen Türen gibt Ulbricht eine bemerkenswerte Einschätzung ab: "60 Prozent der Republikflüchtigen sind Leute, die durch Fehler bei uns weggetrieben werden, 60 Prozent! Wenn nicht noch mehr."
18. März:
Ernst Lemmer, Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, fordert eine Volksabstimmung in beiden Teilen Deutschlands. Das wäre "die klarste und unmissverständlichste Entscheidung aller Deutschen über ihre eigene Zukunft".
20. März:
Ulbricht antwortet, indem er Maßnahmen gegen so genannte Grenzgänger ankündigt. Das sind Menschen, die in der DDR leben und zur Arbeit in die Bundesrepublik pendeln. Offiziell gebe es 75.000 Grenzgänger, klagt Ulbricht gegenüber Chruschtschow später in einem Telefonat. In Wirklichkeit seien es jedoch weit mehr.
24. März:
Ernst Lemmer appelliert mit "Blick auf ganz Deutschland" an die Menschen in der "Zone", sich gründlich zu überlegen, ob sie in den Westen fliehen. Er mahnt seine Landsleute im Osten zu prüfen, "ob sie nicht in unserem Land und unserem Volk einen größeren Dienst leisten, wenn sie bleiben". Doch die Rede des Bundesministers für gesamtdeutsche Fragen kann den Flüchtlingsstrom nicht stoppen. Im März fliehen wieder 16.094 Menschen in den Westen.
3. April:
Nach den Osterfeiertagen werden im Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde mehr als 4.000 DDR-Flüchtlinge aufgenommen. Bis Ende des Monats fliehen insgesamt 19.803 Menschen in den Westen.
11. April:
Bundeskanzler Adenauer trifft sich in Washington mit US-Präsident Kennedy. Die beiden Staatsoberhäupter verständigen sich darauf, dass "eine gerechte und dauerhafte Lösung der Deutschlandfrage einschließlich des Berlin-Problems nur durch die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechtes gefunden werden kann". Adenauer freut sich nach seiner Rückkehr in der Presse über "die eindeutigen Feststellungen des amerikanischen Präsidenten über die Lage in Berlin und zur Wiedervereinigung". Ende des Monats zeigt die Statistik, dass allein im April 19.803 Menschen in den Westen geflohen sind.
1. Mai:
Ein Abteilungsleiter des DDR-Außenministeriums flieht in den Westen. Der Geheimnisträger wird in die USA ausgeflogen. Er verrät, dass es in Ost-Berlin seit Januar 1961 konkrete Pläne gebe, den Flüchtlingsstrom einzudämmen. Der Bau einer Mauer sei eine Variante. Der Bundesnachrichtendienst erhält gleich lautende Informationen aus anderen Quellen.
5. Mai:
Die Personenkontrollen auf den Zufahrtswegen nach Berlin werden verstärkt.
13. Mai:
Bundesminister Ernst Lemmer sagt in einer Rundfunkansprache: "Wenn Millionen Menschen mitten im Frieden bei Nacht und Nebel ihre Heimat fluchtartig und unter Zurücklassung von Hab und Gut verlassen, dann müssen die Verhältnisse unerträglich sein. Hier geht es um eine ununterbrochene flagrante Verletzung von Menschenrechten."
19. Mai:
Dass die SED konkrete Pläne verfolgt, die Grenze zu schließen, geht auch aus einem Schreiben hervor, dass Michail Perwuchin, sowjetischer Botschafter in Ost-Berlin, an seinen Außenminister Gromyko schickt: "Die Freunde (die SED-Führung) möchten jetzt über die Sektorengrenze zwischen dem demokratischen Berlin und West-Berlin eine Kontrolle verhängen, die es ihnen ermöglicht, das Tor zum Westen zu schließen, wie sie es nennen, den Exodus der Bevölkerung aus der Republik zu verringern und den Einfluss der ökonomischen Verschwörung gegen die DDR zu schwächen, der unmittelbar von West-Berlin ausgeht."
31. Mai:
US-Präsident Kennedy trifft in Paris den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle. Der spricht sich dafür aus, Chruschtschow mit aller Härte zu begegnen. Man müsse ihm klar machen, dass eine sowjetische Militäraktion in Berlin zum großen Krieg, wenn nicht gar zum Atomkrieg führen könnte. Unterdessen hält der Flüchtlingsstrom aus der DDR an. Im Mai sind 17.791 Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen.
4. Juni:
Gipfeltreffen zwischen US-Präsident John F. Kennedy und dem sowjetischen Parteiführer Nikita Chruschtschow in Wien. Chruschtschow kündigt an, bis zum Jahresende 1961 den separaten Friedensvertrag mit der DDR zu schließen. "Wir wollen keine Krieg", sagt Chruschtschow. "Wenn sie uns ihn aber aufzwingen sollten, wird es einen geben." Kennedy antwortet: "Ja, es scheint einen kalten Winter zu geben in diesem Jahr."
15. Juni:
"Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten", versichert Ulbricht auf einer Pressekonferenz. In der DDR ist eine Versorgungskrise ausgebrochen. Es fehlt an wichtigen Lebensmitteln wie Kartoffeln, Fleisch, Milch und Butter.
1. Juli:
Ernst Lemmer bietet der DDR seine Hilfe an. "Die Bereitschaft der Bundesregierung besteht, und sie wird sich auch nicht durch Verleumdungen abhalten lassen, unverzüglich Lebensmittel zur Verfügung zu stellen..." Die SED tut das Angebot als Propagandaschwindel ab. Die Versorgungskrise treibt im Juli insgesamt 30.415 Menschen in den Westen. Die Zahl der Flüchtlinge erreicht damit den höchsten Stand seit Juni 1953.
1. August 1961:
Ulbricht und Chruschtschow telefonieren über zwei Stunden lang miteinander. Sie erörtern nicht nur die schlechte Versorgungslage in der DDR (Chruschtschow rät Ulbricht, nach der schlechten Kartoffel-Ernte Mais anzubauen), sondern sie reden auch darüber, die Grenze zu schließen, um den Flüchtlingsstrom ein für alle Mal zu stoppen. Chruschtschow schlägt Ulbricht vor, ihm einen Vorwand zu liefern: "Wir müssen ein gemeinsames Kommuniqué veröffentlichen, wo die DDR im Interesse der sozialistischen Länder gebeten wird, die Grenze zu schließen. Dann machen Sie das auf unsere Bitte..." Ulbricht verrät, dass die Vorbereitungen für die Schließung der Grenze konkrete Formen angenommen hat: "Wir haben einen bestimmten Plan. In den Häusern, die Ausgänge nach Westberlin haben, werden die vermauert. An anderen Stellen werden Stacheldrahthindernisse errichtet. Der Stacheldraht ist bereits angeliefert. Das kann alles sehr schnell geschehen..."
5. August:
Die Außenminister der drei Westmächte treffen sich in Paris und beraten über die Berlin-Krise. Eine Einigung kommt nicht zustande.
6. August:
Ernst Lemmer wehrt sich gegen die Vorwürfe der SED, die Bundesregierung betreibe Menschenhandel. "Ich kann ... meinen Hörerinnen und Hörern in der Zone, ... die Versicherung geben: Der Weg von und nach Berlin bleibt offen", versichert der Bundesminister für gesamt-deutsche Fragen.
7. August:
Das SED-Politbüro legt sich insgeheim auf einen Termin für die Grenzschließung fest: "Der Beginn der vorgesehenen Maßnahmen zur Kontrolle erfolgt in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag aufgrund eines Beschlusses des Ministerrates."
9. August:
Die Volks- und Transportpolizei kontrolliert zahlreiche S- und U-Bahnzüge nach West-Berlin und nimmt Fluchtverdächtige fest.
10. August:
Walter Ulbricht behauptet in einer Rede, in der Bundesrepublik werde eine Hetze gegen die DDR, gegen Polen, die CSSR und gegen die Sowjetunion in einem Ausmaß betrieben, die an "Goebbels Kriegshetze und psychologischen Kriegsvorbereitungen Hitlers" erinnere.
11. August:
Die Volkskammer nickt die Maßnahmen zur "Unterbringung der von Westdeutschland und Westberlin aus organisierten Kopfjägerei und des Menschenhandels" ab. Sie erteilt dem Ministerrat die Generalvollmacht, "alle Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die sich aufgrund der Festlegungen der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages und dieses Beschlusses als notwendig erweisen." Damit ist der Bau der Mauer endgültig beschlossene Sache.
12. August:
Der Einsatzstab, der extra für die Grenzschließung eingerichtet wurde, tagt im Polizeipräsidium der Ost-Berliner Volkspolizei. Am Abend erteilt Erich Honecker, Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates und Einsatzleiter der Aktion, den Befehl zur Abriegelung der Grenze. Ab null Uhr gilt für die Nationale Volksarmee "erhöhte Gefechtsbereitschaft". Tausende Soldaten rücken an. Die Truppen sollen Durchbrüche zu den Sektorengrenzen verhindern.
13. August:
In den frühen Morgenstunden wird in Berlin das Straßenpflaster aufgerissen. Betonpfähle werden in den Boden gerammt. Stacheldraht wird gezogen. Die Volkspolizei riegelt die Grenzen zum Sowjetsektor ab. Fassungslos stehen sich Ost- und West-Berliner an der Sektorengrenze gegenüber. Soldaten und Volkspolizisten halten die Menschen mit Maschinengewehren in Schach. Um 9.15 Uhr trommelt Willy Brandt den West-Berliner Senat zu einer Sondersitzung zusammen. "Der Senat von Berlin erhebt vor aller Welt Anklage gegen die widerrechtlichen und unmenschlichen Maßnahmen der Spalter Deutschlands, der Bedrücker Ost-Berlins und der Bedroher West-Berlins. Die Abriegelung der Zone und des Sowjetsektors von West-Berlin bedeutet, dass mitten durch Berlin die Sperrwand eines Konzentrationslagers gezogen wird. Senat und Bevölkerung von Berlin erwarten, dass die Westmächte energische Schritte bei der sowjetischen Regierung unternehmen werden", erklärt Brandt. Bundeskanzler Adenauer mahnt zur Besonnenheit: "Im Verein mit unseren Alliierten werden die erforderlichen Gegenmaßnahmen getroffen", verspricht er. "Die Bundesregierung bittet alle Deutschen, auf diese Maßnahmen zu vertrauen. Es ist das Gebot der Stunde, in Festigkeit, aber auch in Ruhe der Herausforderung des Ostens zu begegnen und nichts zu unternehmen, was die Lage nur erschweren, aber nicht verbessern kann."
14. August:
Rund 15.000 Kräfte der Volkspolizei, Grenzpolizei und Kampftruppen sichern die Sektorengrenze. Sie werden abermals verstärkt durch 7.000 Soldaten, die im Hintergrund stehen. Polizei und Armee sollen einen möglichen Aufstand verhindern. Doch die Lage bleibt ruhig. Am Vormittag tagt das SED-Politbüro und beschließt weitere Abriegelungsmaßnahmen der Grenze. Die provisorischen Stacheldrahtsperren sollen "fest" ausgebaut werden.
15. August:
Der 19jährige Volkspolizist Conrad Schumann springt an der Bernauer Straße über den Stacheldrahtverhau in den Westen. Das Foto geht um die Welt.
18. August:
Um 1.25 Uhr laden Kranwagen am Potsdamer Platz Betonplatten ab. Um 2.10 Uhr rücken Feuerwehrzüge, Mörtelwagen und Maurerkolonnen an. Der Bau der Berliner Mauer hat begonnen.
24. August:
Gegen 16 Uhr versucht der 24-jährige Maßschneider Günter Litfin, nach West-Berlin zu fliehen. Als Litfin in das Hafenbecken des Humboldthafens springt, um ans Westufer zu schwimmen, schießen die Grenztruppen und treffen Litfin am Hinterkopf. Günter Litfin ist der erste Mensch, der an der Berliner Mauer erschossen wird.
Quellen:
www.chronik-der-mauer.de, www.bundesarchiv.de, Die Welt, FAZ, Die Zeit, Stuttgarter Zeitung, Stern, Spiegel, dpa aus dem Jahr 1961
Lesetipps:
Taylor, Frederick: "Die Mauer: 13. August 1961 bis 9. November 1989" ISBN: 978-3886808823, 580 Seiten, 29,95 Euro.
Flemming, Thomas u.a.: "Die Berliner Mauer, Geschichte eine politischen Bauwerks", ISBN 978-3898090834, 143 Seiten, 16,90 Euro.
Schultke, Dietmar: "Keiner kommt durch". Die Geschichte der innerdeutschen Grenze und der Berliner Mauer 1945 und 1990. 978-3746681573, 256 Seiten, 9,95 Euro
Wolfrum, Edgar: "Die Mauer - Geschichte einer Teilung", 978 3406585173, 192 Seiten, 16,90 Euro.