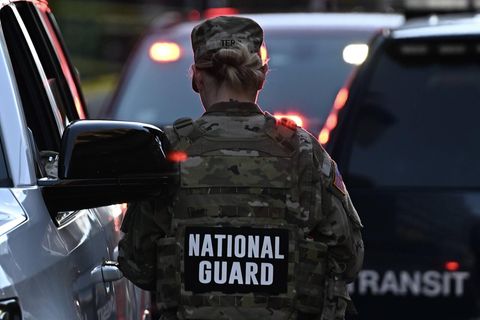In Afghanistan bricht eine neue Zeitrechnung an. Genaugenommen ist es ein Sprung zurück in die Vergangenheit – irgendwo ans Ende des vergangenen Jahrtausends, als die radikalislamistischen Taliban schon einmal am Hindukusch herrschten. Mit Grauen erinnern sich viele Afghanen daran: an die Unerbittlichkeit ihrer Kämpfer, ihren Fanatismus und die Brutalität. Wo die Taliban das Sagen habe, herrscht Willkür, und ihre Auslegung der Scharia ist so rigoros, dass selbst kleinste Vergehen harsch bestraft werden. Zu den Regeln gehören: Frauen sollten am besten zu Hause bleiben. Männer dürfen sich nicht rasieren. Musik ist weitgehend verboten.
Wer gerät jetzt ins Visier der Islamisten?
Vor allem diejenigen Afghaninnen und Afghanen, die in den vergangenen 20 Jahren in irgendeiner Form mit den USA, mit deutschen oder anderen westlichen Truppen zusammengearbeitet haben, könnten nun ins Visier der Islamisten geraten. Manche betrachten die so genannten Ortskräfte als Verräter oder als Spione, viele fürchten um ihr Leben. Wobei: Es gibt Unterschiede. Projekte, die sich um Ernährung und Landwirtschaft drehen, also in gewisser Weise "neutral" sind, zum Beispiel die Welthungerhilfe, werden von den Taliban in Ruhe gelassen. Doch wenn die Hilfe dem Weltbild der neuen, alten Herrscher widerspricht, dann droht Gefahr, Rache oder auch der Tod.
Zalmai A. ist einer dieser Ortshelfer. Er hat für die Bundeswehr als Übersetzer gearbeitet, wie er RTL erzählt: "Hören Sie, wie meine Tochter weint?", fragt in einer Sprachnachricht. Im Hintergrund schluchzt ein Kind verzweifelt. "Sie hat Angst wegen der Schießerei. Es gibt gerade Schießereien bei uns in der Nähe." Eigentlich wollte Zalmai Pässe für die Ausreise besorgen, doch dann fielen die Taliban ein und "jeder wollte schnell nach Hause".
Mittlerweile weiß A. nicht mehr, was er tun soll. Vor einem Monat hätten er und seine Familie noch nach Pakistan oder in den Iran fliehen können, sagt er. Weil er auf die Hilfe der deutschen Regierung hoffte, blieb er aber. Jetzt kann er nur noch hoffen, dass diese Entscheidung ihn nicht sein Leben kosten wird.

Zameri S. (l.) hat elf Jahre für die Amerikaner gearbeitet – unter anderem als Sicherheitsmann. Hier posiert er mit seinem 18-jährigen Sohn Fardin, der 2016 bei einem Sprengstoffanschlag auf US-Truppen verletzt wurde. In ihren Händen halten sie das Bild von Fahim, dem ältesten Sohn der Familie – er starb durch die Hände der Taliban. Wie so viele Ortskräfte dürfen auch sie in die USA ausreisen, benötigen dafür aber ein spezielles Visum, das zu beantragen derzeit schwierig ist. Dadurch verzögert sich auch der Zeitpunkt, an dem sie Afghanistan verlassen können.
Gul B. erzählt im Deutschlandfunk von ihrer innerafghanischen Flucht mit ihrem Mann und den vier Kindern in ein notdürftig errichtetes Flüchtlingslager südlich von Masar-i-Scharif. In ihrem Heimatdorf waren zuvor das erste Mal Taliban aufgetaucht. "Vor denen haben wir große Angst. Sie tragen Turbane und Tücher vor ihren Gesichtern. Die kennen keine Gnade. Sie bringen einfach Leute um. Als ich klein war, haben sie auch meinen Bruder getötet", erzählt Gul.
"Als die Ausländer noch hier waren, war alles ruhig. Aber jetzt, wo sie raus sind, ist die Situation sehr schlimm geworden", sagt sie. Wenn schon Flucht, dann wären sie und ihre Familie wie Zalmai A. eher nach Pakistan oder in den Iran geflohen. "Aber wir haben kein Geld. Wir haben überhaupt keine Chance."

Gefährlich dürften die neuen Machthaber auch für Journalisten werden. So war Mitte Juli der indische Fotograf Danish Siddiqui bei einem Angriff der Taliban auf das afghanische Militär in der Region Spin Boldak umgekommen. Gezielte Anschläge gab und gibt es auch auf Frauenrechtlerinnen, Aktivisten sowie auf Wahlbeobachter und Politiker. So starb zuletzt der Chefsprecher der afghanischen Regierung. Er wurde beim Freitagsgebet in einer Moschee erschossen.
Besonders furchteinflößend ist die Taliban-Herrschaft auch für Frauen und Mädchen. Die Islamisten hatten noch nicht einmal das halbe Land erobert, da verfügte die Regierung ein Singverbot für Frauen und Mädchen – als vorauseilendes Zugeständnis an die Taliban. Die Regelung sah vor, dass Frauen und Mädchen ab dem 12. Lebensjahr nicht mehr öffentlich singen dürfen, auch nicht die Nationalhymne. Erlaubt seien nur Veranstaltungen ohne anwesende Männer. Das Verbot betrifft auch Musikunterricht durch männliche Lehrer.
Anschläge auf "falsche" Muslime
Die Taliban sind in Afghanistan nicht die einzigen Islamisten, die zu äußerster Gewalt bereit sind. Im März hatte es einen Anschlag auf eine Schule in Kabul gegeben, bei dem mehr als 60 Menschen um Leben gekommen waren – darunter auffallend viele Schülerinnen. Mutmaßlich explodierte die Bombe absichtlich zu dem Zeitpunkt, um der von Islamisten abgelehnten "weltlichen Mädchenbildung" zu schaden. Die damalige afghanische Regierung bezichtigte die Taliban der Tat, doch die wiederum beschuldigten den ISKP, den afghanischen Ableger der Islamischen Staates. Die Terroristen hatten bereits mehrfach Anschläge auf Schiiten verübt, die in ihren Augen keine "richtigen" Muslime sind.
Quellen: RTL, "Taz", Deutschlandfunk, DPA, AFP, "Zeit", Deutschlandfunkkultur