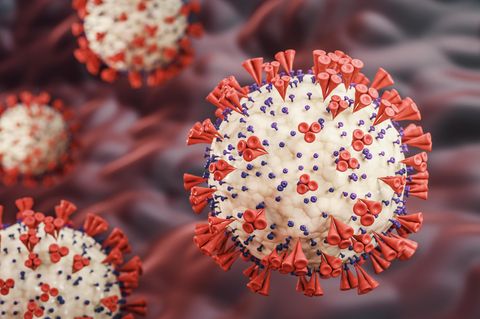Nur drei Flugstunden trennen Antalya von Düsseldorf, von Istanbul nach Frankfurt reist es sich noch schneller. Wer von Bord geht, auf den wartet der Zoll, ebenso wie seit längerem auf Reisende aus Bangkok oder Hanoi. Beamte, die sonst nach Raki und Zigaretten stöbern, sind jetzt Wächter der Vieh- und Volksgesundheit.
Veterinäre helfen, Verbotenes zu finden, damit es vernichtet werden kann: Geflügel, Eier, Federn und Milchprodukte. Tonnenweise Essbares wurde seit September am Flughafen Rhein-Main aus den Koffern geholt, das meiste kam aus Asien. Dort breitet sich der gefährliche Vogelgrippe-Erreger Influenza A H5N1 schon seit mindestens acht Jahren aus. Mindestens 148 Menschen haben sich der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge bislang mit ihm angesteckt, 79 sind gestorben. Wie hoch die Dunkelziffer ist, weiß niemand genau - was genau das Virus zum Beispiel im Süden Chinas anrichtete, bleibt ein aggressiv gehütetes Geheimnis der Führung in Peking. Doch nun ist die Gefahr näher gerückt, viel näher. Sie steht vor den Toren Istanbuls, einer Metropole mit rund zehn Millionen Einwohnern.
20 Menschen haben sich nach Angaben der Behörden in den vergangenen drei Wochen in der Türkei mit H5N1 infiziert, das bislang noch "nur" Erreger einer Tierseuche ist, die wohl von Zugvögeln ins Land getragen wurde. Vier sind gestorben. Trotz der Mutation eines für seinen Ansteckungsmechanismus wichtigen Gens, die Forscher der Weltgesundheitsorganisation soeben in einer Probe eines der Toten aus der Türkei entdeckt haben, sei es dem Virus offenbar nicht gelungen, sich exakt an den Menschen anzupassen, sagt Guénaël Rodier, der das WHO-Expertenteam vor Ort leitet. Geschähe das, könnte ein Seuchenzug, eine "Pandemie" von globalen Ausmaßen losbrechen, wie es ihn bereits 1918 gegeben hat, als das vormalige Vogelvirus H1N1 um den Globus fegte.
Pessimistische Schätzungen
prophezeien für eine neuerliche Influenza-Pandemie 360 Millionen Tote. Die dies berechnet haben, sind nicht als notorische Hysteriker berüchtigt: Es sind die Experten der Weltbank. 800 Milliarden Dollar Verlust werde solch eine Seuche der Weltwirtschaft bringen, haben sie ermittelt, und zwar allein im ersten Jahr. Das ist realistisch: Die Lungenkrankheit Sars, an der im Winter 2002/03 mehrere hundert Menschen starben, verursachte bis zu 50 Milliarden Dollar Schäden. Unternehmen wie Microsoft und BMW haben Pläne erarbeitet, in Zeiten einer Grippeepidemie verstärkt auf Heimarbeit zu setzen. Daimler-Chrysler, Henkel und Unilever besitzen Tamiflu-Notvorräte. Die Großbank HSBC hat sogar eine Strategie entwickelt, um zeitweise mit der halben Belegschaft funktionieren zu können. 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung würden nach offiziellen Berechnungen im Pandemiefall durch Krankheit ausfallen.
Die ersten H5N1-Todesopfer außerhalb Ostasiens, drei von vier Kindern des Bauern Zeki Kocyigit aus Anatolien, haben den Europäern klar gemacht, dass die Bedrohung nahe ist. Schafft das Virus nicht Tausende Kilometer weiter östlich, sondern am nahen Bosporus den Sprung über die Artgrenze und damit die Ansteckung von Mensch zu Mensch, dann käme die Seuche schnell nach Deutschland - der Reiseverkehr ist wegen des großen türkischen Bevölkerungsanteils und der Popularität des Reiseziels Türkei hochintensiv. Selbst wenn ein passender Impfstoff rasch entwickelt werden könnte, die Zeit wäre zu knapp, um ihn in großen Mengen herzustellen. Im Normalfall dauert das sechs Monate. "In der Zwischenzeit muss Tamiflu helfen, etwas anderes haben wir nicht", sagt Professor Holger Rabenau, Virologe von der Frankfurter Universitätsklinik. Trotz gesteigerter Produktion des Mittels mangelt es aber auch daran: Einzig Nordrhein-Westfalen beansprucht derzeit für sich, ausreichende Vorräte angelegt zu haben, um jeden Erkrankten behandeln zu können. Neben dem bevölkerungsreichsten Bundesland erfüllt nur Bayern die Mindestquote von 15 Prozent der Bevölkerung.
Dabei ist die Nervosität der Europäer groß: Als ein aus der Türkei heimgekehrter Reisender am Samstag mit Grippesymptomen in ein Brüsseler Krankenhaus eingeliefert wurde, war das sofort eine Topnachricht. Der Verdacht auf H5N1 bestätigte sich jedoch nicht. Am Sonntag wiederholte sich das Spektakel in Köln, mit demselben Ausgang.
Die Deutschen verstärkten die Grenzkontrollen weiter und werden das Zuchtgeflügel wohl wieder in die Ställe sperren, sobald im Frühjahr die Vogelzüge beginnen. Frankreich schließt das Geflügel in 59 seiner 96 Departements ein, durch die Zugvögelrouten führen. Und die Niederländer fordern, ihren 90 Millionen Tiere starken Federviehbestand gegen H5N1 impfen zu dürfen. Das verbietet bislang die EU, weil immunisierte Tiere in Laboruntersuchungen nicht von erkrankten zu unterscheiden seien und die Seuchenkontrolle dadurch erschwert werde.
Ist es überhaupt menschenmöglich, das Virus aufzuhalten, einzudämmen, gar auszurotten? Anfangs sah es so aus. Dank Margaret Chan. 1997 war sie Leiterin der Gesundheitsbehörde in Hongkong. Eine zupackende Ärztin, die in Kanada studiert hatte und sich mit hartnäckigem Charme durchsetzte. Als damals im Frühjahr in Hongkong die Vogelgrippe ausbrach, nahm zunächst kaum jemand Notiz. 7000 Hühner verendeten. Dieser Virus-Subtyp sei für Menschen ungefährlich, hieß es. Kurz darauf starb ein kleiner Junge - an H5N1.
"Ich hatte eine Höllenangst", erinnert sich Margaret Chan. "Ich wusste nicht genau, was wir tun sollten. Schließlich schlug ich dem Gouverneur vor, die gesamte Geflügelpopulation der Stadt zu töten. 1,4 Millionen Hühner, innerhalb von drei Tagen. Ich wusste nur: Nach zwei Wochen würden wir wissen, ob sich massenhaft Menschen angesteckt hätten." Am 29. Dezember 1997 begann das große Schlachten. In den folgenden beiden Wochen druckten die Zeitungen den "Chan-Kalender": Es war wie ein Countdown. Zwar infizierten sich 18 Menschen, sechs starben. Der Ausbruch der großen Seuche aber blieb aus. Ein paar Jahre herrschte trügerische Ruhe.
Dann war H5N1 wieder da, diesmal bereit zur Weltreise. Es hatte sich von 1997 bis 2003 verborgen gehalten. Denn entstanden sein dürfte das Virus nicht in Hongkong, einem ganze 1100 Quadratkilometer großen Territorium, das sich gut kontrollieren lässt, sondern in seinem gewaltigen Hinterland: der 8700-mal größeren Volksrepublik China mit 1,3 Milliarden Einwohnern und gut zehnmal mehr Federvieh, das sich vielerorts mit den Bauern die gute Stube teilt. Als der Erreger vor drei Jahren nach Hongkong zurückkehrte, gingen die Behörden von neuem daran, das Geflügel zu vernichten.
Diesmal half es nichts mehr. H5N1 wütete in China, bald darauf in Südkorea, Japan, Vietnam und Thailand. Im Februar 2004 war Indonesien erreicht, im Sommer Malaysia. Und seit dem Herbst verschleppen sie es nach Norden und Westen, in die Mongolei, nach Sibirien, ins europäische Russland, nach Rumänien und Bulgarien und jetzt in die Türkei. An der Wurzel gepackt wurde das Übel nicht: in China. Die Mächtigen dort üben sich in Geheimniskrämerei. Im vergangenen Oktober blockierten Polizisten mit Schutzmasken alle Wege zum Dorf Wantang in der südchinesischen Provinz Hunan - um Journalisten fern zu halten. Erst Tage später sickerte durch: Die Hühner des Bauern He Tieguang waren verendet. Am Abend hatten seine beiden Kinder, die zwölfjährige Tochter He Yin und ihr neunjähriger Bruder Junyao, Fieber. Sie wurden ins Kinderkrankenhaus der Provinzhauptstadt Changsha gebracht. Zwei Tage später starb He Yin.
Im Krankenhaus hieß es, man habe keine Patienten aus Wantang aufgenommen. Im Dorf log ein Funktionär, hier lebe niemand mit dem Namen He. Und als der Vater mit Journalisten am Telefon über den Tod seiner Tochter sprach, umstellten Polizisten sein Haus. Von nun an nahmen sie den Hörer ab. Chinas Chefveterinär Jia Youling beschwichtigte das Milliardenvolk, seine Pressekonferenz wurde im Fernsehen live übertragen: "Unter Führung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei haben wir eine Ausbreitung der Vogelgrippe auf den Menschen verhindert." Eine Reporterin fragte: "Was können Sie uns zu dem Fall des zwölfjährigen Mädchens ..." In diesem Moment brach die Sendung ab.
Einheimische Virenjäger werden des Verrats bezichtigt. So wie Guan Yi. Der Virologe an der Universität von Hongkong gilt als einer der führenden Vogelgrippe-Forscher der Welt. Er hatte auch entdeckt, dass Zibetkatzen die ersten Menschen mit der Lungenkrankheit Sars angesteckt hatten. Damit rettete er Millionen Chinesen das Leben. Doch Guan gilt als potenzieller Staatsfeind.
Im vergangenen Juli stürmten Vertreter des Pekinger Landwirtschaftsministeriums seine Labor-Filiale in der südchinesischen Küstenstadt Shantou. "Sie haben Staatsgeheimnisse verraten", riefen die Beamten. In der Fachzeitschrift "Nature" hatte Guan Yi über H5N1-infizierte Hühner berichtet, die er in drei chinesischen Provinzen fand. Diese Ausbrüche seien geheim, sagten die Männer und drohten: "Auf Verrat steht lebenslange Haft." Guan reiste ins sichere Hongkong, sein Labor in Shantou wurde geschlossen. "Doch ich habe nichts falsch gemacht", sagt er wütend. "Sie wollen einfach nicht zugeben, dass das Virus in jeder Ecke des Landes zu finden ist. Ich habe klare Beweise dafür. Und ich werde weiter dafür kämpfen, eine Pandemie zu verhindern."
Mitte November gestanden die Behörden ein, dass zwei Menschen in der Volksrepublik an Vogelgrippe erkrankt waren - darunter auch der neunjährige He Junyao. Zugleich verkündete der Apparat einen monströsen Plan: Alle 14 Milliarden Hühner, Enten und anderes Federvieh des Landes sollen geimpft werden.
Frühe Transparenz wäre besser gewesen. Als stellvertretende Direktorin der WHO ist Hongkongs einstige Behörden-Chefin Margaret Chan heute für die Bekämpfung von pandemischen Infektionskrankheiten zuständig. Sie propagiert "strategische Aktionen" - bevor der Erreger sich an den Menschen anpasst: "Noch nie ist es gelungen, eine Pandemie zu stoppen, wenn sie einmal begonnen hat", sagt Chan. Die WHO hat umfassende Pläne zur Epidemie-Prophylaxe. Sie hat ein neues Seuchen-Überwachungszentrum in Genf, in dem Leuchtpunkte auf Computerschirmen die globale Lage anzeigen. Sie hat mobile Teams, die jederzeit zu neuen Ausbrüchen aufbrechen können. "Wir brauchen ein internationales Frühwarnsystem. Leider funktioniert es nur sehr unzureichend", sagt Margaret Chan. Denn eines hat die WHO nicht: Macht, sich über Regierungen hinwegzusetzen, die nachlässig, mittellos, allzu stolz oder zynisch sind.
Als Zeki Kocyigits ältester Sohn Mehmet Ali, 14, am Neujahrstag, einem Sonntag, im Krankenhaus der ostanatolischen Stadt Van starb, ließ der Gesundheitsminister in Ankara verlauten, er habe eine "Lungenentzündung" gehabt. Dass H5N1 im Spiel war, erfuhr die Öffentlichkeit kurz vor dem Tod seiner Schwester Fatma, 15, am darauffolgenden Donnerstag. Am Freitag starb die elfjährige Hülya. Die Kinder Zeki Kocyigits waren arm, und sie waren Kurden. Ihre Volksgruppe, obwohl am stärksten gefährdet, wurde zunächst ausschließlich auf Türkisch und meist nur schriftlich auf die Gefahr hingewiesen. Doch die meisten Bauern können weder lesen noch schreiben, und den Abgesandten Ankaras trauen sie nicht. Also wird allerorten das Federvieh versteckt - es ist für viele die einzige Fleischquelle im Winter. Und auch für analphabetische Bauern gilt: Entschädigung für Notschlachtungen gibt es nur auf schriftlichen Antrag. Mit anderen Worten: Nie.
Dass es um Margaret Chans "strategische Aktionen" am Ostrand Europas nicht gut bestellt ist, war selbst für Besucher Istanbuls vergangene Woche nicht zu übersehen: In den Quarantänebezirken der zweitgrößten Stadt Europas wurden Hühner und Gänse mit bloßen Händen eingefangen, von kichernden Kindern, die das Federvieh danach an vermummte Beamte des Landwirtschaftsministeriums weiterreichten. Güngör Uras, Wirtschaftskolumnist der Tageszeitung "Milliyet", klagt: "Das Dorf ist in die Stadt gezogen, und mit ihm die Kühe, Schafe und Hühner, die in den ärmeren Gegenden von Istanbul und Ankara seelenruhig auf der Straße entlangspazieren."
Hier zeigt sich nun, dass die Industrialisierung der Viehhaltung im Westen auch ihren Segen hat: Sie erleichtert die Kontrolle ebenso wie das generalstabsmäßige Massenschlachten. Als H7N7, ein Vetter von H5N1, 2003 im Grenzgebiet zwischen den Niederlanden, Belgien und Deutschland grassierte, infizierten sich 89 Menschen, ein Tierarzt starb. In kurzer Zeit wurden 20 Millionen Hühner getötet. Eine große, aber wegen der Konzentration der Bestände konsequent zu bewältigende logistische Aufgabe. Die H7N7-Epidemie kam zum Stillstand. Machen es Armut und Rückständigkeit unmöglich, dass auch H5N1 gestoppt werden kann, wie in der Türkei? Der Zentralismus eines machtbesessenen Einparteiensystems wie in China? Das Beispiel Vietnams spricht eine andere Sprache - Umdenken ist möglich.
42 der offiziell gemeldeten 79 H5N1-Todesopfer sind Vietnamesen. Jahrelang hat auch Hanoi die Gefahr heruntergeredet, Ängste zerstreut, die Wahrheit vertuscht. Ein Frühwarnsystem existierte nicht, Labors waren miserabel ausgestattet, die Krankenhäuser hatten keine Grippemittel. Eine Vogelgrippe-Epidemie aber wäre verheerend für die gerade aufblühende Wirtschaft des Entwicklungslandes gewesen. Das dämmerte schließlich auch den alleinherrschenden Kommunisten. Im vergangenen Herbst erklärte die Partei H5N1 den Krieg.
In diesem Krieg steht Quang Anh Bui an vorderster Front. Als Chefveterinär des Landes verantwortet er das Herzstück der Kampagne: die Massenimpfung von Geflügel. Jedes Huhn, jede Ente im Land werde gegen die Vogelgrippe vakziniert, sagt er, 170 Millionen Tiere. Mehr als 90 Millionen Tiere habe man schon geschafft.
Man solle auf die Lautsprecher hören, sagt der Chefveterinär. Auf die Lautsprecher, die scheppernden Propagandageräte der Partei. Jeden Morgen um 6.30 Uhr und jeden Nachmittag um 17 Uhr quäkt es aus ihnen über jedes Dorf: Informationen über Ausbrüche der Vogelgrippe. Aufrufe, den Verzehr von Hühnerfleisch zu unterlassen. Es gilt als gutes Zeichen, dass die Preise für Schweinefleisch und gegrillten Hund steigen. Und dank täglicher Beschallung wissen schon die kleinen Kinder, dass etwas Gefährliches in Hühnern lebt und H5N1 heißt.
Aufklärung tut Not - weltweit. Denn nur frühzeitiges Handeln kann die Folgen einer Anpassung des Virus an den Menschen so weit wie möglich abmildern. Verdachtsfälle müssen deshalb rasch erkannt und gemeldet werden. Alle Experten haben die Epidemie des einstigen Vogelgrippe-Erregers H1N1 als Menetekel vor Augen. Seine Erforschung spielt auch für den Kampf gegen H5N1 eine große Rolle.
1918 scheint H1N1 im amerikanischen Bundesstaat Kansas der Sprung auf den Menschen gelungen zu sein. Dessen Immunsystem war darauf gänzlich unvorbereitet. Der Stuttgarter Medizingeschichtler Robert Jütte beschreibt das Grauen der Infektion: "Die Krankheit begann als grippaler Infekt, doch schon bald traten weitere Symptome zutage. Auf den Wangen zeigten sich mahagonifarbene Flecken. Die meisten Patienten entwickelten zusätzlich eine schwere Lungenentzündung, gegen die es damals noch kein wirksames Mittel gab. Die Kranken spuckten Blut und starben oft einen grausamen Erstickungstod.
Der Anblick der sterbenden Soldaten, die alle im besten Alter und vorher kerngesund gewesen waren, war so schrecklich, dass der neben anderen medizinischen Koryphäen zu Hilfe gerufene Colonel Victor C. Vaughan, der Vorsitzende der Amerikanischen Ärztegesellschaft, später in seinen Memoiren festhielt: "Diese Erinnerungen sind abscheulich, am liebsten würde ich sie mir aus dem Hirn reißen, sie vernichten, aber leider steht das nicht in meiner Macht." Es war die größte Seuche der Weltgeschichte: Ein Drittel der Menschheit erkrankte. 50 Millionen Tote soll es damals gegeben haben - die höchsten Schätzungen sprechen gar von hundert Millionen.
Seit einigen Monaten existiert der tödliche Erreger von einst wieder: Forscher um den Armeepathologen Jeffery Taubenberger aus Rockville bei Washington haben ihn mühselig rekonstruiert - aus Gewebeproben von 1918, die Taubenberger aus einer zur Archivierung der Obduktionsergebnisse damals angelegten Sammlung von Paraffinblöcken fischte und aus Lungengewebe einer Toten, die damals im Permafrost Alaskas begraben worden war. Es dauerte zehn Jahre, die insgesamt acht Gene von H1N1 zu rekonstruieren. Seit Oktober liegen die Ergebnisse vor. "Wie das Vogelgrippevirus H5N1 von heute stammt auch H1N1 ursprünglich wohl direkt von einem Vogel", sagt Taubenberger. "Möglicherweise hat es ein anderes Tier als Zwischenwirt genutzt. Jedenfalls hat es sich darin nicht mit anderen Grippeviren gemischt und dabei abgeschwächt, wie es sonst häufig passiert. Vielleicht war es so tödlich, weil es direkt auf den Menschen sprang."
Der Vergleich der beiden Gripppeviren soll helfen, H5N1 besser einschätzen zu können. Dabei konzentrieren sich die Forscher auf die 25 bis 30 Mutationen, die ein menschliches Grippevirus von einem reinen Vogelgrippevirus unterscheiden. "Die Viren vom Typ H5 zeigen bislang nur vier bis fünf dieser Veränderungen", so Taubenberger. "Das reicht offenbar, um sich als Mensch bei Tieren anzustecken." Zur Pandemie fehlen offenbar noch einige Zutaten.
Selbst wenn die Forscher
entscheidend weiterkommen und den Influenza-Viren neue High-Tech-Innovationen entgegensetzen, bleiben die fruchtbarsten Nährböden der Seuchen wohl noch für lange Zeit erhalten: Armut, Not und Ignoranz.
Als Mehmet Ali Özcan aus Dogubeyazit nahe dem Wohnort der Familie Kocyigit vor zwei Wochen erfuhr, dass zwei seiner sechs Kinder vermutlich an der Vogelgrippe erkrankt seien und daher dringend in das Universitätskrankenhaus von Van gebracht werden müssten, verweigerte er die Zustimmung. "Meine erste Frau ist an Nierenversagen gestorben, und keiner wollte ihr helfen, weil wir kein Geld haben", sagte er. "Jetzt wird man die Kinder nach Van mitnehmen, wo sie sterben werden, und danach wird man mir eine Rechnung schicken, die ich nicht bezahlen kann. Ich will, dass sie hier behandelt werden und hier sterben." Erst nach intensivem Zureden ließ er seine Kinder schließlich doch gehen. Seine Tochter starb am Sonntag, sein Sohn schien da außer Lebensgefahr.