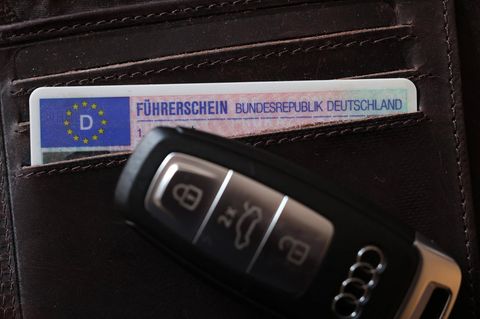Die Europäische Union erlebt einen Absturz in atemberaubendem Tempo: Nicht einmal ein Jahrzehnt ist vergangen, seit den Bürgern in zwölf Staaten die Euro-Banknoten und -Münzen ausgehändigt wurden. Heute steht die Währungsunion der 16 vor einer existenziellen Frage: Rauft man sich zusammen und überwindet die Krise, oder scheitert der Euro? Die FTD beschreibt vier Szenarien des Jahres 2015 und deren Konsequenzen für die Gemeinschaft und die Staaten
Szenario 1: Weiter wie bisher - irgendwas geht in Europa immer
Es ist Mitte Dezember 2015, aber in Brüssel herrscht kein vorweihnachtlicher Frieden. Im Berlaymont-Gebäude sitzt seit Stunden das Team von Kommissionspräsident José Manuel Barroso zusammen. Der Plätzchenteller ist längst leer gefuttert. Es ist Barrosos dritte Amtszeit, er hat es verstanden, sich in der Dauerkrise der EU in den vergangenen fünf Jahren unverzichtbar zu machen. Auf dem Tisch liegen Papiere mit dem Ergebnis der ersten Bürgerinitiative der EU: Drei Millionen Menschen, darunter Deutsche, Finnen, Letten, Iren, Griechen und Briten haben unterschrieben, dass sie eine Abschaffung des Euro unterstützen. Schnell ist man sich in der Runde einig: Das "EBI" ist aus formalen Gründen unzulässig, die Kommission erklärt sich für nicht zuständig. "Uff", seufzt einer in der Runde, "nun stellt euch einmal vor, wir würden das Volk wirklich mitentscheiden lassen. Europa wäre am Ende." Europa existiert noch, aber das ist auch schon das Beste, was man über die Gemeinschaft des Jahres 2015 sagen kann. Von den Hoffnungen auf mehr Zusammenhalt und Effizienz, die sich mit dem Ende 2009 in Kraft getretenen Lissabon-Vertrag verbanden, ist nichts geblieben. Die EU-Regierungen sind zerstritten, das Misstrauen, das die Euro-Krise säte, blockiert das Vorankommen in anderen Bereichen. Die große Agrarreform ist vertagt, die Freihandelsgespräche mit Indien gescheitert. In mehreren Ländern - auch Deutschland - sind antieuropäische Parteien gegründet worden. Vor dem G20-Gipfel im Frühjahr bittet der US-Präsident die Kollegen aus China, Russland, Indien, Indonesien und Brasilien zum Zwiegespräch - die Europäer werden vertröstet. "Europe screwed up", betitelt der "Economist" ein viel beachtetes Editorial, nachdem der neue Präsident der EZB, Jürgen Stark, aus Protest gegen den massiven Druck für eine weitere Zinssenkung zurückgetreten ist. Polen und Tschechien erklären, dem Euro endgültig nicht beitreten zu wollen. Auf Wikileaks erscheinen Dokumente, wonach das Zentralkomitee in Peking entschieden hat, im großen Stil Euro-Reserven aufzulösen. Barroso hat einen Krisengipfel der Staatschefs anberaumt - in diesem Jahr schon der siebte.
Europäische Salamitaktik
Es beginnt mit einem griechischen Etatleck, das die krisenerprobte EU nicht weiter beunruhigt. Schließlich weiß jeder - oder konnte wissen -, lange bevor am 8. Dezember 2009 als erste Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit herabstuft, dass Hellas nicht die Heimat der Haushaltsdisziplin ist. Es geht um ein EU-Mitglied, das nicht einmal drei Prozent zur Wirtschaftsleistung der Euro-Zone beiträgt. Dessen gesamte Staatsschulden niedriger sind als der deutsche Bankenrettungsfonds. Warum also die ganze Aufregung?
Bei dieser Haltung blieb es, als Ende 2010 erst Irland und dann Portugal kippte. Schließlich hat man - zögernd - einen 750-Mrd.-Euro-Rettungsschirm aufgespannt. Hat Anfang 2011 das Paket verdoppelt. Bald werde sich die Lage beruhigen, so Regierungskreise. Die Krise ist der Politik immer einen Schritt voraus.
Laborieren an Symptomen
Denn Märkte und Öffentlichkeit wollen einfach nicht begreifen. Das Griechenland-Debakel hat zwei Probleme grell beleuchtet, die sich weder mit Geld noch guten Worten lösen lassen: Der Euro ist ein politisches Projekt, kein optimaler Währungsraum im ökonomischen Sinn. Es wurden keine Vorkehrungen dafür getroffen, dass sich einzelne Staaten nicht im Sinne des Ganzen verhalten. Und eine weitere Frage treibt Märkte und Bürger um: Wie viel Staatsverschuldung kann ein Land und die Euro-Zone aushalten?
Uneinigkeit und lange Prozesse
Der Versuch der EU, die Regeln des ökonomischen Zusammenlebens zu verbessern, aber verläuft im Sande. Es zeigt sich, dass die mittlerweile 29 EU-Staaten uneins sind, wohin die EU will. Im Sommer 2011 stellte Frankreich sein Konzept einer zentralisierten Wirtschaftsregierung vor. Die deutsche Kanzlerin, die nach dem CDU-Debakel bei der Baden-Württemberg-Wahl im März ums Überleben kämpft, sagt im Bundestag "Mit mir nicht". Ende November findet die 37. Sitzung des Ecofin zum deutschen Vorschlag statt, wirksame Sanktionen gegen Haushaltssünder zu beschließen.
Angst vor dem großen Wurf
Im Frühjahr 2013 scheitert der Versuch Griechenlands, zurück an den Kapitalmarkt zu gehen. Das Haushaltsdefizit liegt bei fünf Prozent, die Arbeitslosigkeit bei 15 Prozent. Demonstranten in Athen halten Plakate hoch, auf denen Merkel ein Hitlerbärtchen trägt. EU und IWF beschließen die Verlängerung der Kredite: Eine Umschuldung zu diesem Zeitpunkt sei zu gefährlich, heißt es. Die Weltkonjunktur ist im Abschwung. Ökonomen warnen vor dem Lehman-II-Weltfinanzkollaps. Immer neues Geld
Das Wunder geschieht: Die Verzehnfachung des Krisenpakets hat die Märkte beruhigt - bis im Spätherbst 2015 die spanische Regierung kollabiert, weil das Parlament die Rentenkürzung abschmettert. Der Euro verliert an einem Tag 5 Cent. Barroso ruft Merkel an.
Ines Zöttl, Berlin
Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent
Szenario 2: Reformierte Union - Wirtschaftsgemeinschaft in Kerneuropa
Die eine Hälfte auf Deutsch, die andere auf Französisch, so hält Wolfgang Schäuble in Aachen seine Dankesrede dafür, dass er den Karlspreis 2015 bekommen hat. Über 20 Jahre ist es her, dass er erstmals über "Kerneuropa" mit einem aus Deutschland und Frankreich bestehenden "Kern des Kerns" geschrieben hat. Die Euro-Schuldenkrise war es, die die zunächst unwilligen Staats- und Regierungschefs dazu getrieben hat, den Zusammenhalt der EU zu stärken. Zuletzt ist sogar in vielen Staaten der Euro-Zone die Zustimmung zur Gemeinschaftswährung wieder gewachsen, weil die Arbeitslosigkeit sinkt und die Wirtschaft stärker wächst als erwartet. Zum 1. Januar 2016 soll Polen dem Euro beitreten. Angefangen hat alles am 4. Februar 2011. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy lädt nach einem kurzen EU-Gipfel einen kleinen Kreis von Staats- und Regierungschefs, Kommissionschef José Manuel Barroso und EZB-Chef Jean-Claude Trichet ins belgische Regierungsgästehaus Val Duchesse in Brüssel zum Abendessen. Er überlässt Kanzlerin Angela Merkel die Wortführung: "In den nächsten Wochen wird es noch einmal richtigen Ärger am Finanzmarkt geben. Wir müssen deshalb unsere Mechanismen aggressiver einsetzen und außerdem endlich eine echte Wirtschaftsunion werden, man könnte auch sagen, eine politische Union, zumindest in der Euro-Zone." Die 2010 als "Madame Non" verschriene Merkel hat sich über Weihnachten entschlossen, ohne Rücksicht auf die skeptischen Deutschen zu handeln. Ihre zweite Amtszeit soll einen klaren Stempel bekommen: Merkel, die Retterin Europas. Alle am Tisch wissen, dass man Großbritannien nicht für das Projekt Euro-Union gewinnen kann. Die engste Abstimmung muss deshalb in der Euro-Zone laufen. Die fast fertige Neuregelung des Stabilitätspakts wird noch einmal verschärft: Verdoppelung der Pfand- und Strafzahlungen bei Verstößen in den frühen Phasen, strenge Aufsicht über die Haushaltspolitik.
Deutschland und Frankreich, das hat Merkel mit dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy vereinbart, wollen Zeichen setzen. Die beiden Staaten, die zusammen deutlich über 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Euro-Zone stellen, lassen ab Sommer 2011 ihre Kabinette gemeinsam über die beiden Staatshaushalte beraten und abstimmen. Die Euro-Zone wird auch ihre Steuerpolitik stärker harmonisieren.
Signal an die Finanzmärkte
Um die Finanzmärkte zu beeindrucken, reichen hochfliegende Zukunftspläne nicht. Das wissen die Regierungen, die deshalb ihre Krisenmechanismen schon 2011 deutlich ausweiten. Sie geben eine sofort wirksame politische Garantie ab, dass das Grundkapital des Rettungsfonds EFSF bei Bedarf verdoppelt werden kann. Portugal wird unter den Schirm genommen, aber zugleich werden die Zinssätze für Portugal, Irland und Griechenland etwas gesenkt. Zwar schreckt die Merkel-Regierung wegen des Bundesverfassungsgerichts vor einer direkten Subventionierung der Länder zurück, aber Deutschland verspricht, keinen Gewinn zu machen. Diese Entlastung der Krisenstaaten ist ein Signal an die Märkte, dass kein Land so überfordert werden soll, dass es sich nicht mehr selbst erholen kann. Spanien erhält im Mai 2011 einen kurzfristigen Kredit, um die Marktspekulationen zu beenden, muss aber nicht auf Dauer unter den Rettungsschirm. Die Europäische Zentralbank unterstützt die Stabilität der Euro-Zone weiter durch Anleihekäufe und wartet, solange es eben geht, mit der nächsten Zinserhöhung.
Krisen schweißen zusammen
Die europäische Einigung hat gerade durch Krisen immer wieder einen Schub bekommen: Der "Eurosklerose" der 80er-Jahre folgten der Binnenmarkt und dann die gemeinsame Währung. Die Fiskalunion, so sieht es zum Beispiel Thomas Straubhaar vom Wirtschaftsinstitut HWWI, werde die "langfristige Konsequenz" aus den Euro-Turbulenzen sein.
Zentralisierung der Macht
Die zentralen Ebenen in der EU und vor allem in der Euro-Zone werden durch das Zusammenwachsen gestärkt. Weil auch 2015 nicht alle dann 29 EU-Staaten an gemeinsamer Wirtschaftspolitik interessiert sind, kann der Stabilitätsmechanismus ESM zu einem Mittelding zwischen Währungsfonds und Euro-Finanzministerium werden, das die Finanzpolitik steuert. Dafür sind weitere Vertragsänderungen nötig. Ein Problem ist die demokratische Kontrolle: Falls nur ein Teil der neuen Koordinierung und Aufsicht über die EU-Kommission läuft, hätte das EU-Parlament keine volle Kontrolle.
Ende der schönen Wahlversprechen
Deutschland gibt wie die anderen Staaten noch mehr Souveränität auf. Die Haushalts- und selbst die Steuerpolitik muss mit anderen Staaten abgestimmt werden. Das engt die Möglichkeit für schöne Wahlversprechen erheblich ein. Durch gemeinsame Eurobonds kann die Zinsbelastung leicht steigen. Die deutsche Wirtschaft dagegen profitiert: Währungsraum und Binnenmarkt bleiben intakt und das Wachstum in der Euro-Zone liegt insgesamt höher, wenn die Krisenländer ihren Sparschock überwunden haben.
Peter Ehrlich, Brüssel
Wahrscheinlichkeit: 35 Prozent
Szenario 3: Glimpfliche Trennung - Tausche 15 Silvio gegen eine Franc-Mark
Rom im Dezember 2015: Mit einem strahlenden Siegerlächeln springt Silvio Berlusconi aus seiner schwarzen Lancia-Limousine, eilt vorbei an den Kamerateams, die steinernen Stufen hinauf in die Südeuropäische Zentralbank (SZB) in der Via Nazionale. Der italienische Ministerpräsident regiert bereits in seiner fünften Amtszeit. Heute will sich der geliftete 79-Jährige auch über Italiens Grenzen hinaus unsterblich machen.
Am Wochenende hat er seine Amtskollegen aus der Slowakei, Spanien, Portugal, Griechenland und Slowenien in seiner Villa auf Sardinien empfangen - hinter verschlossenen Türen. Nun wird er im prunkvollen Zentralbankgebäude mit den Staatschefs vor laufenden Kameras seinen Triumph verkünden: Die gemeinsame Währung Seuro soll in Silvio umbenannt und weiter abgewertet werden. Der Wechselkurs eines Silvio gegenüber der Franc-Mark, dem Euro der nördlichen Länder, soll 15 zu eins betragen - um die eigenen Exporte zu stützen. Bei der Aufspaltung der Euro-Zone in zwei Teile im Jahr 2011 lag der Kurs noch bei drei zu eins.
Die Trennung vier Jahre zuvor war unausweichlich geworden, nachdem die EU-Staatschefs sich monatelang zu keinem Befreiungsschlag zur Beruhigung der Märkte hatten durchringen können. Die Risikoaufschläge für Staatsanleihen Spaniens und Italiens schossen immer weiter in die Höhe - so lange, bis eine Rettung auch durch vereinte Kräfte anderer Euro-Länder nicht mehr möglich war.
"Lehman II" titelten die Zeitungen. "Schmeißt die Südländer raus", skandierten die Parteitage neu gegründeter Anti-Euro-Bewegungen wie "Pro Gulden" in den Niederlanden oder "Volkes Stimme" unter Führung von Thilo Sarrazin und Hans-Olaf Henkel in Deutschland. Der Politik war die Handlungshoheit fast gänzlich entglitten. Die panischen Märkte im Nacken sahen Angela Merkel und Nicolas Sarkozy nur noch einen Ausweg, um das Projekt Euro nicht ganz aufzugeben: Die kontrollierte Teilung der Währungszone.
Seither ist der Virus der Spaltung auf die Politik übergesprungen. Berlusconis Pläne für einen abgewerteten Silvio sorgen vor allem bei Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Dominique Strauss-Kahn für Ärger. Denn seit der Teilung der Währungsunion leiden die Exporte der nördlichen Länder unter der massiven Aufwertung der Franc-Mark - ein Problem auch für die immer noch labilen Banken, die sich von dem Beinahe-Kollaps nach der Teilung nie ganz erholt haben.
Süße Verlockung
Das Szenario von zwei Währungszonen erscheint vielen verführerisch. Die theoretischen Vorteile von einem Süd- und einem Nordeuro liegen auf der Hand: Das Schreckgespenst "Transferunion" ist damit vom Tisch. Nordländer wie Deutschland, Österreich oder die Niederlande können eine strengere Stabilitätspolitik einführen und entsprechend schärfer haushalten. Peripherieländer wie Griechenland, Italien oder Portugal können ihre Währung abwerten und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Die jeweiligen Zentralbanken haben es einfacher, weil sie bei ihrer Geldpolitik nicht mehr derart markante Strukturunterschiede der Mitgliedsstaaten einbeziehen müssen. Die jeweiligen Ländergruppen sind homogener.
Riskante Entflechtung
Nicht mehr als ein Traum, sagen viele Ökonomen. Eine Teilung der Währungszone halten sie für technisch schlicht nicht machbar. "Eine Aufspaltung des Euro bedeutet das Ende des Euro", sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Der europäische Bankensektor würde infolge einer Spaltung kollabieren - prognostizieren Ökonomen wie Daniel Gros, Direktor des Brüsseler Centre for European Policy Studies, oder Henrik Enderlein, Professor an der Hertie School of Governance. Denn es gäbe einen Bankrun in den Südstaaten. Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen den Euro-Staaten ist zu groß, um das auszuhalten.
Zinslast erdrückt Peripherieländer
Übersteht der Bankensektor wider Erwarten eine Teilung, gibt es wohl andere verheerende Folgen. Das Resultat sind "Vermögensverluste in den aufwertenden Ländern, Konjunktureinbrüche und Aktiencrashs", warnt Kater. Die deutsche Exportwirtschaft - Motor des Wirtschaftsaufschwung - werde unter der starken Aufwertung ächzen. Der Süden steht trotz der Abwertung, die seine Produkte im Ausland verbilligt, vor neuen Problemen. Die Zinskosten für nationale Schulden werden "für die ohnehin schon kaum mehr kreditfähigen peripheren Länder noch weiter nach oben schnellen", befürchtet Thomas Straubhaar, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Damit werde automatisch "deren Niedergang beschleunigt". Zudem halten Experten das Szenario politisch kaum für umsetzbar: "Es gibt keinen Anreiz für die Peripherieländer, sich in einer schwachen Währungsunion zusammenzutun", so Willem Buiter, Citigroup-Chefvolkswirt.
Martin Kaelble, Berlin
Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent
Szenario 4: Kollaps der Währungsunion - Das Ende mit dem großen Knall
Auf Naxos ist es Weihnachten 2015 noch milde 20 Grad warm. Miranda Parker sitzt am Pool und genießt die Freizeit. Ihr Arbeitgeber, die Londoner Megabank, hat ihr gerade 2 Mio. Pfund Bonus ausgezahlt. Sie gehört dort zu den Spitzenkräften, seit sie 2011 die Idee mit den D-Mark-Zertifikaten hatte. Der Handel mit Wetten auf den künftigen Kurs einer wieder eingeführten Deutschen Mark wurde zum Renner. Miranda wartet auf ihre niederländische Studienfreundin Chris.
Chris ist noch immer arbeitslos, seit sie ihren Job in einer Import-Export-Firma in Rotterdam verloren hat. Im Land der billigen "Nea Drachma" kann sich Chris einen Urlaub aber noch leisten. Sie fährt mit dem Auto, und auf dem Weg zum Ziel gelten elf Währungen: der niederländische Gulden, der flämische Gulden im autonomen Flandern, der wallonisch-luxemburgische Franc, die D-Mark in Deutschland und Österreich, die italienische Lira, der slowenische Tolar, die kroatische Kuna, die an die Mark gekoppelten Währungen in Bosnien, Montenegro und Mazedonien und dann die Nea Drachma.
Die Währungsvielfalt gibt es, seit die Euro-Zone 2012 in einem chaotischen Prozess auseinandergeflogen ist. Es begann damit, dass Griechenlands Ministerpräsident Giorgos Papandreou im Juni 2012 ultimativ von Bundeskanzlerin Angela Merkel verlangte, den Rettungszins zu senken. Andernfalls werde sein Land die Währungsunion verlassen. Merkel lehnte brüsk ab: "Dann geh doch". Was die Kanzlerin nicht wusste: China hatte den Griechen eine 20-Mrd.-Dollar-Kreditlinie eröffnet. Auch die Nea-Drachma-Scheine werden in China gedruckt.
Anfang Juli 2012 lädt Griechenland zu Verhandlungen über eine Umschuldung ein. Die bundeseigene KfW-Bank und die EZB müssen Milliarden abschreiben. Die Märkte reagieren panisch, der Euro fällt unter 1 Dollar. Merkel gerät in der CDU unter Druck: Fraktionschef Volker Kauder fordert offen den Austritt aller Krisenländer aus dem Euro. Finanzminister Wolfgang Schäuble tritt empört zurück.
Merkel versucht, einen möglichst großen Nord-Euro-Raum zu erhalten und stellt dafür Frankreich harte Bedingungen. Der neue französische Präsident Dominique Strauss-Kahn beruft eine Sondersitzung des Kabinetts auf dem Flugzeugträger "Charles de Gaulle" ein. Frankreich behält für seine Währung den Namen Euro, Südbelgien und Luxemburg binden ihren neuen Franc an Frankreich. Weniger Staaten binden sich an Deutschlands Währung als vor der Euro-Einführung.
Bargeldversorgung bricht zusammen
Die Rückkehr zu nationalen Währungen verursacht Chaos. Zwar müssen keine Wechselkurse vorab festgelegt werden, wenn der Ausgangspunkt der Euro ist. Franc und Mark wären am ersten Tag der Spaltung je 1 Euro wert und würden dann auf- oder abwerten. Aber schon die Einigung auf einen Tag X erweist sich als Problem. Bei den ersten Gerüchten würden Anleger in Hartwährungen flüchten oder sich ganz von Europa abwenden. Plötzliche Wertverluste in vielen Anlageportfolios würden zu Pleiten von Finanzinstituten führen. Die Bargeldversorgung würde zusammenbrechen: Das Drucken von Euro-Banknoten und das Prägen von Münzen hatte Jahre vor dem Starttermin begonnen.
Gelähmte EU
Folge: Die EU ist über Monate komplett gelähmt. In einer Phase, in der kein Land seine Finanzlage überblickt, kann keine neue EU-Planung beschlossen werden. Der Binnenmarkt ist durch neuen Protektionismus geschwächt. Die wirtschaftspolitische Koordination ist obsolet, kaum noch ein Staat hält sich an die Vorgaben des Maastricht-Vertrags und begrenzt sein Defizit oder seine Gesamtschulden. HWWI-Chef Thomas Straubhaar rechnet nicht nur mit ökonomischen, sondern auch mit politischen Spannungen, wenn Deutschland als starkes Land in der Mitte nicht mehr eingebunden ist in einen gemeinsamen Währungsraum. Europa lebt sich auseinander - und sein Einfluss in der Welt nimmt ab.
Kuschelige Bonner Republik
Zwar ist die neue D-Mark stark, weil viel Kapital nach Deutschland strömt. Den Preis aber zahlt die Exportwirtschaft. Der Ökonom Henrik Enderlein nennt eine solche Rückkehr zur Mark "den utopischen Wunsch einiger Nostalgiker, in eine kuschelige Welt der Bonner Republik zurückzukehren". Das funktioniere aber angesichts der internationalen Vernetzung nicht mehr.
Auf der anderen Seite werden Importe billiger. Die Inflation ist niedrig, aber wegen der zu erwartenden Arbeitsplatzverluste in der Exportwirtschaft geht davon kein großer Impuls für die Wirtschaft aus.
Durststrecke im Süden
Länder wie Griechenland, Spanien und Italien lassen ihre Währung abwerten. Das verbessert die Exportchancen, und mit günstigen Preisen kann man mehr Touristen anlocken. Die noch auf Euro lautenden Staatsschulden werden aber im Verhältnis zur neuen Währung noch größer. Länder allerdings, die umschulden, werden womöglich auf Jahre von den Anlegern gemieden. Der Lebensstandard der Bevölkerungen sinkt - viel stärker als durch die verhassten Sparprogramme in der Euro-Zone.
Peter Ehrlich, Brüssel, und Martin Kaelble, Berlin
Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent