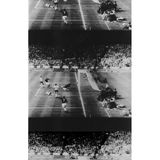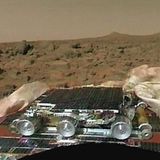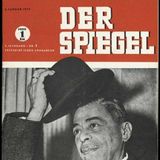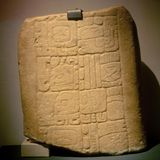8. April 2013: Femen-Aktivistinnen stürmen halbnackt auf Putin und Merkel zu
Wladimir Putin scheint begeistert, Angela Merkel eher peinlich berührt: Vor genau zehn Jahren protestieren Aktivistinnen der ukrainischen Aktionsgruppe Femen beim Gang des russischen Präsidenten und der damaligen Bundeskanzlerin über die Hannover Messe gegen das Kreml-Regime. Oben ohne und laut schreiend rennen die Frauen auf Putin zu und werden erst kurz vor ihrem Ziel von Bodyguards abgefangen. Auf ihre Brüste haben die Demonstrantinnen "fuck dictator" geschrieben.
Putin gibt sich auf der anschließenden Pressekonferenz belustigt von dem Vorfall. "Die Aktion hat mir gefallen", sagt er. Daran sei "nichts Schreckliches". Was die Frauen geschrieen hätten, habe er aber nicht genau verstehen können. Der Präsident empfiehlt, wer politische Diskussionen führen wolle, solle sich etwas anziehen. Dass er solche Diskussionen in seinem eigenen Land gerade erst durch ein neues Gesetz erschwert hat, erwähnt der Präsident nicht. Seit November 2012 müssen sich der Regelung zufolge Einrichtungen in Russland, die Geld aus dem Ausland erhalten, als "Agenten" registrieren lassen. Nach Inkrafttreten der Vorschrift gab es mehrere Razzien bei zivilen Einrichtungen, von denen auch auch deutsche Organisationen betroffen waren.
Wladimir Putin scheint begeistert, Angela Merkel eher peinlich berührt: Vor genau zehn Jahren protestieren Aktivistinnen der ukrainischen Aktionsgruppe Femen beim Gang des russischen Präsidenten und der damaligen Bundeskanzlerin über die Hannover Messe gegen das Kreml-Regime. Oben ohne und laut schreiend rennen die Frauen auf Putin zu und werden erst kurz vor ihrem Ziel von Bodyguards abgefangen. Auf ihre Brüste haben die Demonstrantinnen "fuck dictator" geschrieben.
Putin gibt sich auf der anschließenden Pressekonferenz belustigt von dem Vorfall. "Die Aktion hat mir gefallen", sagt er. Daran sei "nichts Schreckliches". Was die Frauen geschrieen hätten, habe er aber nicht genau verstehen können. Der Präsident empfiehlt, wer politische Diskussionen führen wolle, solle sich etwas anziehen. Dass er solche Diskussionen in seinem eigenen Land gerade erst durch ein neues Gesetz erschwert hat, erwähnt der Präsident nicht. Seit November 2012 müssen sich der Regelung zufolge Einrichtungen in Russland, die Geld aus dem Ausland erhalten, als "Agenten" registrieren lassen. Nach Inkrafttreten der Vorschrift gab es mehrere Razzien bei zivilen Einrichtungen, von denen auch auch deutsche Organisationen betroffen waren.
© Sasha Mordovets / Getty Images













![Bilder der Weltgeschichte: 26. Juni 1963: John F. Kennedy erobert mit einem historischen Satz die Herzen der Berliner Es ist eines der berühmtesten Zitate von John F. Kennedy. Am 26. Juni 1963 spricht der damalige US-Präsident bei einem Besuch in West-Berlin anlässlich des 15. Jahrestages der Berliner Luftbrücke vor dem Rathaus Schöneberg. Tausende Zuschauer verfolgen Kennedys Rede, in der er die Verbundenheit der USA zu West-Berlin unterstreicht, bevor er zunächst sagt: "Vor zweitausend Jahren war der stolzeste Satz: 'Ich bin ein Bürger Roms'. Heute, in der Welt der Freiheit, ist der stolzeste Satz: 'Ich bin ein Berliner'." Nach einem Exkurs über die Freiheit schließt Kennedy seine Ansprache mit den unvergessenen Worten ab: "Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger Berlins. Und deshalb bin ich, als freier Mensch, stolz darauf, sagen zu können: 'Ich bin ein Berliner!'". Im Original: "Two thousand years ago the proudest boast was: ‘Civis romanus sum’. Today, in the world of freedom, the proudest boast is: 'Ich bin ein Berliner'." [...] "All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride in the words: 'Ich bin ein Berliner!'" 26. Juni 1963: John F. Kennedy erobert mit einem historischen Satz die Herzen der Berliner Es ist eines der berühmtesten Zitate von John F. Kennedy. Am 26. Juni 1963 spricht der damalige US-Präsident bei einem Besuch in West-Berlin anlässlich des 15. Jahrestages der Berliner Luftbrücke vor dem Rathaus Schöneberg. Tausende Zuschauer verfolgen Kennedys Rede, in der er die Verbundenheit der USA zu West-Berlin unterstreicht, bevor er zunächst sagt: "Vor zweitausend Jahren war der stolzeste Satz: 'Ich bin ein Bürger Roms'. Heute, in der Welt der Freiheit, ist der stolzeste Satz: 'Ich bin ein Berliner'." Nach einem Exkurs über die Freiheit schließt Kennedy seine Ansprache mit den unvergessenen Worten ab: "Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger Berlins. Und deshalb bin ich, als freier Mensch, stolz darauf, sagen zu können: 'Ich bin ein Berliner!'". Im Original: "Two thousand years ago the proudest boast was: ‘Civis romanus sum’. Today, in the world of freedom, the proudest boast is: 'Ich bin ein Berliner'." [...] "All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride in the words: 'Ich bin ein Berliner!'"](https://image.stern.de/33592632/t/h4/v9/w160/r1/-/26-1963-jfk-rede.jpg)